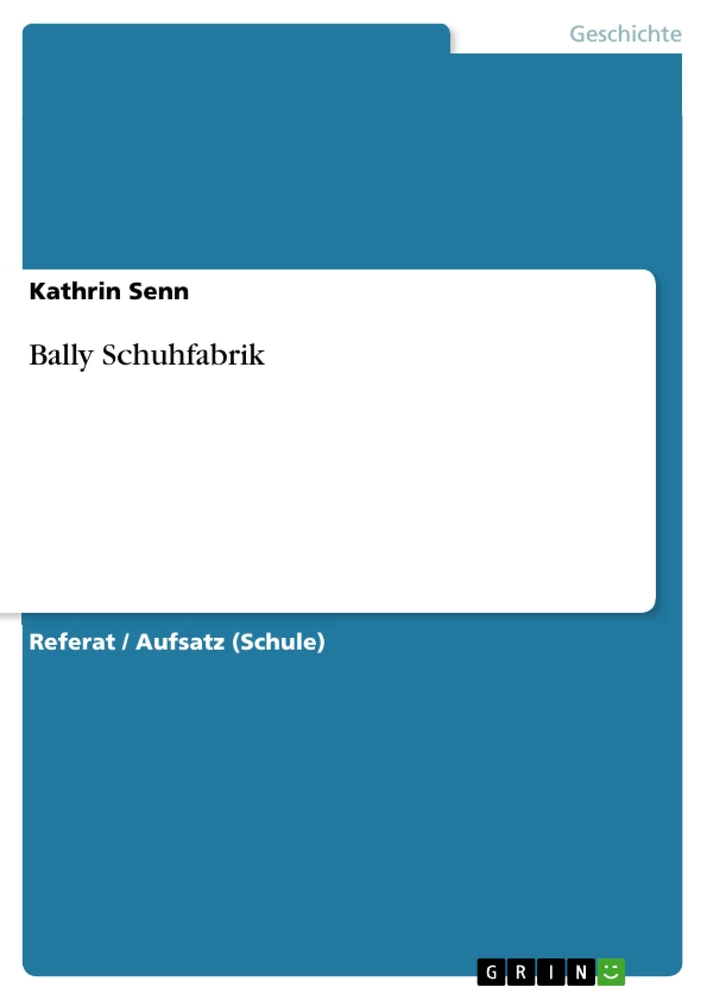Bally
Entstehung:
Als "Gründer der Schönenwerder Industrie" gilt Franz Ulrich, der 1778, in der Aarauer Seidenbandindustrie Arbeit fand. Er erwarb das Bürgerrecht von Rohr (SO), heiratete eine Schönenwerderin und eröffnete ein Merceriewaren-Handelsgeschäft. Sein älterer Sohn Peter Bally übernahm das väterliche Geschäft samt der Seidenbandfabrik seines Lehrmeisters Johann Rudolf Meyer in Aarau.
Bis in die Krisenzeit der 1840er Jahre beschäftigte er von Schönenwerd aus ca. 450 Heimarbeiter und-arbeiterinnen der Region in der Band- und Hosenträgerfabrikation. Auf die Gründung des Deutschen Zollvereins reagierte er 1836 mit der Eröffnung einer Zweigniederlassung in Säckingen. Seine Söhne teilten das Geschäft 1849 unter sich auf: Peter und Alexander übernahmen die Bandweberei in Schönenwerd, Jean und Theodor diejenige in Säckingen, Carl Franz und Fritz die Elastikweberei und Hosenträgerfabrik. 1854 übernahm Carl Franz das Unternehmen unter dem Namen C.F. Bally allein. Drei Jahre später wurden erstmals Schuhe nach Südamerika exportiert, was den internationalen Ausbau der Verkaufsorganisation und später auch die Produktion einleitete. Dank dem von Eduard Bally, einem Sohn von Carl Franz Bally, in den USA erworbene Know-How erfolgte eine langsame, aber stetige Umstellung der Produktion von Hand- auf Maschinenarbeit. Gleichzeitig eröffnete Bally eigene Vertretungen im Ausland: 1870 in Montevideo, 1879 in Paris und 1881 in London, was ein erster Schritt zur Erschliessung der Absatzmärkte im britischen Empire war. 1892 übernahmen die Gebrüder Eduard und Arthur Bally die Geschäftsleitung und nannten das Unternehmen nun C.F. Bally Söhne.
Seit dem Durchbruch des Freisinns 1830 engagierten sich die Bally in der kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Politik, aber auch in kirchlichen und sozialen Belangen. Bis in die Zeit des 2. Weltkriegs sassen die Bally-Herren in den eidgenössischen und solothurnischen Parlamenten und kontrollierten durch ihre Angestellten auch die kommunalen Behörden im Umkreis von Schönenwerd. Zur Bindung der Stammarbeiterschaft an das Unternehmen bauten sie ein System innerbetrieblichen Sozialfürsorge auf, das weitherum als vorbildlich galt. Andererseits aber wurde die Bildung von Gewerkschaften unter der Arbeiterschaft mit allen Mitteln bekämpft. Wegen der Verschärfung der sozialpolitischen Auseinandersetzung organisierte Eduard die Schuhfabrikanten 1887 im Verband schweizerischen Schuhindustrieller (VSS). Demgegenüber trat sein Bruder Arthur u.a. als Förderer des kantonalen Lungensanatoriums Allerheiligenberg hervor.
1894 streikten die Arbeiter der Filiale Aarau, da sie ihre qualifizierten, gut bezahlten Arbeitsplätze durch den Einsatz von Zwickmaschinen in der Schuhproduktion bedroht sahen. Der zweite grosse Streik bei Bally brach im Zuge der Streikwelle von 1907 aus, sämtliche Streikenden wurden vom Unternehmen entlassen.
Im selben Jahr wurde die C.F. Bally AG mit 8 Millionen Franken Aktien- und 4 Millionen Franken Obligationenkapital gegründet. In den folgenden Jahren wurden die Produktion und die Verkaufsorganisation im In- und Ausland kontinuierlich ausgebaut. Noch vor dem 1. Weltkrieg setzte sich Bally mit dem Taylorismus auseinander und führte ab 1915 Zeitstudien und arbeitspsychologische Untersuchungen durch. 1921 wurde die Holding C.F. Bally AG unter Aufteilung in einzelne Gesellschaften gegründet. Darauf folgte eine krisenhafte Zeit mit Absatz- und Produktionsrückgängen infolge von rückläufigen Bestellungen und Verlusten, die aus dem Währungszerfall im Ausland resultierten. In den 1930er Jahren stockte der Absatz vor allem wegen zunehmender Konkurrenz im In- und Ausland. Die Situation verschärfte sich noch durch die Materialknappheit während des 2. Weltkrieges. Danach erholte sich das Unternehmen im Zuge des allgemeinen Wirtschaftswachstums sehr rasch und erlebte bis zur Mitte der 1960er Jahren einen stetigen Aufschwung, dem dann allerdings massive Rückschläge folgten. Diese manifestierten sich insbesondere im Exportbereich, da die Konkurrenz zunehmend in Billiglohnländern produzierte. Um die Mitte der 1970er Jahre wurden deshalb Fabriken geschlossen oder verlegt.
Bis in die Zeit des 2. Weltkriegs sassen die Bally-Herren in den eidgenössischen. und solothurnischen Parlamenten und kontrollierten durch ihre Angestellten auch die kommunalen Behörden im Umkreis von Schönenwerd. Zur Bindung der Stammarbeiterschaft an das Unternehmen bauten sie ein System
Kathrin Senn Page 1 of 1
F:\Einzelne Arbeiten\erledigt\gesch-text373.doc
Bally
innerbetrieblicher Sozialfürsorge auf, das weitherum als vorbildlich galt. Andererseits aber wurde die Bildung von Gewerkschaften unter der Arbeiterschaft mit allen Mitteln bekämpft. Wegen der Verschärfung der sozialpolitischen Auseinandersetzung organisierte Eduard Bally die Schuhfabrikanten 1887 im Verband schweizerischer Schuhindustrieller (VSS). Demgegenüber trat sein Bruder Arthur Bally unter anderem als Förderer des kantonalen Lungensanatoriums Allerheiligenberg hervor.
Seit Beginn der 1970er Jahre zogen sich die Mitglieder der Familie Bally sukzessive aus der Geschäftsleitung zurück. Anfangs 1977 erwarb der junge Financier Werner K. Rey die Aktienmehrheit von Bally und gelangte an die Spitze von Verwaltungsrat und Generaldirektion. Bereits im Herbst des selben Jahres übernahm die Oerlikon-Bührle Holding AG alle Aktien von Bally und gliederte das Unternehmen als Gruppe Bally in die Holding ein.
Dank der wachsenden Bedeutung des Fernen Ostens als Absatzgebiet erzielte die Gruppe Bally zu Beginn der 1980er Jahre wieder positive Ergebnisse. 1986 manifestierten sich jedoch strukturelle Probleme in den Bereichen Produktion, Marketing und Verkauf. Auch die 1991 einsetzende Rezession schlug sich massiv auf die Umsatzzahlen nieder und löste eine Reorganisation sowie eine erneute Produktionsdrosselung aus. 1999 wurde Bally an die Texanische Beteiligungsgesellschaft Texas Pacific Group verkauft, die im Jahr 2000 die Schuhproduktion in Schönenwerd einstellte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bally
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Schuhmuseum:
Vor mehr als 100 Jahren sind exotische Schuhe aus dem fernen Asien, dem nördlichen Amerika, aus Persien, der Türkei, dem Land am Nil und aus Ostafrika auf dem See- und Landweg nach Schönenwerd gereist und haben vorerst in aller Stille Regale im Obergeschoss der alten Elastikfabrik bevölkert. Noch ahnte niemand, nicht einmal die Herren der damals aufstrebenden Schuhfabrik, die weltweit nach ausgefallenen Schuhen fahnden liessen, dass diese Exoten einst den Grundstock zu einem Museum liefern sollten. Heute umfasst die reichhaltige Sammlung nicht nur kostbare Extravaganzen der Schuhgeschichte, sondern auch bedeutende Darstellungen und Objekte zur Historie des Schuhmacherhandwerks, zum Schuh als Symbol und Glücksbringer sowie eine umfangreiche völkerkundliche Übersicht zum Schuhwerk.
Aktuelles: Kleider sollen für Bally zum zweiten Standbein werden. Bis in zwei Jahren sollen sie 15 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Häufig gestellte Fragen zu Bally
Was ist der Ursprung von Bally?
Franz Ulrich gilt als "Gründer der Schönenwerder Industrie". Er fand 1778 Arbeit in der Aarauer Seidenbandindustrie, erwarb das Bürgerrecht von Rohr (SO), heiratete eine Schönenwerderin und eröffnete ein Merceriewaren-Handelsgeschäft. Sein Sohn Peter Bally übernahm das Geschäft.
Wie expandierte Bally im 19. Jahrhundert?
Peter Bally beschäftigte ca. 450 Heimarbeiter in der Band- und Hosenträgerfabrikation. 1836 eröffnete er eine Zweigniederlassung in Säckingen. Seine Söhne teilten das Geschäft 1849 auf. Carl Franz Bally übernahm 1854 das Unternehmen und begann 1857 mit dem Export von Schuhen nach Südamerika.
Welche Rolle spielten die Ballys in der Politik und Gesellschaft?
Die Ballys engagierten sich seit 1830 in der kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Politik sowie in kirchlichen und sozialen Belangen. Sie bauten ein System innerbetrieblicher Sozialfürsorge auf, bekämpften aber die Bildung von Gewerkschaften.
Gab es Streiks bei Bally?
1894 streikten die Arbeiter der Filiale Aarau. Ein weiterer grosser Streik brach 1907 aus, woraufhin die Streikenden entlassen wurden.
Wie entwickelte sich Bally im 20. Jahrhundert?
1907 wurde die C.F. Bally AG gegründet. In den 1920er und 1930er Jahren gab es Krisen. Nach dem 2. Weltkrieg erholte sich das Unternehmen rasch, erlebte aber ab den 1960er Jahren Rückschläge aufgrund von Konkurrenz in Billiglohnländern. Fabriken wurden geschlossen oder verlegt.
Wann zogen sich die Ballys aus der Geschäftsleitung zurück?
Ab den 1970er Jahren zogen sich die Mitglieder der Familie Bally sukzessive aus der Geschäftsleitung zurück.
Wer übernahm Bally Ende der 1970er Jahre?
Anfangs 1977 erwarb Werner K. Rey die Aktienmehrheit. Im Herbst des selben Jahres übernahm die Oerlikon-Bührle Holding AG alle Aktien.
Was geschah mit Bally in den 1980er und 1990er Jahren?
Die Gruppe Bally erzielte zu Beginn der 1980er Jahre wieder positive Ergebnisse, hatte aber ab 1986 mit strukturellen Problemen zu kämpfen. 1999 wurde Bally an die Texas Pacific Group verkauft, die im Jahr 2000 die Schuhproduktion in Schönenwerd einstellte.
Was beinhaltet das Schuhmuseum in Schönenwerd?
Das Schuhmuseum umfasst eine reichhaltige Sammlung kostbarer Schuhe aus aller Welt, Darstellungen und Objekte zur Schuhmacherhandwerksgeschichte sowie eine völkerkundliche Übersicht zum Schuhwerk.
Was sind aktuelle Entwicklungen bei Bally?
Kleider sollen für Bally zum zweiten Standbein werden und in zwei Jahren 15 Prozent des Umsatzes ausmachen.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Senn (Autor:in), 2001, Bally Schuhfabrik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100771