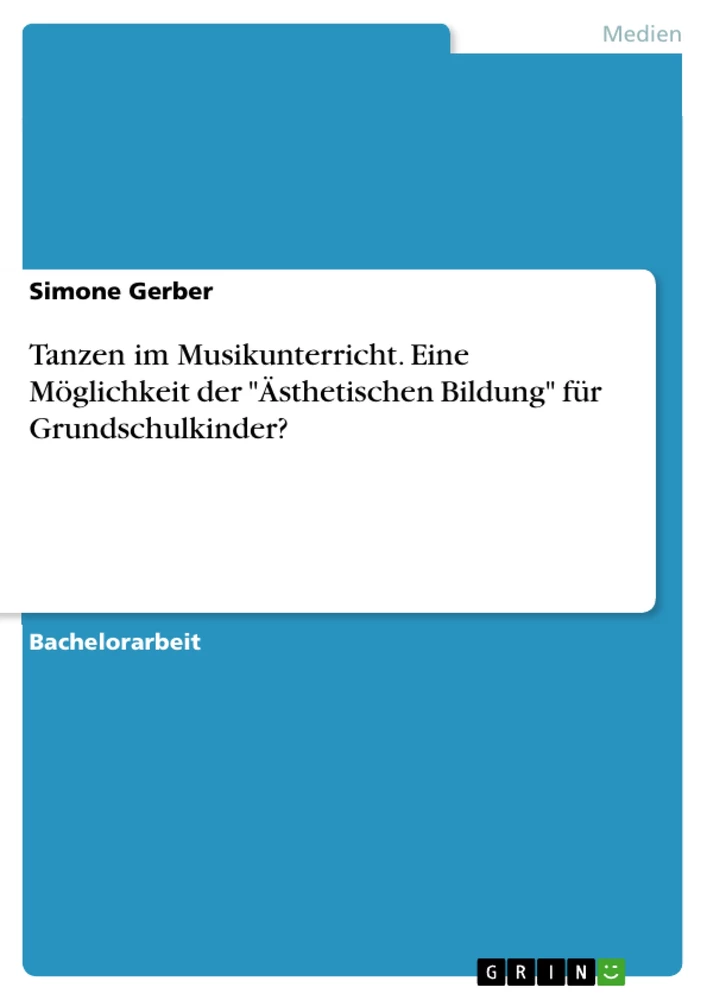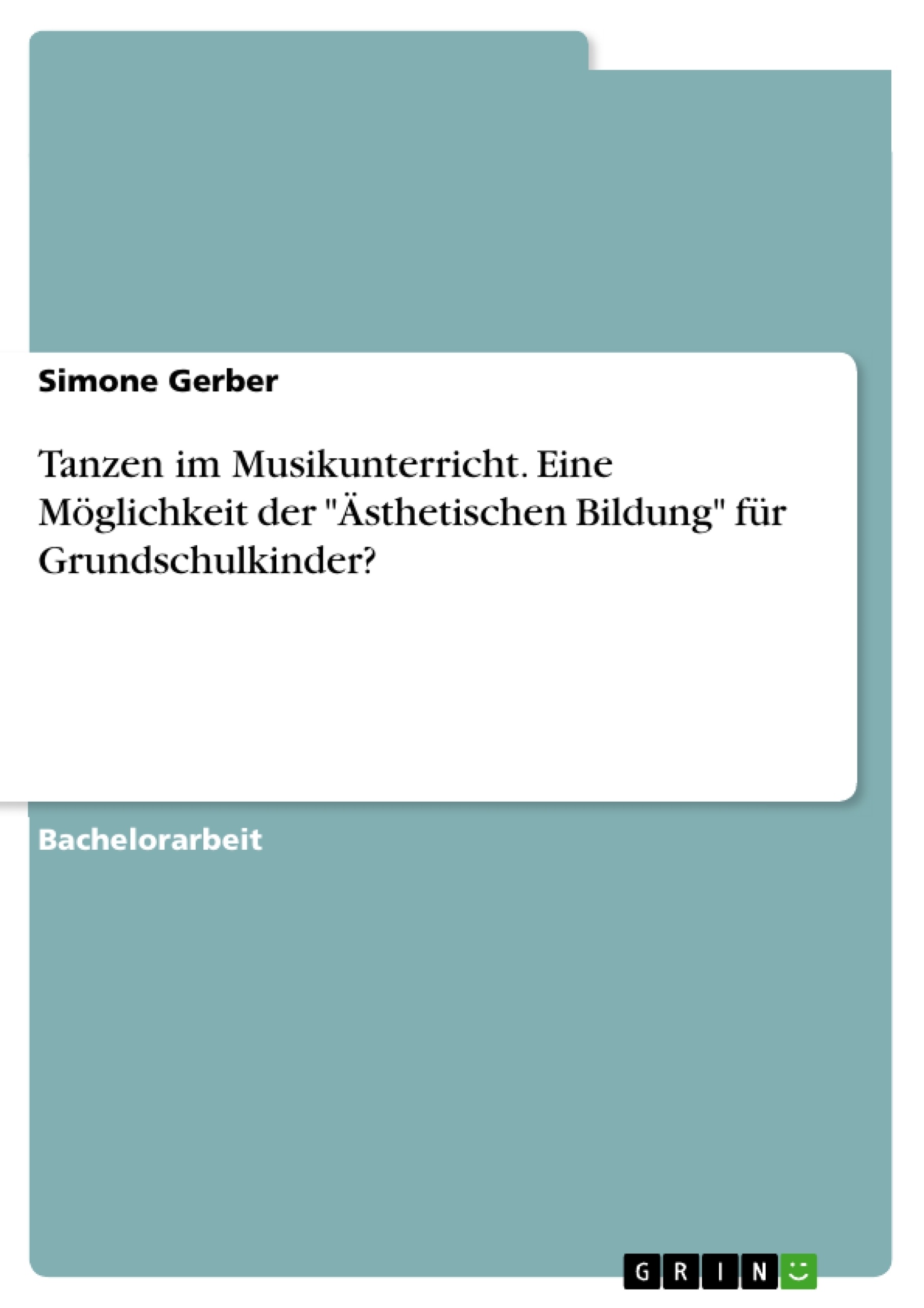Diese Bachelorarbeit untersucht das Tanzen als Gegenstand ästhetischen Erlebens im schulischen Kontext, insbesondere dessen Wirkung auf verhaltensauffällige Kinder.
"Tanz ist gelebte Musik" ist das zeitgenössische Zitat der deutschen Sozialpädagogin Helga Schäferling und drückt das aus, was schon Carl Orff Anfang des 20. Jahrhunderts vermittelte: "[…] diese Kindheitsmelodie, diese primitive Musik ist eins mit der Körperlichkeit, der Bewegung". "Das Wichtige ist, das Kind aus sich selbst heraus spielen zu lassen und alles Störende fernzuhalten; Wort und Ton müssen zugleich aus dem rhythmischen Spiel improvisatorisch entstehen".
Orff betont nicht nur den unbedingten Zusammenhang zwischen Musik und Bewegung als Grundlage für Bildung und einem Grundverständnis für Musik, vielmehr hebt er die freiwerdende Kreativität des Kindes durch Tanz hervor. Er verweist dabei auf das Phänomen der seit der Antike vieldiskutierten 'Ästhetischen Bildung'.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Musikunterricht in der Grundschule
- 2.1. Bedeutung des Unterrichtsfachs Musik auf die Gesamtentwicklung des Kindes
- 2.2. Aktuelle Situation der schulischen Musikpädagogik
- 2.3. Aufbauender Musikunterricht
- 2.4. Begriffsdefinitionen
- 2.4.1. Bewegung
- 2.4.2. Tanzen
- 3. Bewegung und Tanzen
- 3.1. Lernziele und Kompetenzen
- 3.2. Umsetzung des Tanzens im Aufbauenden Musikunterricht
- 3.3. Bedeutung Tanz und Bewegung für die Kindesentwicklung
- 3.3.1. Einfluss des Tanzens auf die kindliche Entwicklung
- 3.3.2. Bedeutung der Verbindung von Musik und Tanz auf die Kindesentwicklung
- 3.3.3. Neurologische Hintergründe
- 4. Ästhetische Erfahrung und Bildung
- 4.1. Bildungsprozesse und Bedeutungen des Bewegens und Tanzens
- 4.2. Funktion des Tanzens als Ästhetische Bildung im Musikunterricht
- 5. Soziale Kompetenzen und Integration
- 5.1. Begriffsdefinition soziale Kompetenzen, Selbstkonzept, Integration
- 5.2. Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
- 5.3. Erwerb sozialer Kompetenzen durch ästhetisches Erleben beim Tanzen
- 6. Methodisches Vorgehen nach Grounded Theory
- 6.1. Die Grounded Theory Methode
- 6.2. Qualitative Sozialforschung und qualitatives Interview
- 6.2.1. Stichprobenauswahl / Sampling
- 6.2.2. Warum ein leitfadengestütztes Einzelinterview als,Qualitatives Interview'
- 6.2.3. Interviewbedingungen und mein Leitfaden
- 6.3. Auswertung durch Codierung nach Strauss und Corbin
- 7. Ergebnisse
- 7.1. Hauptkategorien
- 7.1.1. Funktion des Tanzens im Hinblick auf den Aufbau musikalischer Kompetenzen
- 7.1.2. Wirkung des Tanzens
- 7.1.2.1. Ästhetisches Erleben
- 7.1.2.2. Sozialkompetenzentwicklung
- 7.1.2.3. Soziale Integration verhaltensauffälliger SchülerInnen
- 7.2. Ergebnisanalyse
- 7.2.1. Deutung der Ergebnisse
- 7.2.2. Bilden der Kernkategorie und These
- 7.1. Hauptkategorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Tanz als ästhetisches Erlebnis im Grundschul-Musikunterricht, insbesondere dessen Wirkung auf verhaltensauffällige Kinder. Sie untersucht die Funktion des Tanzens für den Musikunterricht und analysiert die Auswirkungen des Tanzens auf ästhetisches Erleben, Sozialkompetenzentwicklung und die soziale Integration von verhaltensauffälligen Schülern.
- Bedeutung des Tanzens im Grundschul-Musikunterricht
- Ästhetisches Erleben und seine Bedeutung für Kinder
- Entwicklung sozialer Kompetenzen durch Tanzen
- Soziale Integration verhaltensauffälliger Schüler durch Tanz
- Qualitative Sozialforschung und die Grounded Theory Methode
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Tanz und Bewegung im Musikunterricht, insbesondere im Hinblick auf die Kreativität und Ästhetische Bildung von Kindern. Sie stellt die Forschungsfrage und die Methode der Grounded Theory vor, die zur Analyse der Daten verwendet wird.
- Kapitel 2: Musikunterricht in der Grundschule: Dieses Kapitel behandelt die aktuelle Situation des Musikunterrichts in der Grundschule, die Heterogenität der Schüler und die Bedeutung des Faches Musik für die Gesamtentwicklung des Kindes. Es werden grundlegende Begriffe wie Bewegung und Tanzen definiert und der "Aufbauende Musikunterricht" vorgestellt.
- Kapitel 3: Bewegung und Tanzen: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Bewegung und Tanzen für die Kindesentwicklung untersucht. Es wird die Verbindung zwischen Musik und Tanz sowie die neurologischen Hintergründe des Tanzens erläutert. Die Kapitel beleuchtet die Lernziele und Kompetenzen im Musikunterricht und zeigt die Umsetzung des Tanzens im Aufbauenden Musikunterricht.
- Kapitel 4: Ästhetische Erfahrung und Bildung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Funktion des Tanzens als Ästhetische Bildung im Musikunterricht. Es werden Bildungsprozesse und die Bedeutung des Bewegens und Tanzens für ästhetische Erfahrungen dargestellt.
- Kapitel 5: Soziale Kompetenzen und Integration: In diesem Kapitel wird die Verbindung zwischen ästhetischem Erleben und sozialer Kompetenzentwicklung beleuchtet. Es werden Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern als Beispiel für misslungene soziale Integration betrachtet und der Erwerb sozialer Kompetenzen durch spezifischen Musikunterricht dargestellt.
- Kapitel 6: Methodisches Vorgehen nach Grounded Theory: Dieses Kapitel stellt die Grounded Theory Methode als qualitative Sozialforschungsmethode vor. Es beschreibt die Methode, die Interviewform und die Kodierungsverfahren, die zur Analyse der Daten verwendet werden.
- Kapitel 7: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Forschung, die mithilfe der Grounded Theory Methode erzielt wurden. Es werden die Hauptkategorien und die Kernkategorie der Untersuchung dargestellt und die Ergebnisse interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Tanz, Bewegung, Musikunterricht, Ästhetische Bildung, soziale Kompetenz, Integration und Verhaltensauffälligkeiten. Sie untersucht die Funktion des Tanzens im Grundschul-Musikunterricht und dessen Wirkung auf die Entwicklung von Kindern. Die verwendeten Methoden sind die Qualitative Sozialforschung und die Grounded Theory.
- Quote paper
- Simone Gerber (Author), 2020, Tanzen im Musikunterricht. Eine Möglichkeit der "Ästhetischen Bildung" für Grundschulkinder?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007806