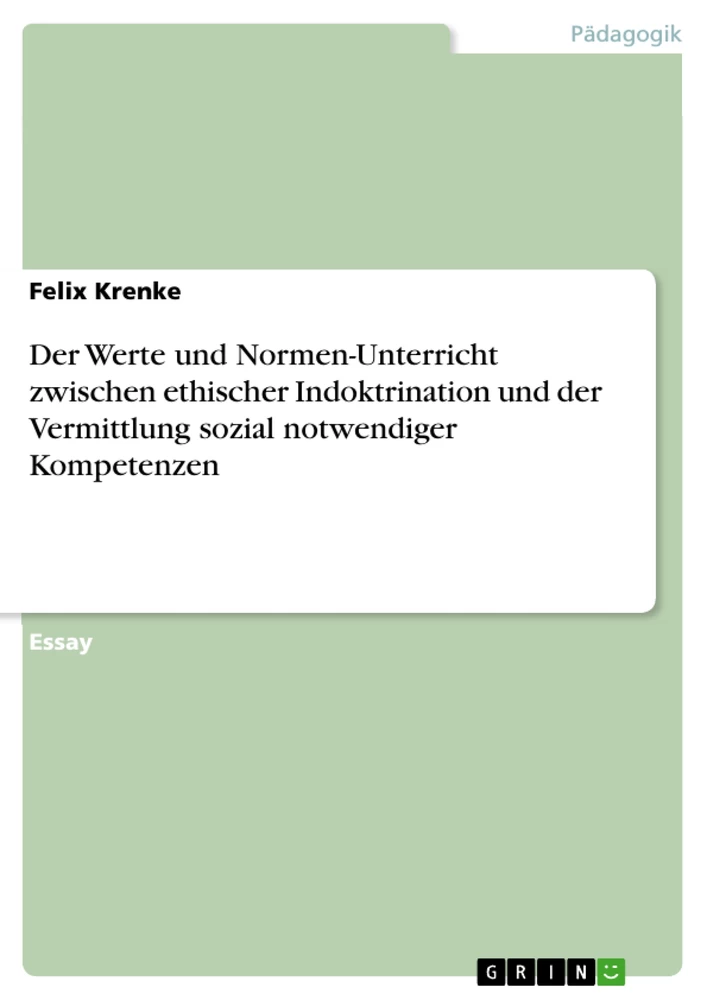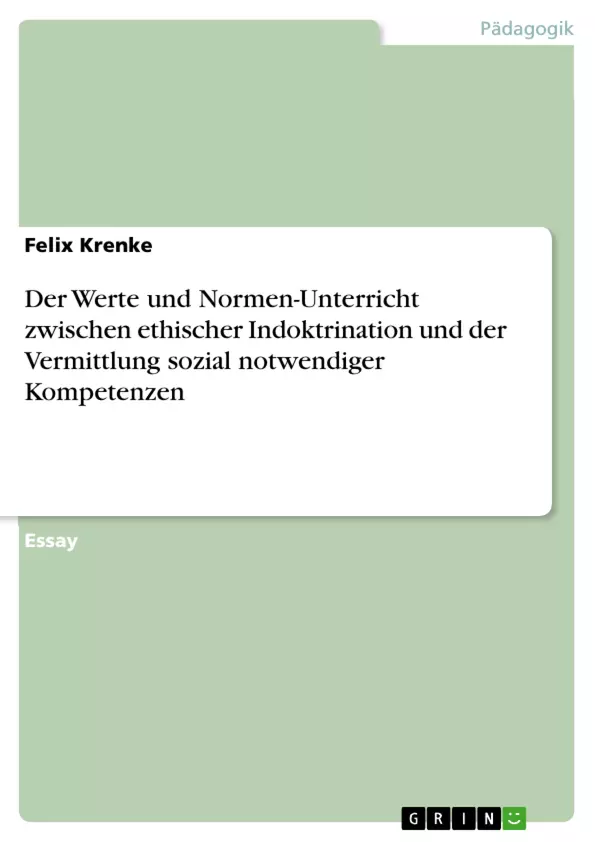In § 2 des niedersächsischen Schulgesetzes wird der Bildungsauftrag der Schulen deklariert, demzufolge die Schulen die „Persönlichkeit der Schüler und Schülerinnen (SuS) auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen“ weiterentwickelt werden soll. Diesem Anspruch an die schulische Bildung schließt sich die Forderung an, die SuS in die Lage zu versetzen „nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen und zu achten“. Dieser, im Schulgesetz formulierte Bildungsauftrag, geht weit über die bloße fachliche Unterweisung in wissenschaftlichen Disziplinen hinaus. Er kann ohne weiteres als Erziehungsauftrag verstanden werden, wenn die Schulen im Gesetzestext angehalten werden ihre SuS dazu zu befähigen „ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten.“ Im schulischen Bildungsauftrag sowie im gesellschaftlichen Zusammenleben nehmen diese Kompetenzen einen zentralen Stellenwert ein, welcher schlicht nicht überschätzt werden kann. Die Notwendigkeit dieser Kompetenzen für das tatsächliche, außerschulische Leben steht außer Frage. Somit sollte die Umsetzung dieser Ansprüche an die Schulbildung unbedingt gewährleistet sein und eine hohe Priorität haben. Allerdings gestaltet sich die Vermittlung dieser Kompetenzen für naturwissenschaftliche und sprachliche Fächer meist als sehr schwer. Fächer mit gesellschaftswissenschaftlichem Bezug eröffnen dahingehend mehr Möglichkeiten. Ein Nebenfach jedoch, welches unglücklicherweise an vielen Schulen ein geradezu karges Schattendasein führt, ist der Vermittlung dieser Kompetenzen verschrieben; der Werte- und Normen-Unterricht. Er schafft einen Raum im schulischen Kontext in dem „unterschiedliche Weltanschauungen und Wahrheitsauffassungen im Sinne einer prinzipiellen Pluralität berücksichtigt“ und diskutiert werden können. Außerdem sollen die SuS „für die moralischen und sittlichen Dimensionen menschlichen Handelns“ sensibilisiert werden und die „Anwendung der Kriterien ethischer Argumentationsweisen“ erlernen. Aus diesen, im Kerncurriculum formulierten Zielen, leitet sich seine Notwendigkeit für die schulische Bildung eines jeden/r SuS ab, wenn das Niedersächsischen Schulgesetzes im Schulalltag tatsächliche Gültigkeit haben sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Werte und Normen-Unterricht zwischen ethischer Indoktrination und der Vermittlung sozial notwendiger Kompetenzen
- Der Bildungsauftrag der Schulen
- Die Bedeutung des Werte- und Normen-Unterrichts
- Die Problematik der Vermittlung von Werten und Normen
- Der Kulturübertragungsansatz
- Kritik am Kulturübertragungsansatz
- Die romantische Schule oder das Gewährenlassen
- Kritik am Gewährenlassen
- Werturteilsfähigkeit
- Der Werte- und Normen-Unterricht in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Werte- und Normen-Unterricht in der Schule. Er analysiert die Problematik der Vermittlung von Werten und Normen im Kontext des Bildungsauftrags der Schulen, der den Schwerpunkt auf die Förderung sozialer Kompetenzen legt. Ziel des Textes ist es, die unterschiedlichen Ansätze zur moralischen Erziehung zu beleuchten, die Vor- und Nachteile zu diskutieren und schlussendlich einen Ansatz zu entwickeln, der die Entwicklung der Werturteilsfähigkeit der Schüler fördert.
- Der Bildungsauftrag der Schulen und die Bedeutung sozialer Kompetenzen
- Die Problematik der Vermittlung von Werten und Normen im Unterricht
- Die Analyse unterschiedlicher Ansätze zur moralischen Erziehung (Kulturübertragungsansatz, Gewährenlassen)
- Die Förderung der Werturteilsfähigkeit als Ziel des Werte- und Normen-Unterrichts
- Die Bedeutung des philosophischen Diskurses im Werte- und Normen-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Darstellung des Bildungsauftrags der Schulen, der auf die Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler und die Förderung sozialer Kompetenzen ausgerichtet ist. Der Wert des Werte- und Normen-Unterrichts im Kontext dieses Bildungsauftrags wird hervorgehoben. Anschließend wird das didaktische Problem der Vermittlung von Werten und Normen aufgezeigt. Zwei traditionelle Ansätze zur moralischen Erziehung werden vorgestellt und kritisch beleuchtet: der Kulturübertragungsansatz und das Gewährenlassen. Der Text analysiert die Vor- und Nachteile beider Ansätze und zeigt auf, dass sie in der Praxis nicht ausreichend sind, um die Entwicklung der Werturteilsfähigkeit der Schüler zu fördern. Schließlich stellt der Text die Werturteilsfähigkeit als Kernkompetenz des Werte- und Normen-Unterrichts vor. Es wird argumentiert, dass der Unterricht den Schülern helfen muss, eigene Urteile zu bilden und verschiedene moralische Perspektiven zu reflektieren.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Werten und Normen, Bildungsauftrag der Schulen, moralische Erziehung, Kulturübertragungsansatz, Gewährenlassen, Werturteilsfähigkeit, philosophischer Diskurs, und der Förderung sozialer Kompetenzen im Unterricht.
- Quote paper
- M. A., M. Ed. Felix Krenke (Author), 2015, Der Werte und Normen-Unterricht zwischen ethischer Indoktrination und der Vermittlung sozial notwendiger Kompetenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1008005