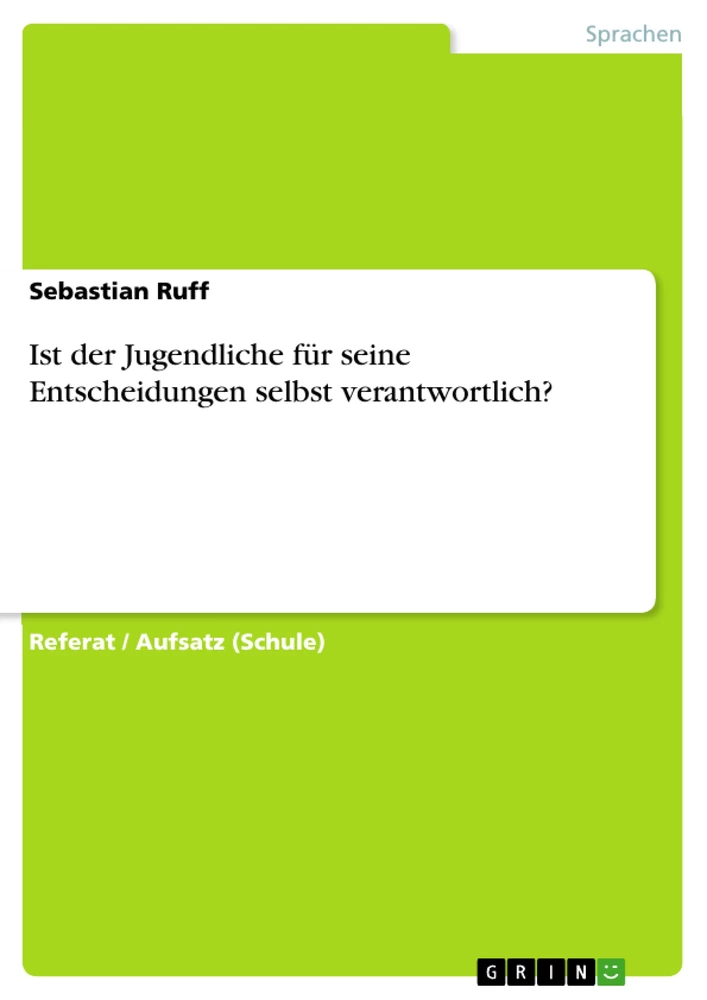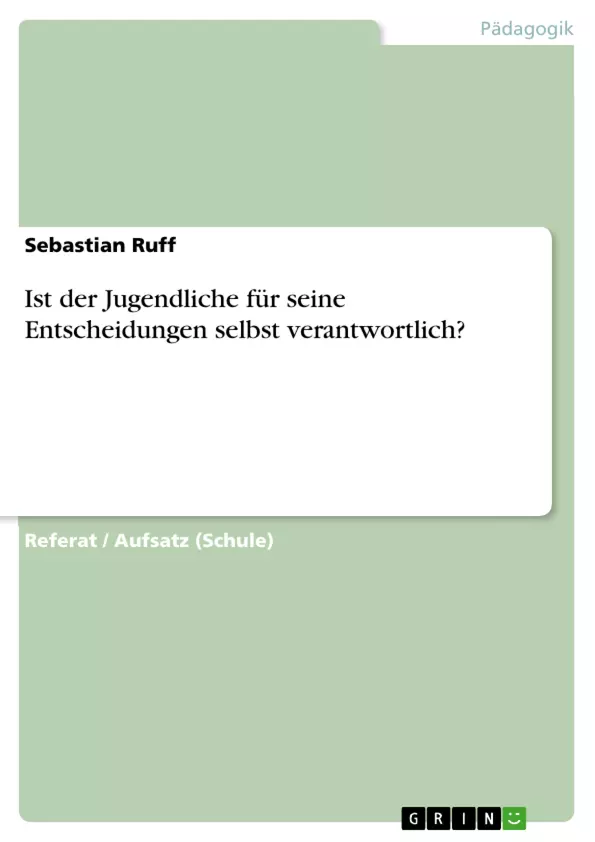Stehen wir am Scheideweg des Lebens und überlassen unsere Jugend dem blinden Zufall ihrer Entscheidungen? Diese tiefgründige Analyse wagt eine Auseinandersetzung mit der brisanten Frage, inwieweit junge Menschen tatsächlich für die Konsequenzen ihres Handelns verantwortlich gemacht werden können. Jenseits moralischer Urteile beleuchtet der Text die komplexen Einflüsse, die auf Heranwachsende wirken – von den unausweichlichen Fehltritten der Pubertät bis hin zum prägenden Einfluss von Eltern, Erziehungsberechtigten und gesellschaftlichen Normen. Anhand historischer Vergleiche, von mittelalterlichen Thronfolgern bis zu den Jugendorganisationen des 20. Jahrhunderts, wird die Vielschichtigkeit jugendlicher Entscheidungsfindung illustriert. Dabei werden die Grenzen der Eigenverantwortung ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit elterlicher Aufsicht und Vorbildfunktion. Ist es fair, von Jugendlichen vollkommene Reife und Weitsicht zu erwarten, oder bedarf es eines unterstützenden Rahmens, der ihnen hilft, die Konsequenzen ihres Handelns zu verstehen? Diese Erörterung plädiert für einen ausgewogenen Ansatz, der sowohl die Autonomie des Jugendlichen respektiert als auch die Schutzfunktion der Erwachsenen anerkennt. Sie ermutigt zu einem konstruktiven Dialog zwischen den Generationen, um gemeinsam tragfähige Entscheidungen zu treffen und Konflikte zu vermeiden. Ein unverzichtbarer Leitfaden für Eltern, Pädagogen und alle, die sich für das Wohl junger Menschen einsetzen – und ein Plädoyer für mehr Verständnis und weniger Schuldzuweisungen in einer Zeit des Umbruchs. Entdecken Sie fundierte Argumente, die zum Nachdenken anregen und neue Perspektiven auf die Herausforderungen der Jugend eröffnen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Verantwortung nicht nur eine Last, sondern auch eine Chance ist. Keywords: Jugend, Entscheidungen, Verantwortung, Erziehung, Eltern, Pubertät, Gesellschaft, Geschichte, Autorität, Konsequenzen, Moral, Ethik, Konfliktlösung, Generationen, Dialog, Aufsichtspflicht, Vorbildfunktion, Autonomie, Reife, Urteilsvermögen.
Erörterung
Thema: „Ist der Jugendliche für seine Entscheidungen selbst verantwortlich?“
Vorab sei dargestellt, dass durch diese Erörterung versucht wird, eine möglichst objektive Sicht auf die Problematik an den Tag zu legen. Dass ist besonders dahingehend schwierig, dass ich selbst mehr oder weniger in die Problematik involviert bin.
Dadurch ergibt sich einerseits eine etwas subjektive Sicht auf die Dinge, die ich möglichst versuche zu unterbinden, aber auch andererseits vielleicht eine bessere Möglichkeit, alle Seiten der Problematik genügend auszuleuchten.
Das Problem der Entscheidung - richtig als auch falsch - ist in der Menschheitsgeschichte nicht etwa nur in der Gegenwart anzutreffen. Genügend Beispiele für Jugendliche und deren Umgang mit Entscheidungen finden sich in der Geschichte.
Im Mittelalter zum Beispiel waren die Entscheidungsbereiche der Jugendliche andere als heute. Man konnte damals zwar schon im Kindesalter als Thronfolger feststehen und mußte damit fast unvorstellbar viele Entscheidungen mit großer Tragweite treffen, es konnte aber auch genauso gut passieren, dass man sich den Ehepartner nicht selber aussuchen konnte, sondern man ihn vorgeschrieben bekam. Im Faschismus und im Sozialismus der DDR war die Rolle der Jugendlichen wieder etwas differenziert. Einerseits hatte die damaligen Jugendorganisationen wie etwa die Hitlerjugend oder die Pioniere großen Einfluß auf das gesellschaftliche Leben, andererseits war man im normalen Leben eher an die allgemeine politische Marschrichtung gebunden und damit auch gleichzeitig fast jeder Entscheidungsgewalt entmächtigt.
Zusätzlich zum geschichtlichen Kontext muß man noch den Begriff „Entscheidung“ definieren und eine Differenzierung desselben vornehmen.
Eine E. ist eine Tat, die nach mehr oder minder ausführlicher Abwägung der Vor- und Nachteile getroffen wird und immer eine Konsequenz nach sich zieht.
Der Begriff E. verlangt auch nach einer Differenzierung:
1. Entscheidungen, die nur die Person oder mehrere Personen betrifft und
2. Entscheidungen, die in ihrer Konsequenz klar oder unklar sind.
Die beiden gegensätzlichen Thesen in dieser Erörterung sind:
„Der Jugendliche ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.“ und „Eine Autoritätsperson ist für die Entscheidungen des Jugendlichen verantwortlich.“
Schon durch die weitreichende Differenzierung des Begriffs E. ist hier keine eindeutige Ausgrenzung der einen oder anderen These möglich.
Auch durch die Ausgeglichenheit der Pro-Argumente für die beiden Thesen wird dies deutlich.
Für die erstere spricht, dass der Jugendliche lernen muß, selbst Verantwortung zu übernehmen und das so früh wie möglich.
So gewöhnt sich ein Jugendlicher am schnellsten an das spätere Leben, wo ihm kaum eine Entscheidung mehr abgenommen wird; dadurch lernt er auch, Konsequenzen abzuschätzen und mit ihnen umzugehen. Er lernt also für das wirkliche Leben.
Für die zweite These sprechen aber auch eine Reihe von Argumenten, an deren Spitze eine Forderung an ihre gesetzlichen Vormünder steht, sich auch eines ges. Vormundes zu verhalten, wenn mit der Autoritätsperson die Eltern gemeint sind. Außerdem lernen Jugendliche bzw. Kinder als erstes von den Eltern, d.h. sie versuchen, ihre Eltern in ihren Verhaltensweisen nachzuahmen. Dieser Verantwortung müssen sich die Autoritätspersonen bewußt werden. Auch die damit verbundene Aufsichtspflicht darf auf keinen Fall vergessen werden. Schon an diesen wenigen Argumenten sieht man, dass man nicht die eine oder andere Seite ganz vergessen darf.
Für Jugendliche ist es einerseits wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und eigene Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel bei der eigentlich trivialen Wahl der Hobbys oder dem Bildungsweg nach der Grundschule. Andererseits dürfen Autoritätspersonen, besonders die Eltern, ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen und müssen ihren Kindern ein gutes Vorbild sein.
Gegen die erste These, dass Jugendliche für ihre Entscheidungen selbst verantwortlich sind, spricht zum Beispiel, dass sie besonders in jungen Jahren noch nicht genug Erfahrungen gesammelt haben, um Entscheidungen zu treffen und ihre Konsequenzen abzuschätzen. Auch vom Gesetzlichen her können Jugendliche oder Kinder nicht für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden.
Insgesamt spricht hier die fehlende Erfahrung für die Jugendlichen.
Die Autoritätspersonen entlasten eigentlich zwei Hauptargumente: Zum einen ist es für sie schwer, einen Konsens aus Freiraum für ihre Schützlinge und der Kontrolle und Hilfe zu finden. Sie können die Jugendlichen ja nicht rund um die Uhr beobachten. Außerdem ist es besonders in der Pubertätsphase für die Autoritätspersonen schwer, die Zöglinge unter Kontrolle zu halten. Auch diese Gegenargumente dürfen nicht außer Acht gelassen werden, enthalten sie doch unumstößliche Inhalte.
Auffallend sind hier die gesetzliche Lage, d.h. alle Jugendlichen unter 14 Jahren sind vom Gesetz aus strafunmündig, und der schwierige Umgang mit Jugendlichen und ihrer Kontrolle.
Die oben genannten Differenzierungen und die auffallend breitgefächerten Pro- und Contra-Argumente lassen aus objektiver Sicht keine eindeutige Aussage zu und führen zwangsläufig zu einem Kompromiß, der nur so aussehen kann, dass sich Jugendliche und ihre Autoritätspersonen nicht gegenseitig den schwarzen Peter in die Schuhe schieben sollten, sondern versuchen sollten, gemeinsam wichtige Entscheidungen zu überdenken und sie dann zu treffen. Das ist meiner Meinung nach auch die einzige wirkliche Möglichkeit um die Konsequenz abzuschätzen und mögliche Streitsituationen so weit wie möglich zu verhindern.
Um die Differenzierung aufzugreifen, sind Entscheidungen, die nur den Jugendlichen selbst betreffen, nur von ihm zu treffen und er hat dann auch selbst die Verantwortung zu tragen. Bei Entscheidungen, die eine weiteren Personenkreis betreffen und die damit auch schwieriger zu treffen sind, kann ein Jugendlicher in den meisten Fällen nicht allein entscheiden und sollte dies auch nicht tun, sondern gemeinsam mit den Betroffenen entscheiden.
Genauso verhält es sich mit den Konsequenzen von Entscheidungen, die ja nicht immer sofort absehbar sind. E. mit eindeutigen Konsequenzen sind meistens auch durch Jugendliche leicht zu fällen und ziehen in der Regel keine größeren Probleme nach sich. Das größte Problem liegt in den unabsehbaren Konsequenzen, die von Jugendlichen meist unvernüftigerweise nicht überdacht werden und bei denen dann Probleme auftreten. Trotzdem kann man keiner der beiden Parteien bzw. Thesen uneingeschränkt zustimmen, es muß zumindest nach Alter und nach der Tragweite der Entscheidung unterschieden werden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Erörterung mit dem Thema: „Ist der Jugendliche für seine Entscheidungen selbst verantwortlich?“
Die Erörterung untersucht, ob Jugendliche für ihre Entscheidungen selbst verantwortlich sind oder ob Autoritätspersonen, wie z.B. Eltern, die Verantwortung tragen.
Welche historischen Beispiele werden angeführt?
Es werden Beispiele aus dem Mittelalter (Entscheidungen von Thronfolgern, Ehepartnerwahl) sowie dem Faschismus und Sozialismus der DDR (Einfluss von Jugendorganisationen, eingeschränkte Entscheidungsfreiheit) angeführt, um den Kontext von Entscheidungen Jugendlicher im Laufe der Geschichte zu beleuchten.
Wie wird der Begriff "Entscheidung" definiert?
Eine Entscheidung wird definiert als eine Tat, die nach Abwägung der Vor- und Nachteile getroffen wird und immer eine Konsequenz nach sich zieht. Es wird zwischen Entscheidungen, die nur die Person selbst betreffen, und solchen, die mehrere Personen betreffen, sowie zwischen Entscheidungen mit klaren und unklaren Konsequenzen unterschieden.
Welche gegensätzlichen Thesen werden in der Erörterung behandelt?
Die gegensätzlichen Thesen sind: "Der Jugendliche ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich" und "Eine Autoritätsperson ist für die Entscheidungen des Jugendlichen verantwortlich".
Welche Argumente sprechen für die Eigenverantwortung des Jugendlichen?
Ein Argument ist, dass der Jugendliche lernen muss, selbst Verantwortung zu übernehmen, um sich an das spätere Leben zu gewöhnen und Konsequenzen abschätzen zu lernen. Er lernt also für das wirkliche Leben.
Welche Argumente sprechen für die Verantwortung der Autoritätspersonen?
Argumente sind die Aufsichtspflicht der Eltern, die Vorbildfunktion der Eltern und die Notwendigkeit, sich wie ein gesetzlicher Vormund zu verhalten.
Welche Gegenargumente werden gegen die Eigenverantwortung des Jugendlichen angeführt?
Es wird argumentiert, dass Jugendliche, besonders in jungen Jahren, noch nicht genug Erfahrungen gesammelt haben, um Entscheidungen zu treffen und deren Konsequenzen abzuschätzen. Auch vom Gesetzlichen her können Jugendliche oder Kinder nicht für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden.
Welche Gegenargumente werden gegen die Verantwortung der Autoritätspersonen angeführt?
Es wird argumentiert, dass es für Autoritätspersonen schwer ist, einen Konsens aus Freiraum für ihre Schützlinge und Kontrolle zu finden. Besonders in der Pubertätsphase ist es schwer, Jugendliche unter Kontrolle zu halten.
Zu welchem Kompromiss kommt die Erörterung?
Die Erörterung kommt zu dem Kompromiss, dass Jugendliche und ihre Autoritätspersonen gemeinsam wichtige Entscheidungen überdenken und treffen sollten, um die Konsequenzen abzuschätzen und mögliche Streitsituationen zu verhindern. Entscheidungen, die nur den Jugendlichen selbst betreffen, sind von ihm selbst zu treffen.
Wie wird mit Entscheidungen mit unabsehbaren Konsequenzen umgegangen?
Bei Entscheidungen mit unabsehbaren Konsequenzen, die von Jugendlichen oft unüberlegt getroffen werden, ist es wichtig, dass sie gemeinsam mit den Betroffenen entscheiden und dass nach Alter und Tragweite der Entscheidung unterschieden wird.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Ruff (Autor:in), 2000, Ist der Jugendliche für seine Entscheidungen selbst verantwortlich?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100859