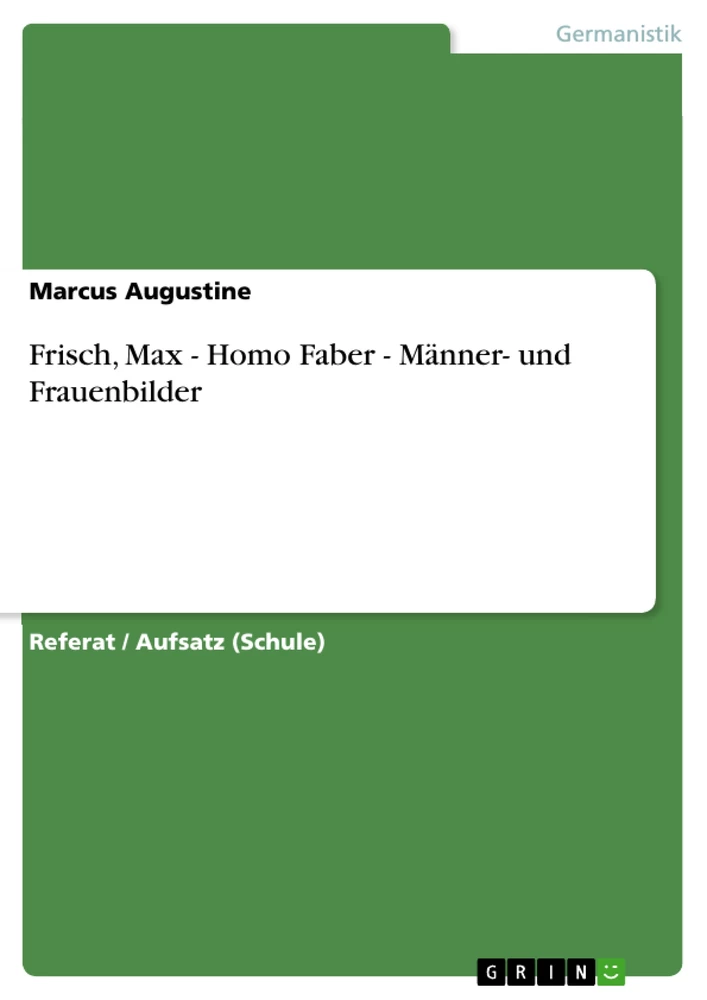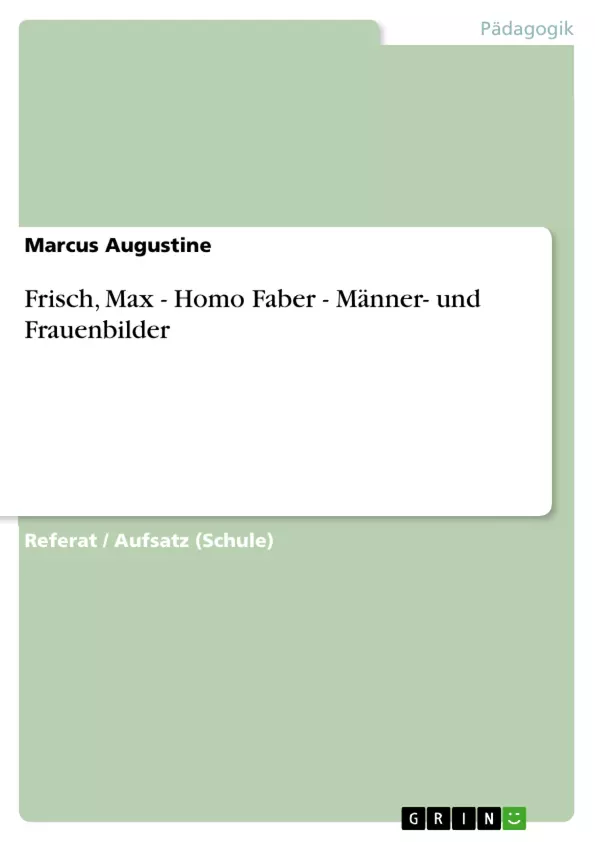Was, wenn Ihr Leben eine einzige, große Fehlkonstruktion wäre? Max Frischs "Homo Faber" katapultiert uns in die Welt von Walter Faber, einem Ingenieur, der die Welt in Berechenbarkeit und Effizienz sieht, ein Mann, für den Zufall nur eine Frage der Statistik ist. Doch hinter der Fassade des rationalen Technikers verbirgt sich eine erschreckende emotionale Leere, eine Unfähigkeit, wahre menschliche Beziehungen einzugehen. Seine Begegnungen, getrieben von Schicksalsschlägen und unerwarteten Wendungen, zwingen ihn, sein Weltbild zu hinterfragen. Eine Reise, die ihn von den pulsierenden Metropolen Amerikas bis zu den antiken Stätten Griechenlands führt, wird zur schonungslosen Selbstentdeckung. Faber, der Verfechter der modernen Technologie, muss erkennen, dass das Leben mehr ist als nur eine Formel, dass Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen nicht in Diagramme passen. Die Konfrontation mit seiner Vergangenheit, seinen verdrängten Emotionen und insbesondere mit der jungen Sabeth, reißt tiefe Wunden auf und zwingt ihn, sich der Wahrheit über sich selbst und seine Beziehungen zu stellen. In einer Zeit, in der die Technik allgegenwärtig ist, wirft Frischs Roman unbequeme Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Entfremdung des modernen Menschen und der Bedeutung von Liebe und Verlust auf. Eine packende Erzählung über Selbsttäuschung, Schuld und die Suche nach Menschlichkeit in einer zunehmend technisierten Welt, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt und nachhaltig zum Nachdenken anregt. "Homo Faber" ist mehr als nur ein Roman; es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, eine Mahnung, die menschlichen Werte nicht dem Fortschritt zu opfern und sich der komplexen Realität des Lebens zu öffnen, abseits von Algorithmen und Berechnungen. Ein zeitloser Klassiker der modernen Literatur, der die essentiellen Fragen der menschlichen Existenz berührt und den Leser mit einem tiefen Gefühl der Melancholie und Erkenntnis zurücklässt.
Die erste Buchausgabe des Romans „Homo faber“ von Max Frisch erschien am 30. September 1957 und somit fast zeitgleich zum Start des ersten Weltraumsatelliten - dem Sputnik. Technischer Fortschritt prägte damals das Bewusstsein vieler Menschen. So kann man den Roman als Auseinandersetzung mit der durch den Sputnik-Schock ausgelösten Zweiten Industriellen, der Technologischen Revolution verstehen. Der Romantitel und damit der „sprechende“ Name des Ingenieurs Walter Faber (lat. Faber = Handwerker) wird vom Autor selbst als Macher-Mensch erläutert. Der Macher und Techniker ist der Mensch, der die Natur verwertet: Wasserfälle als Elektrizität, Wälder als Bauholz, Gebirge als Ressourcenquellen. Die Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt spielt heutzutage eine umso wichtigere Rolle, weil wir wissen, dass Luft, Wasser und Energie nicht unbegrenzt vorhanden sind. Es kommt eher darauf an, die Natur zu bewahren als sie auszunutzen. Ein weiteres aktuelles Problem, das Frisch in Homo faber anspricht, betrifft den zwischenmenschlichen Bereich. Der Mensch des 20. Jahrhunderts lebt in einer Gesellschaft mit hochdifferenzierter Arbeitsteilung. Er ist im Arbeitsprozess selbst fremdbestimmt, seine Privatsphäre ist von deröffentlichkeit getrennt. Wertvorstellungen sind nicht mehr allgemein gültig, sondern je nach Gruppenzugehörigkeit verschieden. Der einzelne Mensch versucht, sich so zu verhalten, wie man es in unterschiedlichen Situationen von ihm erwartet. Für Frisch bedeutet dies, sich ein Bildnis, eine bestimmte Vorstellung, von einem Menschen zu machen und gewisse Ansprüche und Zumutungen an ihn zu richten. Das Verbot der Zehn Gebote, sich ein Bildnis von Gott zu schaffen, wendet Frisch auf den Menschen an. Für ihn ist es ein Zeichen der „Nicht-Liebe“, ein fertiges Bild von Mitmenschen zu besitzen. Dieser wird dadurch in eine Rolle hineingezwängt, die er zu spielen hat wodurch seine Persönlichkeit unterdrückt wird. Walter Faber will sich selbst als Techniker sehen und meint, dass auch seine Mitmenschen ihn als solchen wahrnehmen müssten. In der verinnerlichten Rolle als Techniker denkt er, das Leben sei planbar und so genannte Zufälle seien nur mithilfe der Statistik und Stochastik zu erklären. Des weiteren besitzt Faber ein sehr stark ausgeprägtes Bild gegenüber Männern und Frauen. Er lebt fast sein gesamtes Leben nach einem selbst- konstruierten Trugbild, was er jedoch als selbiges noch vor seinem Tod identifiziert und sich eingesteht, falsch geurteilt zu haben. Diese expliziten Männer- sowie Frauenbilder möchte ich im folgenden Teil näher behandeln und auf ihre Bedeutung im Roman hinweisen.
Walter Faber bezeichnet sich selbst als „Techniker und [ist somit] gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind“ (vgl. S.24). Er sieht die Dinge klar in einem rationalen Kontext und beurteilt oder erklärt selbige ohne Einfluss jeglicher Emotionen oder Gefühlseinflüsse, was beispielsweise an folgendem Textbeispiel deutlich wird: „Ich sehe den Mond (...) -] eine errechenbare Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis?“ (S.24); er begreift nicht, „was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis reden“ (S. 24). Faber betrachtet eine Sache nüchtern ohne eine Interpretation abzugeben oder einen Vergleich aus der Natur zu ziehen. Darüber hinaus hält er die „Wissenschaft für ein männliches Monopol (...), überhaupt den Geist“ (S.133). Diese arrogante und sehr sexistische Aussage lässt den Leser auf Fabers Attitüde gegenüber Frauen schließen, sowie dass Faber jegliche Form von Intelligenz dem männlichen Wesen zuschreibt. Die kühle gefühlslose Einstellung die Faber an den Tag legt kommt beispielsweise in Guatemala zur vollen Geltung: anstatt seine Trauer gegenüber eines verschiedenen Jugendfreundes auszudrücken, interessiert ihn vorerst nur, woher das im Hintergrund spielende Radio den nötigen Strom bezieht (S.55).
Im totalen Kontrast zu Walter Fabers Weltanschauung stehen Schicksal und Fügung. Faber selbst glaubt nicht daran, da er „als Techniker [gewohnt ist] mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen“ (S.22). Hierbei handelt es sich aber nur um die gewünschte Rolle, was sich gleich im Nachsatz zeigt: „Wieso Fügung? Ich gebe zu: Ohne die Notlandung in Tamaulipas (26.III.) wäre alles anders gekommen; ich hätte vielleicht nie wieder von Hanna gehört.“ (S.23). Er ist selbst nicht komplett von seiner Weltanschauung überzeugt und glaubt teilweise nicht mehr an Stochastik, möchte sich dies selbst aber nicht eingestehen und versucht daraufhin immer alles zu überspielen und sich trotz alledem zurück in die Mathematik zu retten. Ein roter Faden, der sich durch den Bericht zieht und auf selbigen sich Faber immer wieder beruft, um gewisse Dinge zu klären sind seine Statistiken; so versucht er beispielsweise, als seine Tochter von der Schlage gebissen wird, sich selbst und Hanna damit zu trösten, „dass die Mortalität bei Schlangenbiss nur drei bis zehn Prozent beträgt (...).“ (S.135). Er versucht sich selbst mit diesem plumpen technischen Trost über seine innere Pein hinwegzuhelfen und seine Schuldgefühle zu unterdrücken. Faber benutzt die Mathematik nur, um seinen Inneren Frieden zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen, als er beispielsweise Sabeths Geburtstag genau so ausrechnet, dass sie rein theoretisch nicht seine Tochter sein könnte (S. 121). Hanna kennt die Komplexe Walters und weißt ihn darauf hin, dass sie ihr Alter nicht aufheben können, indem sie weiter addieren , indem sie ihre eigenen Kinder heiraten. Der Techniker versucht ihrer Meinung nach ohne den Tod zu leben (S.170).
Nach Fabers Assistenzzeit in Zürich hat er die Möglichkeit einen gutbezahlten Job in Bagdad zu bekommen. Nun kommt ihm Hannas Schwangerschaft sehr ungelegen und er erpresst sie nahezu, das gemeinsame Kind abzutreiben. Hier wird deutlich, dass Faber als typischer Techniker „wie jeder wirkliche Mann in (...) [seiner] Arbeit [lebt]“ (S.90) und alles wortwörtlich für selbige aufgibt. Faber versucht äußere Geschehnisse und Bindungen einfach zu verdrängen indem er im Namen seiner Firma sehr viel auf der Welt umherreist. Er versucht durch diesen Atavismus die angestauten Probleme welche sein stereotypisches Weltbild aufwirft, zu kompensieren. Des weiteren denkt Faber, dass es ein Idealbild darstellt, wenn man nach dem „American Way of Life“ lebt. Diese Lebensart definiert sich für Faber aus Leistungsdruck sowie Erfolgsbestreben. Der einzige Weg, zu persönlichem Glück im Leben zu finden stellt der Erfolg und die Aufopferung für die Arbeit dar.
„Im Gegenteil, ich will es nicht anders und schätze mich glücklich, allein zu wohnen, meines Erachtens der einzigmögliche Zustand für Männer (...) es ist der einzigmögliche Zustand für mich“ (S.91f) . Aus diesem Zitat geht Fabers Verachtung gegenüber Mitmenschen hervor. Schon zu Beginn des Romans wimmelt er eine ihm unbeliebte Personen „unhöflich“ (S.8) ab : „[Ich hatte] meinerseits keinerlei Bedürfnis nach Bekanntschaft.“ (S.8). Er hält nichts von Smalltalk und sonstigen Unterredungen da sie ihm als unnötig anspruchsvoll und unnütz erscheinen. Als Faber sagt „Gefühle am Morgen, das erträgt kein Mann“ (S.91) oder „länger als drei Wochen habe ich es nie ertragen (...) nach drei Wochen (spätestens) sehne ich mich nach Turbinen;“ (S.91) wird deutlich, dass Faber mit anderen Leuten nichts anfangen kann und einen klassischen Einzelgänger darstellt - Er ‚erträgt’ es, den minimal nötigen Kontakt zu halten, jedoch kann und will er sich auf längerfristige Bindungen nicht einlassen und sucht daraufhin sofort Trost und Geborgenheit in der Technik.
Die nach den ‚Männergesetzen geordnete Gesellschaft’, wie es Simone de Beauvoirs definierte, welche Frischs Roman zum Teil maßgeblich beeinflusst hat, wird vom ‚überlegenen Mann’ regiert, der dadurch das ‚Subjekt’ darstellt. Walter Faber begreift sich selbst als „das“ Subjekt und leitet daraus den Anspruch ab, über andere bestimmen zu können. So verändert er beispielsweise bei der Bekanntschaft mit seiner Tochter Elisabeth ihren Namen, da ihm dieser missfällt (S. 74). Faber bezeichnet sich selbst als ‚Herrenmensch’ , was während des Guatemala-Aufenthalts deutlich wird, da er ständig die Inkas in einem sehr herablassenden Ton behandelt (S.38f). Da er die Frauen am Beispiel Hanna (S. 132) mit den Inkas vergleicht, die in seinen Augen ein „kindisches“ und „unterentwickeltes“ (S.38,S.10) Volk darstellt und für die er „technische Hilfe“ (S.10) leistet, nimmt er sich heraus zu denken, über den Frauen genauso zu stehen und richten zu können.
Etwas erleben empfindet W. Faber als „weibisch" (S.24). „Warum soll ich erleben was gar nicht ist ?“ (S.25). Hier wird Fabers Hang zur Rationalität sowie seiner Unfähigkeit zu erleben deutlich. Von der Kunst, die Faber „kitschig“ (S.107) findet, ist Sabeth vollkommen „begeistert“. Ihr Kunstbedürfnis drängt (S.107) sie alles anzuschauen, während Faber mit Museen nichts anfangen [kann]" (S.108). Da Hanna noch dazu als Archäologin in einem Museum arbeitet, wird das anvisierte Lebensziel bei Frauen von Faber mit Natur und Kunst gedeutet. Das träumerische in Fabers Augen realitätsferne Wesen der Frau wird ihm bei seiner Tochter bewusst, mit der er den letzten Tag vor ihrem Tod in Griechenland verbringt. Sabeth findet, dass „die weißen Hütten von Korinth“ aussehen, „wie wenn man eine Dose mit Würfelzucker ausgeleert hat“ (S.151) . Des Weiteren sucht sie einen Vergleich mit einer „schwarze[n] Zypresse“ - „Wie ein Ausrufezeichen!“ (S.151) . Faber, der mit diesem Vergleich (noch) überhaupt nichts anfangen kann meint, dass „Ausrufezeichen [ihre] Spitze (...) nicht oben haben“ (S. 151) und zeigt mit dieser abweisenden Aussage, dass er künstlerische Vergleiche einer Frau missachtet. Die Gleichgültigkeit der Frauen gegenüber dem Beruf steht in totalem Kontrast zu Fabers Berufauffassung. Sowohl seine New Yorker Freundin Ivy als auch seine Tochter und Geliebte Sabeth verlieren kein Wort über ihren Job, was auf Faber den Eindruck macht, dass sie sich nicht genügend um wichtige Dinge kümmern. Da Frauen seiner Meinung nach ihr Leben nicht in die Hand nehmen deutet er die Grundeinstellung der Frau als bedenklich und viel zu sehr glücksorientiert.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Max Frischs "Homo faber"?
Der Roman „Homo faber“ von Max Frisch setzt sich mit dem technischen Fortschritt, der Rolle des Menschen in einer modernen Gesellschaft und der Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen auseinander. Im Zentrum steht Walter Faber, ein Ingenieur, der versucht, die Welt rational und technisch zu erfassen, dabei aber wichtige Aspekte des Lebens wie Gefühle und Zufälle ausblendet.
Wie wird Walter Faber im Text beschrieben?
Walter Faber wird als Techniker dargestellt, der die Dinge klar und rational sieht. Er glaubt an die Wissenschaft und die Berechenbarkeit der Welt und betrachtet Emotionen und Erlebnisse als unwichtig. Er betrachtet die Welt nüchtern, ohne Interpretationen oder Vergleiche zur Natur.
Was sind die zentralen Gegensätze in Fabers Weltanschauung?
Im Gegensatz zu Fabers rationaler Weltanschauung stehen Schicksal und Fügung. Faber glaubt nicht an Zufälle, sondern an die Wahrscheinlichkeit. Jedoch wird im Laufe der Geschichte deutlich, dass er selbst nicht vollständig von seiner Weltanschauung überzeugt ist und sich immer wieder in die Mathematik flüchtet, um seinen inneren Frieden zu wahren.
Wie steht Faber zu Frauen?
Faber hat ein sexistisches Weltbild und sieht die Wissenschaft und den Geist als männliches Monopol. Er betrachtet Frauen oft als kindisch oder unterentwickelt und meint, über sie richten zu können. Er vergleicht sie teilweise mit den Inkas und glaubt, ihnen technische Hilfe leisten zu müssen.
Wie äußert sich Fabers Beziehung zu zwischenmenschlichen Beziehungen?
Faber ist ein Einzelgänger und verachtet Smalltalk und oberflächliche Unterhaltungen. Er kann und will sich nicht auf langfristige Bindungen einlassen und flüchtet sich stattdessen in die Technik. Er schätzt es, allein zu wohnen und betrachtet dies als den einzigmöglichen Zustand für Männer.
Wie wird Fabers Verhältnis zur Kunst und zum Erleben dargestellt?
Faber empfindet Erlebnisse als "weibisch" und kann mit Kunst nichts anfangen. Im Gegensatz dazu ist seine Tochter Sabeth von Kunst begeistert. Faber missachtet künstlerische Vergleiche und zeigt eine Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen der Frauen.
Welche Rolle spielt der "American Way of Life" für Faber?
Faber glaubt an den "American Way of Life", der sich für ihn aus Leistungsdruck und Erfolgsstreben definiert. Er sieht den Erfolg und die Aufopferung für die Arbeit als den einzigen Weg, persönliches Glück zu finden.
Welche Warnung soll der Roman „Homo faber“ aussprechen?
Der Roman soll eine Warnung vor der übermäßigen Rationalität und Technikverherrlichung sein. Faber ist eine Person, die von diesen Aspekten aufgefressen wurde und ihr Leben in einem Wahn gelebt hat. Der Roman mahnt, die Menschlichkeit, das Individuum und die Natur nicht zu vernachlässigen.
- Arbeit zitieren
- Marcus Augustine (Autor:in), 2001, Frisch, Max - Homo Faber - Männer- und Frauenbilder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100862