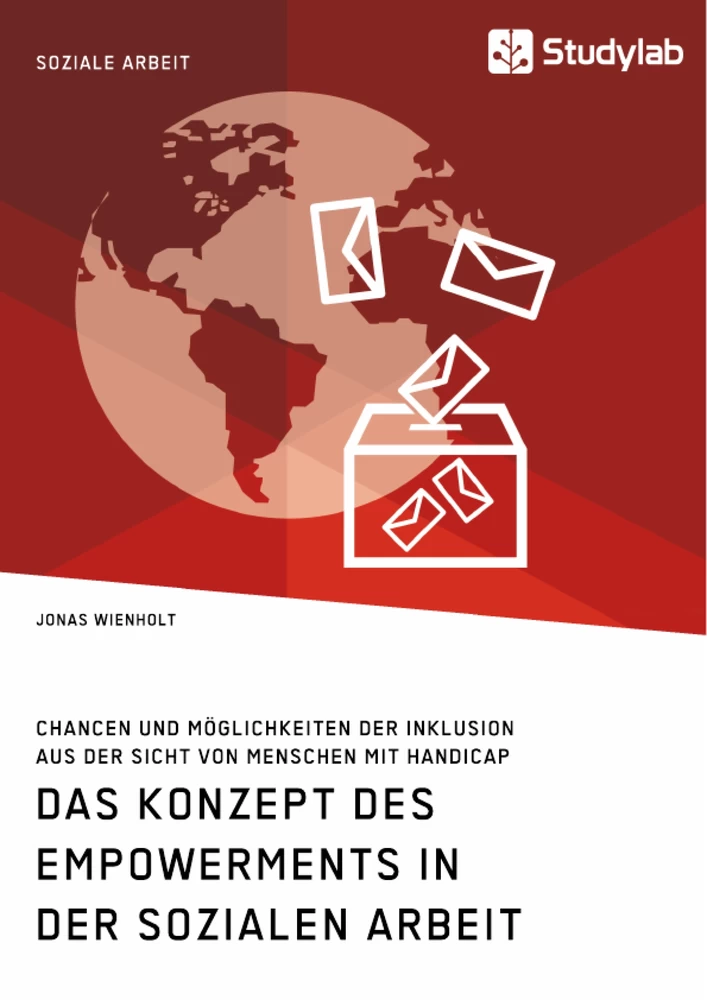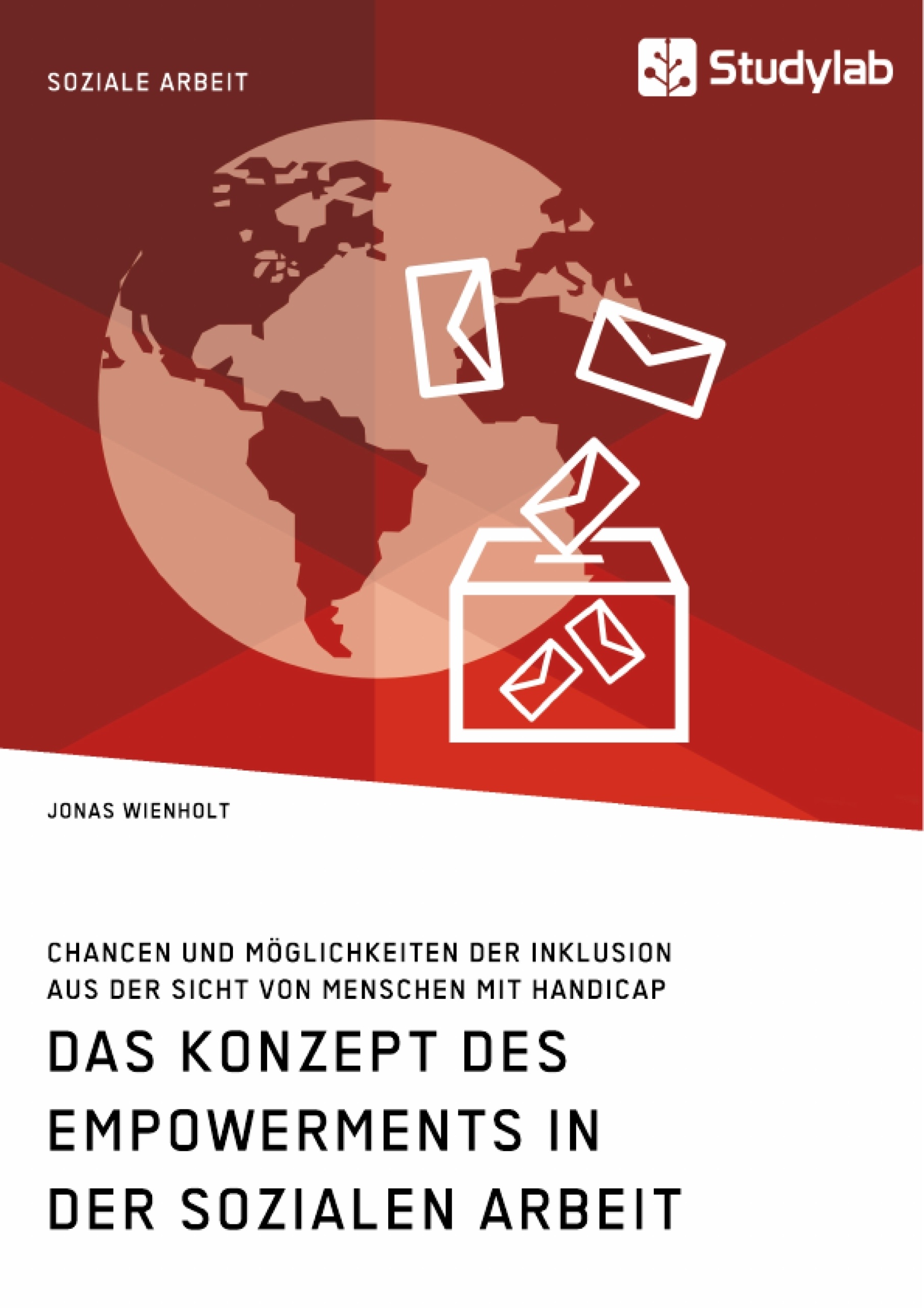Die Inklusion behinderter Menschen in die Gesellschaft spielt eine immer größere Rolle. Denn oft haben Menschen mit einem Handicap schon im Alltag mit Problemen zu kämpfen, die Außenstehenden nicht einmal in den Sinn kommen.
Doch welche Hilfestellungen gibt es für diese Menschen? Wie können Menschen mit Behinderung ihre vorhandenen Ressourcen zur Problemlösung im Alltag nutzen? Welche Inklusionschancen und Möglichkeiten bietet das Empowerment? Wie kann das Empowerment-Konzept in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden?
Diese und weitere Fragen beantwortet Jonas Wienholt in seinem Buch. Im Fokus stehen dabei die eigenen Möglichkeiten, um alltägliche Probleme ohne externe Hilfe lösen zu können, sowie das Konzept des Empowerments in der Sozialen Arbeit.
Aus dem Inhalt:
- Integration;
- Lebenshilfe;
- Barrierefrei;
- Behindertenarbeit;
- Ressourcenaktivierung
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Ziel der Arbeit
- Begründete Ein- und Ausgrenzung
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Geistiges Handicap
- Soziale Ungleichheit
- Theorien der sozialen Ungleichheit
- Empowerment-Ansatz
- Vier Konzepte der Selbstbestimmung nach Anne Waldschmidt
- Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan
- Ressourcen und die Wichtigkeit für den Empowerment-Prozess
- Copingprozess
- BEHINDERUNG ALS SOZIALE Ungleichheit?
- Das Recht von Menschen mit Handicap auf Inklusion
- Selbstbestimmung bei Menschen mit Handicap aus rechtlicher Perspektive
- Soziale Ungleichheit und Selbstbestimmung aus sozialarbeiterischer Perspektive
- Empowerment als Leitlinie der Sozialen Arbeit
- Ressourcenaktivierung und Ressourcendiagnostik
- Methoden der Ressourcendiagnostik aus sozialarbeiterischer Perspektive
- Strategien zur Aktivierung personaler Ressourcen
- Hindernisse und Widerstände der Umsetzung von Empowerment aus sozialarbeiterischer Perspektive
- Forschungsmethode
- Auswertung und Diskussion der Interviews subjektiv Betroffener
- Hypothesen
- Persönlich empfundene Stärken
- Stärken laut dem persönlichen Umfeld
- Lösung von Problemen
- Netzwerke der Betroffenen
- Wünsche und Träume
- Diskussion der Ergebnisse
- Ergebnisse im Zusammenhang mit den Hypothesen
- Kritische Reflexion des Forschungsprozesses
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Empowerments in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der Inklusion von Menschen mit Handicap. Ziel ist es, die Chancen und Möglichkeiten von Empowerment für Menschen mit Handicap zu beleuchten und die Bedeutung der Ressourcenaktivierung in diesem Prozess zu analysieren.
- Das Konzept des Empowerments in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Ressourcenaktivierung für Menschen mit Handicap
- Die Rolle der Selbstbestimmung in der Inklusion von Menschen mit Handicap
- Herausforderungen und Hindernisse bei der Umsetzung von Empowerment in der Praxis
- Die Bedeutung von Inklusion und Partizipation in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle gesellschaftliche Situation von Menschen mit Handicap beleuchtet und die Relevanz von Inklusion, Empowerment und Partizipation hervorhebt. Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit vor, u.a. die Konzepte von geistigem Handicap, sozialer Ungleichheit, Empowerment und Selbstbestimmung. Das dritte Kapitel untersucht das Thema Behinderung als soziale Ungleichheit aus verschiedenen Perspektiven, u.a. rechtlich und sozialarbeiterisch. Hierbei werden auch Ressourcenaktivierung, Methoden der Ressourcendiagnostik und Strategien zur Aktivierung personaler Ressourcen behandelt. Kapitel 4 erläutert die Forschungsmethode, die in dieser Arbeit verwendet wird. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Interviews mit subjektiv betroffenen Menschen mit Handicap analysiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe der Behindertenarbeit, wie Inklusion, Empowerment, Selbstbestimmung, Ressourcenaktivierung, soziale Ungleichheit und Handicap. Die Kernthemen sind die Chancen und Möglichkeiten von Empowerment für Menschen mit Handicap, die Bedeutung von Ressourcenaktivierung für deren Inklusion und die Herausforderungen und Hindernisse bei der Umsetzung von Empowerment in der Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Empowerment zielt darauf ab, Menschen mit Handicap zu befähigen, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen, um alltägliche Probleme selbstständig und ohne externe Hilfe zu lösen.
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
Inklusion bedeutet, dass die Gesellschaft sich so anpasst, dass jeder von vornherein dazugehört, während Integration oft die Eingliederung einer Person in ein bestehendes System meint.
Warum ist Ressourcendiagnostik wichtig?
Sie hilft dabei, die individuellen Stärken und Fähigkeiten (personale Ressourcen) eines Menschen zu erkennen, anstatt nur auf seine Defizite zu schauen.
Welche Hindernisse gibt es bei der Umsetzung von Empowerment?
Hindernisse können starre bürokratische Strukturen, Vorurteile in der Gesellschaft oder mangelnde personelle Ressourcen in der Sozialarbeit sein.
Was besagt die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan?
Sie untersucht die Motivation hinter menschlichem Handeln und betont die Bedeutung von Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit.
- Quote paper
- Jonas Wienholt (Author), 2021, Das Konzept des Empowerments in der Sozialen Arbeit. Chancen und Möglichkeiten der Inklusion aus der Sicht von Menschen mit Handicap, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1008662