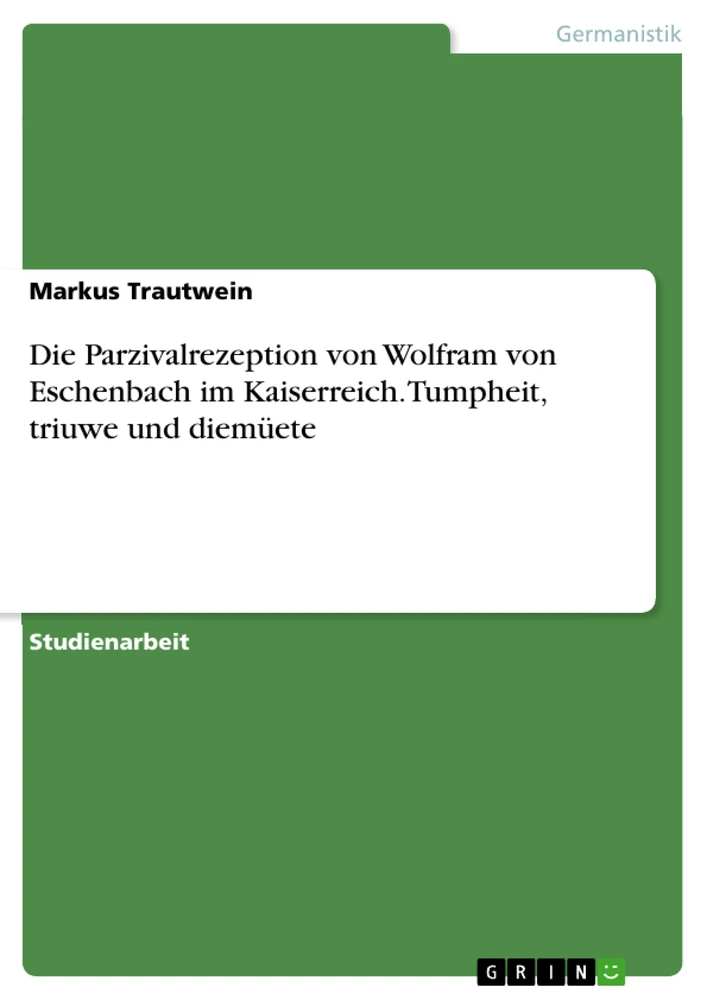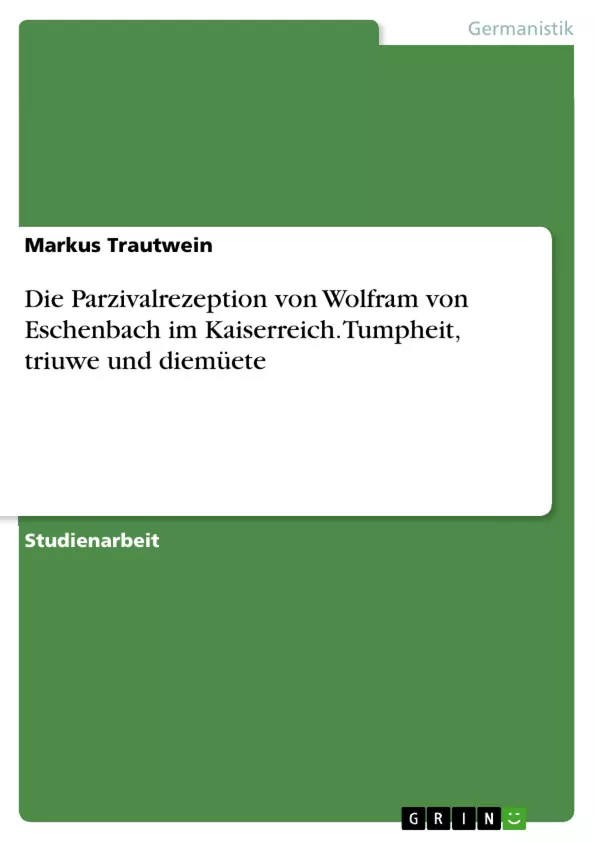Diese Arbeit untersucht die Rezeption des Parzival von Wolfram von Eschenbach im deutschen Kaiserreich (1871-1918). Dabei werden zunächst drei zentrale Begriffe des mittelhochdeutschen Originalwerks auf ihre semantische und charakterbildende Eigenschaften hin untersucht.
Im Anschluss wird anhand dieser Begriffe aufgezeigt, dass die Rezeption und Interpretation des Parzival im Kaiserreich sehr unterschiedlich ausfiel. Dabei wird deutlich, dass verschiedene Autoren um 1900 ganz andere Schwerpunkte bei ihren Parzivalvarianten setzten, als es Wolfram von Eschenbach seinerzeit tat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Parzivals Charakterzüge und ihre Bedeutung für seine Entwicklung
- tumpheit
- triuwe
- diemüete
- Verklärung, Verstärkung und Unterschlagung der Charakterzüge Parzivals im deutschen Kaiserreich
- Prott (1875), Wagner (1877/82), Hauptmann (1914)
- Die Rezeption am Beispiel von Will Vespers Parzivalroman (1911)
- Schlussbetrachtung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Modularbeit befasst sich mit der Figur Parzival im Parzivalroman von Wolfram von Eschenbach und ihrer Rezeption im deutschen Kaiserreich. Sie untersucht, wie die Charakterzüge des mittelalterlichen Helden, insbesondere tumpheit, triuwe und diemüete, von neuzeitlichen Autoren und Interpreten aufgegriffen und umgestaltet wurden. Dabei wird exemplarisch anhand einzelner Textpassagen von Will Vespers Parzivalroman (1911) gezeigt, wie die Rezeption von Parzival im Kaiserreich den mittelalterlichen Charakter des Helden neu interpretierte.
- Die Bedeutung von tumpheit, triuwe und diemüete für Parzivals Entwicklung im Parzivalroman
- Die Umdeutung von Parzivals Charakterzügen in der Rezeption im deutschen Kaiserreich
- Die Verwendung von Parzival als Symbolfigur im Kaiserreich
- Die Verklärung und Verstärkung der Charakterzüge im Vergleich zum Originaltext
- Die Rolle von Parzival als Gotteskrieger in der Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rezeption von Parzivals Charakterzügen im deutschen Kaiserreich und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel analysiert die Bedeutung der Charakterzüge tumpheit, triuwe und diemüete für Parzivals Entwicklung im Parzivalroman. Es wird gezeigt, dass tumpheit im mittelalterlichen Kontext nicht nur als Dummheit oder Unfähigkeit, sondern auch als jugendliche Unerfahrenheit und als notwendige Voraussetzung für Parzivals spirituellen Wachstum verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Parzival, Wolfram von Eschenbach, mittelalterliche Literatur, Rezeption, deutsches Kaiserreich, tumpheit, triuwe, diemüete, Gotteskrieger, Will Vesper, Symbolfigur, Verklärung, Verstärkung, Unterschlagung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Parzivalrezeption im Kaiserreich?
Die Arbeit untersucht, wie Wolframs mittelalterlicher Held Parzival zwischen 1871 und 1918 neu interpretiert und als Symbolfigur für nationale Ideale genutzt wurde.
Was bedeuten 'tumpheit', 'triuwe' und 'diemüete'?
Es sind zentrale Begriffe aus dem Originalwerk: tumpheit (Unerfahrenheit), triuwe (Treue/Loyalität) und diemüete (Demut).
Wie veränderte Will Vesper die Figur des Parzival?
In Vespers Roman (1911) wurde Parzival oft verklärt und als eine Art "Gotteskrieger" oder nationales Vorbild dargestellt, was vom mittelalterlichen Original abwich.
Welchen Einfluss hatte Richard Wagner auf die Rezeption?
Wagner prägte durch seine Oper "Parsifal" das Bild des Helden im Kaiserreich maßgeblich und beeinflusste viele literarische Interpretationen der Zeit.
Warum wurde Parzival als 'Symbolfigur' genutzt?
Die Figur eignete sich zur Projektion von Tugenden wie Kampfgeist und christlicher Demut, die im gesellschaftlichen Diskurs des Kaiserreichs zentral waren.
- Arbeit zitieren
- Markus Trautwein (Autor:in), 2014, Die Parzivalrezeption von Wolfram von Eschenbach im Kaiserreich. Tumpheit, triuwe und diemüete, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1009413