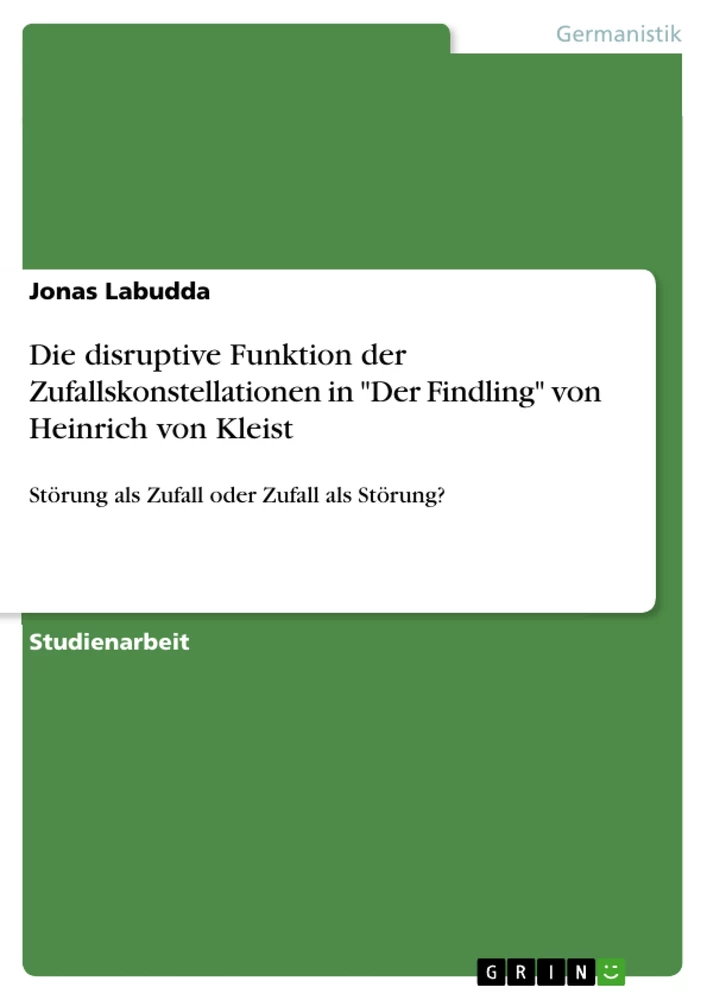Aus der Varietät der Störungen in der deutschen Literatur sticht vor allem ein Autor heraus, der gerade in seinen Erzählungen wie kein anderer das Prinzip des Störens in der Literatur für sich zu nutzen weiß: Heinrich von Kleist. In "Der Findling" entfalten sich diese Potentiale nahezu ungehindert.
Um das Störpotential der Zufälle im Findling näher zu erschließen, wird zuerst eine genaue Analyse der Struktur, Konsistenz und Wirkung der wiederkehrenden und sich einem stringenten, teleologischen Handlungsverlauf widerstrebenden Zufälle vorgenommen. Mithilfe einer genauen Definition des Störungsbegriffes sollen diese Zufälle dann genauer auf ihr kollektives Störungspotential untersucht werden.
Spätestens durch die Corona Pandemie ist das Phänomen „Störung“ wieder allgegenwärtig und beweist im größtmöglichen Maßstab, welche Auswirkungen Störungen auf allen Ebenen der Gesellschaft haben können. Auch im deutschen Literaturkanon sind allerlei Störungen ausfindig zu machen. Der Störungsbegriff an sich ist dabei nur schwer zu definieren, da das Aussehen von Störungen, ihre Wirkungsweise und ihr Einfluss auf verschiedenste Instanzen wie Handlung und „discours“ vor allem auf der Ebene der Rezeption variabel sind. Störungen können nicht nur einen zu untersuchenden Text entscheidend beeinflussen, sie können auch bei unterschiedlichen Lesern verschiedene Störungspotentiale entfalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zufälle im Findling
- Vorgefallene Zufälle
- Störende Zufälle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Funktion von Zufällen in Heinrich von Kleists Erzählung „Der Findling“. Sie analysiert, inwiefern Zufallskonstellationen in der Erzählung als Störung fungieren und welche Auswirkungen dies auf die Handlung und die Figuren hat.
- Die Bedeutung von Zufällen für die Struktur und den Handlungsverlauf in „Der Findling“
- Die verschiedenen Arten von Zufällen in der Erzählung und ihre spezifischen Auswirkungen
- Das Störpotential von Zufällen und ihre Rolle bei der Infragestellung von Handlungsmustern und konventionellen Erwartungen
- Die Ambivalenz der Störung: Zerstörerische oder konstruktive Funktion von Zufällen?
- Die Verbindung von Zufall und Störung in Kleists Werk im Kontext der Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Störung in der Literatur ein und stellt Kleists besondere Rolle in diesem Kontext heraus. Sie erläutert die Vielfältigkeit von Störphänomenen in der Literatur und hebt die Notwendigkeit ihrer genauen Analyse hervor.
- Zufälle im Findling: Dieses Kapitel untersucht die hohe Frequenz von Zufällen in Kleists „Der Findling“ und stellt fest, dass diese nicht nur für die Handlung von Bedeutung sind, sondern auch als wesentlicher Bestandteil der erzählerischen Struktur fungieren.
- Vorgefallene Zufälle: Hier werden die klar definierten und durch die Handlung explizit hervorgehobenen Zufälle in „Der Findling“ analysiert. Die Kapitel analysiert ihre Funktion für die Entwicklung der Erzählung und untersucht, inwiefern diese Zufälle als Ausgangspunkt für Störungen dienen können.
- Störende Zufälle: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Störpotential der in „Der Findling“ dargestellten Zufälle. Es untersucht, inwiefern diese Zufälle konventionelle Handlungsmuster und Erwartungen untergraben und die Figuren vor unvorhergesehene Herausforderungen stellen.
Schlüsselwörter
Zufall, Störung, Handlungsverlauf, Kleist, „Der Findling“, Erzählstruktur, Störpotential, Motiv, Analyse, Interpretation, Zufallskonstellation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Zufälle in Kleists 'Der Findling'?
Zufälle fungieren in der Erzählung als "Störungen", die den geplanten Handlungsverlauf unterbrechen und konventionelle Erwartungen der Figuren und Leser infrage stellen.
Was bedeutet 'disruptive Funktion' in diesem Kontext?
Es beschreibt, wie Zufallskonstellationen bestehende Ordnungen zerstören und die Figuren vor unvorhersehbare, oft katastrophale Herausforderungen stellen.
Wie hängen Zufall und Störung zusammen?
Zufälle widerstreben einem logischen, teleologischen Handlungsverlauf. Sie entfalten ein kollektives Störungspotenzial, das die Zerbrechlichkeit menschlicher Planungen aufzeigt.
Warum ist Kleist für das Thema 'Störung' besonders relevant?
Kleist nutzt das Prinzip des Störens wie kaum ein anderer Autor des deutschen Kanons, um die Unsicherheit der Welt und die Ohnmacht des Verstandes zu thematisieren.
Welchen Einfluss hat die Rezeption auf den Störungsbegriff?
Störungen sind variabel und hängen vom Leser ab. Was für einen Leser eine Störung der Handlung darstellt, kann für einen anderen ein wesentliches ästhetisches Merkmal des Diskurses sein.
- Quote paper
- Jonas Labudda (Author), 2020, Die disruptive Funktion der Zufallskonstellationen in "Der Findling" von Heinrich von Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1009534