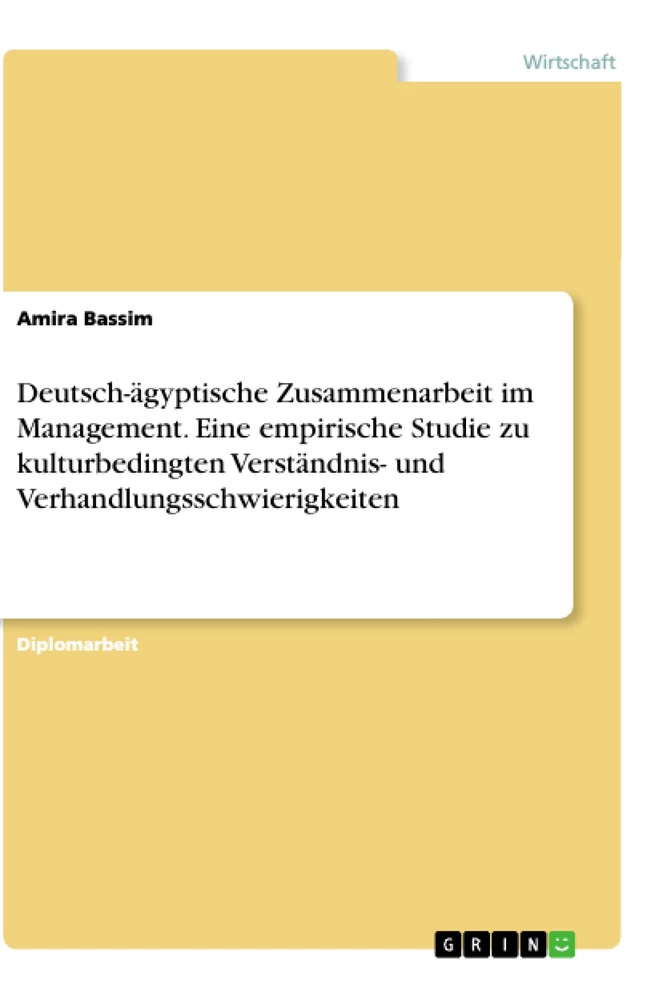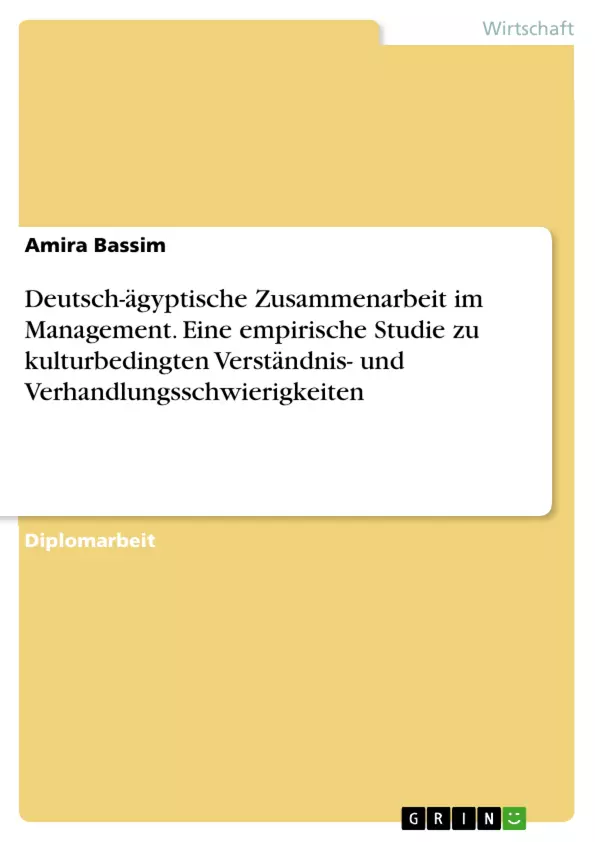Ziel dieser Arbeit ist es, kulturbedingte Hindernisse in der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit auf der oberen Managementebene zu lokalisieren, kulturelle Unterschiede und Abweichungen der Wertesysteme, welche eine erfolgreiche Zusammenarbeit erschweren oder verhindern, aufzudecken und deren Hintergründe zu erklären, sowie Vorschläge zur Verbesserung der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit hervorzubringen. Die Arbeit soll als praktisch anwendbarer Leitfaden für deutsche Geschäftsleute dienen und ihnen helfen, die kulturbedingten Besonderheiten im Verhalten und Denken der ägyptischen Partner zu verstehen.
Wenn Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft miteinander verhandeln oder zusammenarbeiten sollen, gehören Verständnisschwierigkeiten zur Tagesordnung, weil ihre Arbeitsstile, Wertvorstellungen und Kommunikationsregeln sowie Denk- und Verhaltensweisen kulturspezifisch sind. Diese unsichtbaren kulturellen Grenzen können zu Missverständnissen, Konflikten und Fehlschlägen führen, welche eine effiziente Zusammenarbeit verhindern. Aus alltäglichen Handlungen, die zwischen Angehörigen des gleichen Kulturkreises zur unbewussten Routine geworden sind, entstehen in interkulturellen Interaktionen völlig unerwartete Probleme und Konfliktsituationen.
Jedes Unternehmen, das auf ausländischem Boden geschäftlich tätig ist bzw. werden will, muss sich mit vielfältigen und unbekannten Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Wer auf ausländischen Märkten erfolgreich sein will, muss seinen Markt kennen. Neben dem Wissen um rechtliche, wirtschaftliche und politische Bedingungen des Landes gilt es, die reichlich vorhandenen Stolpersteine auf den Kommunikations- und Handelswegen einer anderen Kultur geschickt zu umgehen. Fremde Mentalitäten, Sitten und Gebräuche schaffen andere Gesetzmäßigkeiten, die zunächst "übersetzt" werden müssen.
Für internationale Unternehmen ist Ägypten einer der interessantesten und zukunftsträchtigsten Märkte des Nahen Ostens und der arabischen Welt. Mit einer Bevölkerung von rund 65 Millionen Einwohnern, relativ stabilen politischen Rahmenbedingungen und mit einer Politik der marktwirtschaftlichen Erneuerung, bietet das aufstrebende Land am Nil allgemein günstige Perspektiven für ausländische Engagements.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Kulturvergleichende Studien
- 2.1.1 Die fünf Kulturdimensionen nach Hofstede
- 2.1.2 Theorien von Edward T. Hall
- 2.1.2.1 „High-context“- vs. „Low-context“- Kulturen
- 2.1.2.2 Polychrone vs. monochrone Kulturen
- 2.1.3 Aufgabenorientierte vs. beziehungsorientierte Kulturen nach Gesteland
- 2.2 Internationales Management in unterschiedlichen Kulturkreisen
- 2.2.1 Berücksichtigung des fremden Umfeldes
- 2.2.2 Interkulturelle Verhandlungen
- 2.2.2.1 Der Einfluss der Kultur auf Verhandlungen
- 2.2.2.2 Die Bedeutung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit
- 2.2.3 Qualifikationserfordernisse eines Auslandsmanagers
- 2.3 Länderprofil Ägypten
- 2.3.1 Wirtschaftslage
- 2.3.2 Politik
- 2.3.3 Bildung
- 2.3.4 Religion
- 2.3.5 Medienfreiheit
- 2.3.6 Familienstruktur
- 2.3.7 Bilaterale Beziehungen zwischen Ägypten und Deutschland
- 3. Untersuchungsmodell zur interkulturellen Interaktion
- 3.1 Modellkomponenten
- 3.2 Modellzusammenführung
- 3.3 Modelldurchführung
- 4. Empirische Studie
- 4.1 Überblick
- 4.2 Grundgesamtheit
- 4.3 Empirische Befunde zu kulturbedingten Verständnis- und Verhandlungsschwierigkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die kulturbedingten Verständnisschwierigkeiten und Verhandlungsprobleme in der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit im Management. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das diese Herausforderungen erklärt und Lösungsansätze aufzeigt.
- Kulturvergleichende Ansätze im internationalen Management
- Analyse kulturbedingter Stereotype zwischen Deutschen und Ägyptern
- Untersuchung arbeitsbezogener Wertvorstellungen in beiden Kulturen
- Bewertung des Einflusses kultureller Werte auf die Zusammenarbeit
- Entwicklung eines Modells zur Erklärung interkultureller Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit im Management ein und beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit. Es hebt die Bedeutung des interkulturellen Verständnisses im internationalen Kontext hervor und skizziert den Forschungsansatz der Studie.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es behandelt kulturvergleichende Studien, insbesondere die fünf Kulturdimensionen nach Hofstede und die Theorien von Edward T. Hall (High-context vs. Low-context Kulturen, polychrone vs. monochrone Kulturen). Weiterhin werden Aufgaben- und beziehungsorientierte Kulturen nach Gesteland betrachtet, und das Kapitel analysiert den Einfluss der Kultur auf internationales Management, insbesondere interkulturelle Verhandlungen, sowie das Länderprofil Ägyptens, inklusive seiner Wirtschaftslage, Politik, Bildung, Religion, Medienfreiheit und Familienstruktur.
3. Untersuchungsmodell zur interkulturellen Interaktion: In diesem Kapitel wird ein Untersuchungsmodell zur Analyse der interkulturellen Interaktion zwischen deutschen und ägyptischen Managern vorgestellt. Das Modell beinhaltet Komponenten wie Stereotype, arbeitsbezogene Wertvorstellungen und kulturbedingte Wertvorstellungen. Es werden Hypothesen formuliert, die im empirischen Teil der Arbeit getestet werden. Die einzelnen Modellkomponenten und deren Zusammenhänge werden detailliert beschrieben.
4. Empirische Studie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie. Es beschreibt die Methodik der Datenerhebung und -auswertung und analysiert die empirischen Befunde zu kulturbedingten Verständnis- und Verhandlungsschwierigkeiten, in Bezug auf Stereotype, arbeitsbezogene Wertvorstellungen und kulturbedingte Wertvorstellungen. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und im Hinblick auf die im vorherigen Kapitel formulierten Hypothesen interpretiert.
Schlüsselwörter
Deutsch-ägyptische Zusammenarbeit, interkulturelles Management, Kulturvergleich, Hofstede, Hall, Stereotype, Wertvorstellungen, Verhandlungen, Empirische Studie, Modell, Interkulturelle Kommunikation, Ägypten, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Deutsch-Ägyptische Zusammenarbeit im Management
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht kulturbedingte Verständnisschwierigkeiten und Verhandlungsprobleme in der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit im Management. Ziel ist die Entwicklung eines Modells zur Erklärung dieser Herausforderungen und zur Aufzeigen von Lösungsansätzen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf kulturvergleichende Studien, insbesondere die fünf Kulturdimensionen nach Hofstede und die Theorien von Edward T. Hall (High-context vs. Low-context Kulturen, polychrone vs. monochrone Kulturen). Zusätzlich werden Aufgaben- und beziehungsorientierte Kulturen nach Gesteland betrachtet. Es wird der Einfluss der Kultur auf internationales Management, insbesondere interkulturelle Verhandlungen, analysiert. Ein Länderprofil Ägyptens (Wirtschaftslage, Politik, Bildung, Religion, Medienfreiheit, Familienstruktur und bilaterale Beziehungen zu Deutschland) wird ebenfalls erstellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) stellt die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise vor. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 (Untersuchungsmodell) präsentiert ein Modell zur Analyse interkultureller Interaktion zwischen deutschen und ägyptischen Managern. Kapitel 4 (Empirische Studie) präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie, einschließlich Methodik, Datenauswertung und Interpretation der Befunde im Hinblick auf die formulierten Hypothesen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt kulturvergleichende Ansätze im internationalen Management, die Analyse kulturbedingter Stereotype zwischen Deutschen und Ägyptern, die Untersuchung arbeitsbezogener Wertvorstellungen in beiden Kulturen, die Bewertung des Einflusses kultureller Werte auf die Zusammenarbeit und die Entwicklung eines Modells zur Erklärung interkultureller Interaktion.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Studie, deren Methodik im Kapitel 4 detailliert beschrieben wird. Es werden Daten erhoben und ausgewertet, um die kulturbedingten Verständnis- und Verhandlungsschwierigkeiten zu analysieren, bezogen auf Stereotype, arbeitsbezogene und kulturbedingte Wertvorstellungen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Studie?
Die Ergebnisse der empirischen Studie werden im Kapitel 4 präsentiert und im Hinblick auf die im Kapitel 3 formulierten Hypothesen interpretiert. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation finden sich in der vollständigen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Deutsch-ägyptische Zusammenarbeit, interkulturelles Management, Kulturvergleich, Hofstede, Hall, Stereotype, Wertvorstellungen, Verhandlungen, Empirische Studie, Modell, Interkulturelle Kommunikation, Ägypten, Deutschland.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Modells, das kulturbedingte Verständnisschwierigkeiten und Verhandlungsprobleme in der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit im Management erklärt und Lösungsansätze aufzeigt.
- Arbeit zitieren
- Amira Bassim (Autor:in), 2002, Deutsch-ägyptische Zusammenarbeit im Management. Eine empirische Studie zu kulturbedingten Verständnis- und Verhandlungsschwierigkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1009731