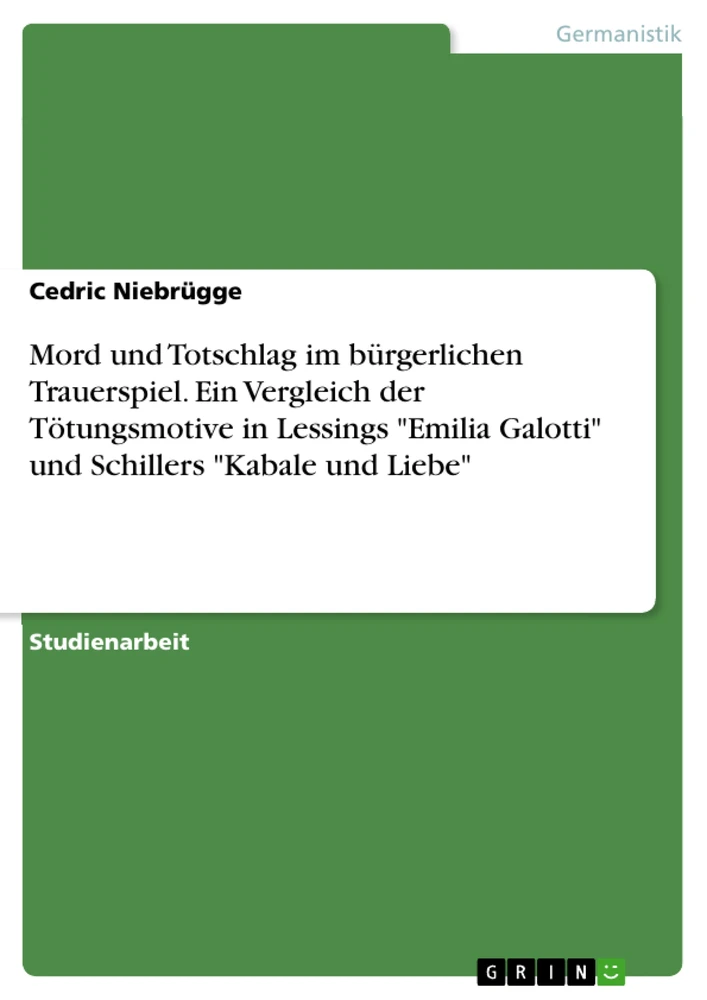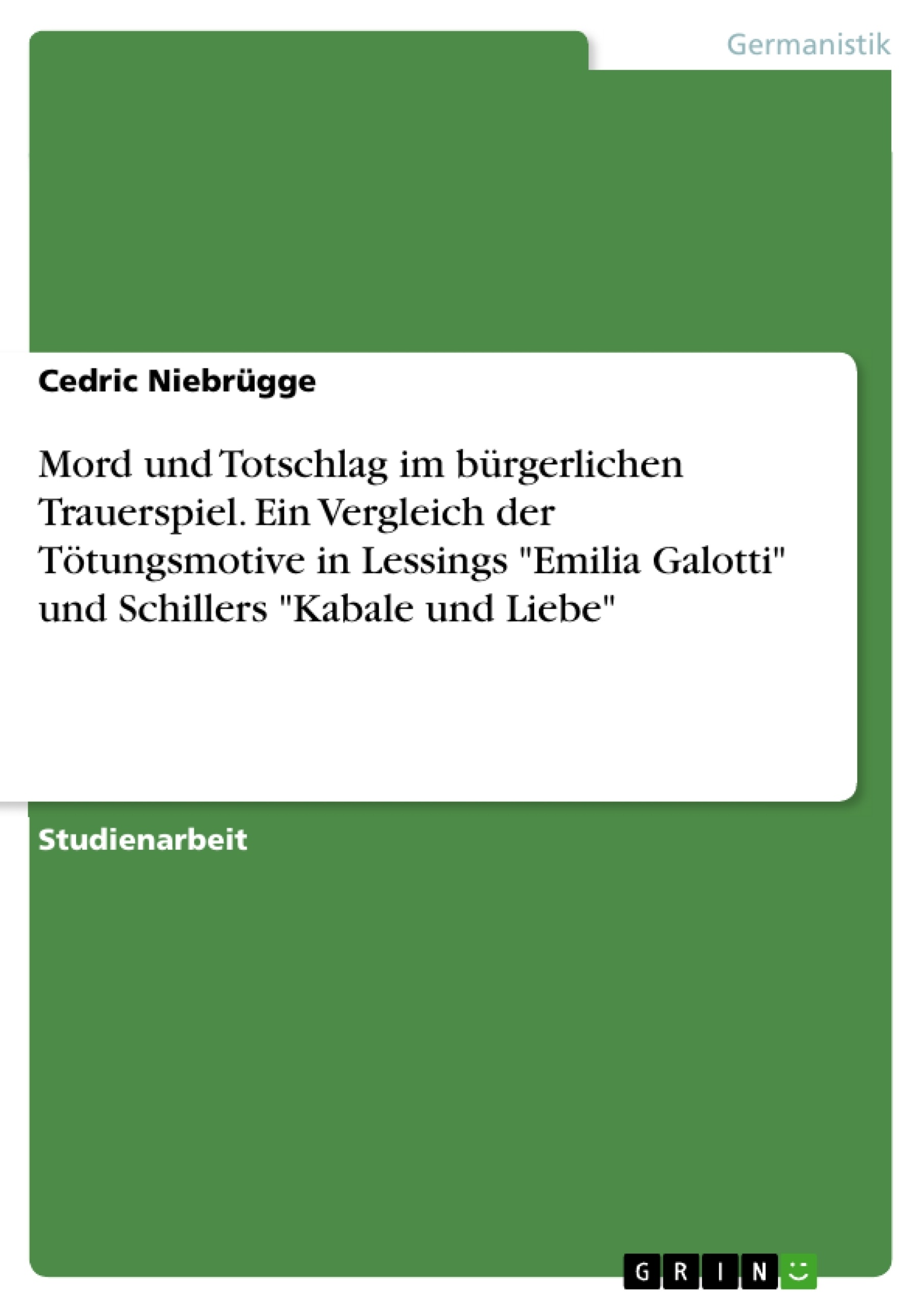In dieser Hausarbeit wird das Tötungsmotiv der beiden Täter Odoardo Galotti und Ferdinand von Walter mit Blick auf ihre Ermordung gegenübergestellt und verglichen. Hierbei steht besonders der innere Antrieb des Täters und das Bedürfnis, das Opfer zu töten, im Vordergrund. Das Tötungsmotiv hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Ausgang der Dramen. Desgleichen behandelt der weitere Text die Frage, ob es sich bei der jeweiligen Tat um einen "Mord" oder ein "Totschlag" handelt. Diese Ausarbeitung setzt sich mit der These auseinander, dass die Unterdrückung des männlichen Täters durch die Ständegesellschaft dazu führt, dass dieser die weibliche Protagonistin am Ende der bürgerlichen Trauerspiele umbringt. Guthke behauptet in seinem Buch über das bürgerliche Trauerspiel, dass in erster Linie die Aristokratie in den Dramen kritisiert werde und in zweiter Linie das Bürgertum, da die "konventionelle Starrheit" und die "passive Hinnahme der Misslichkeiten der ständischen Ordnung" zur Unterdrückung des Bürgertums durch die Aristokratie hingeführt werde.
Mit einer kurzen Einführung in das Genre des bürgerlichen Trauerspiels beginnt der Hauptteil der Hausarbeit. Dieser beinhaltet sowohl die Entstehung des deutschsprachigen bürgerlichen Trauerspiels im ausgehenden 18. Jahrhundert als auch zwei beispielhafte Aufsätze und Theorien dieser Gattung. Hierbei wird besonders auf die Aufklärungsgesellschaft und die Funktion des Theaters in der Zeit der Aufklärung eingegangen, um so die anschließenden Ideen Lessings und Schillers zum bürgerlichen Trauerspiel zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das bürgerliche Trauerspiel
- Die Entstehung des deutschsprachigen bürgerlichen Trauerspiels im ausgehenden 18. Jahrhundert
- Theorie des bürgerlichen Trauerspiels
- Die Ermordung in den bürgerlichen Trauerspielen
- Der Mord von Emilia Galotti - Totschlag statt Mord?
- Der Mord in Kabale und Liebe - Mord statt Totschlag?
- Die Tötungsmotive im Vergleich
- Gemeinsamkeiten der Tötungsmotive
- Unterschiede der Tötungsmotive
- Fazit: Mord und Todschlag im bürgerlichen Trauerspiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Tötungsmotiv der Täter Odoardo Galotti und Ferdinand von Walter in Lessings "Emilia Galotti" und Schillers "Kabale und Liebe". Dabei werden die inneren Antriebe der Täter und die Hintergründe ihrer Handlungen analysiert. Des Weiteren wird die Frage aufgeworfen, ob es sich bei den Taten um Mord oder Totschlag handelt.
- Analyse der Tötungsmotive in den beiden Dramen
- Vergleich der inneren Antriebe der Täter
- Untersuchung der Frage, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt
- Einordnung der Dramen in den Kontext der Aufklärungsgesellschaft
- Kritik der Ständegesellschaft in den Werken Lessings und Schillers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik Mord und Totschlag in der Literatur ein und stellt die beiden Dramen "Emilia Galotti" und "Kabale und Liebe" in den Kontext. Anschließend wird das Genre des bürgerlichen Trauerspiels mit seinen Ursprüngen im ausgehenden 18. Jahrhundert und den relevanten Theorien vorgestellt. Im Folgenden werden die Tötungsmotive in den beiden Dramen analysiert und verglichen, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Handlungen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Mord, Totschlag, Tötungsmotiv, Ständegesellschaft, Aufklärung, Lessing, Schiller, "Emilia Galotti", "Kabale und Liebe", moralisches Theater.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Tötungsmotiv in 'Emilia Galotti' und 'Kabale und Liebe'?
Die Arbeit untersucht den inneren Antrieb der Täter Odoardo Galotti und Ferdinand von Walter, wobei die Unterdrückung durch die Ständegesellschaft als Hauptursache analysiert wird.
Handelt es sich bei Odoardos Tat um Mord oder Totschlag?
Die Hausarbeit setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob die Tötung Emilias durch ihren Vater eher als verzweifelter Totschlag oder als geplanter Mord zu werten ist.
Wie unterscheidet sich Ferdinands Motiv in 'Kabale und Liebe'?
Im Gegensatz zu Odoardo handelt Ferdinand aus einer Mischung aus verletzter Ehre, Eifersucht und dem Unvermögen, die ständischen Schranken zu überwinden.
Welche Rolle spielt die Aristokratie in diesen bürgerlichen Trauerspielen?
Die Dramen kritisieren die Willkür der Aristokratie, zeigen aber auch die "konventionelle Starrheit" des Bürgertums auf, die zur Katastrophe führt.
Was war die Funktion des Theaters zur Zeit der Aufklärung?
Das Theater diente als "moralische Anstalt", um bürgerliche Werte zu vermitteln und die Missstände der ständischen Ordnung öffentlich zu reflektieren.
- Quote paper
- Cedric Niebrügge (Author), 2021, Mord und Totschlag im bürgerlichen Trauerspiel. Ein Vergleich der Tötungsmotive in Lessings "Emilia Galotti" und Schillers "Kabale und Liebe", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1009737