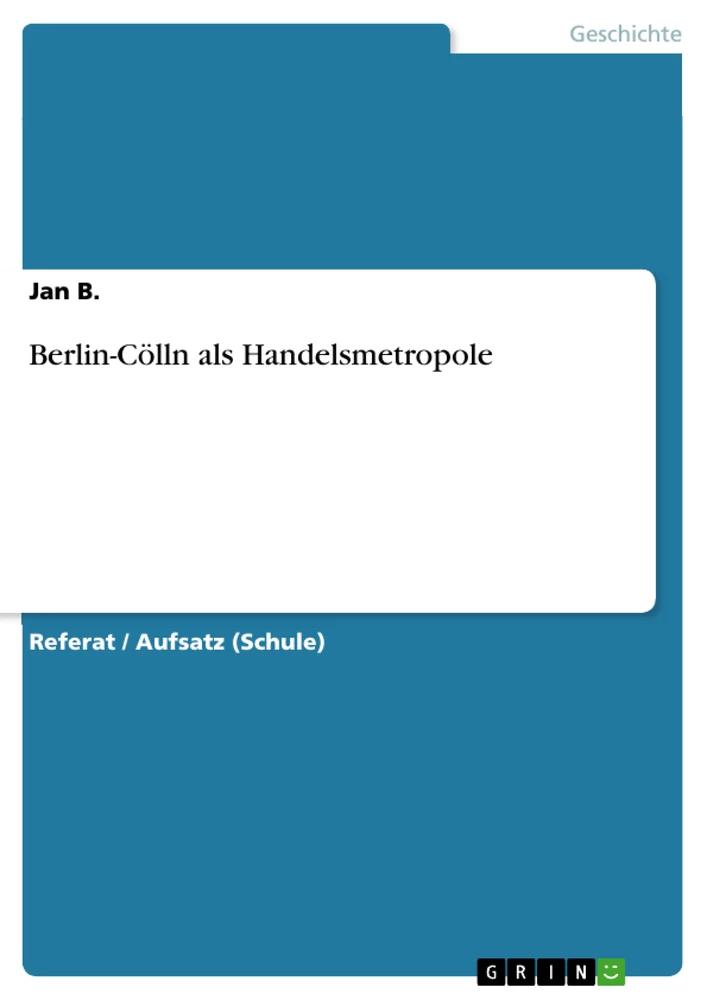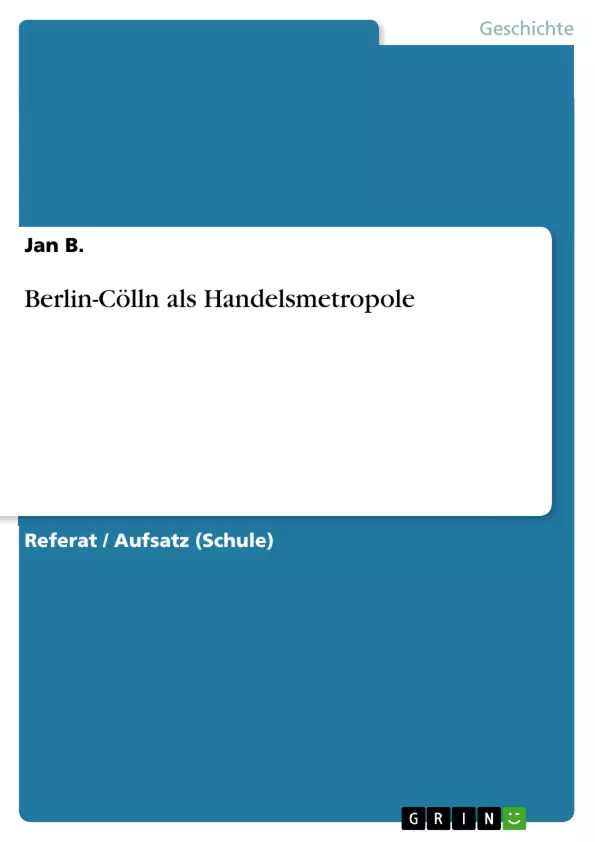Berlin-Cölln als Handelsmetropole 1237-1486
Die erst gegen Mitte des 13. JH. erstmals urkundlich erwähnte Doppelstadt Berlin- Cölln stieg bald zur bedeutenden Handelsstadt auf und trat im 14.Jh. der Hanse bei. Die askanischen Markgrafen wurden 1323 von den bayerischen Wittelsbachern abgelöst, denen 1373 die Luxemburger folgten. Auf dem Konstanzer Konzil 1415 wurde der Nürnberger Burggraf Friedrich mit dem Kurfürstentum Brandenburg belehnt, eine 500jährige Herrschaft der Hohenzollern begann. Im Jahr 1432 vereinigten sich Berlin und Cölln zur Gesamtstadt, die 1470 erstmals Residenz wurde. Die Doppelsiedlung Berlin-Cölln mauert sich zur Handelsmetropole.
Zwar führen archäologische Spuren der deutschen Kaufmanns-Doppelsiedlung an der Spreefurt bis ins letzte Viertel des 12.Jh. zurück, doch berichtet keine Urkunde von ihrer Gründung oder Stadterhebung. Während auf Cöllner-Seite die Altstadt erwuchs (um die Petrikirche), entwickelte sich auf dem Berliner Boden ein Kaufmannszentrum um den „Olden Markt“ und der Nikolaikirche. Beide Orte waren durch den Mühlendamm verbunden. Die Doppelsiedlung war wahrscheinlich ein Werk der in sächsischer Fürstenchronik als Städtegründer gepriesenen Urenkel Albrechts,der beiden Markgrafenbrüder Johann I. und Otto III. Unter der gemeinsamen Regierung errang Brandenburg eine führende Machtposition im nordostdeutschen Raum. So gelang es ihnen, nach blutigen Auseinandersetzungen mit dem Wettiner Markgrafen von Meißen, Heinrich dem Erlauchten, und dem Magdeburger Erzbischof im sogen. Teltow-Krieg 1238-45 das Gebiet des östlichen Teltows mit den Burgplätzen Köpenick und Mittenwalde endgültig in ihren Besitz zu bringen und 1250 folgten große Teile der Uckermark, die sie vom Pommernherzog erwarben. Als die tüchtigen Markgrafenbrüder 1266/67 starben, hinterließen sie im Spree- und Havelland etwa 30 Städte, die sie durch Verpächter hatten gründen lassen. Die Markgrafen residierten damals im Burgort Spandau, den sie 1232 zur Stadt erhoben hatten.
Der steile Aufstieg der Kaufmanns-Doppelsiedlung hatte zur Doppelstadt begonnen. Die ersten Urkunden tauchten auf, darunter die berühmte „Geburtsurkunde“ vom 28. Oktober 1237, in der Cölln erstmals erwähnt wird. Dieses Datum wurde von den Berlinern stolz zum Geburtstag ihrer Stadt bestimmt. Gefördert durch die askanischen Markgrafen, die der Kaufmannsstadt gegen 1251 Zollfreiheit gewährten, gewann Berlin-Cölln zunehmend an Bedeutung. So tagte hier bereits 1252 das erste Provinzialkapitel der Franziskaner, die sich zuvor als Bettelmönche in der wohlhabenden Stadt niederließen und 1271 auf einem Teil des Berliner Hofes das „Graue Kloster“ errichteten. Während dem Umbau der Pfarrkirchen zu großen gotischen Hallenkichen , wurde die erste Stadtmauer für Berlin-Cölln errichtet.
Die Hamburger schätzten den „Berliner Roggen“- die Doppelstadt bildet eine Städteunion mit einem gemeinsamen Rathaus
Das älteste Siegel der Bürger von Berlin mit brandenburgischem Adler unter Stadttor und Türmen taucht erstmals an einer Urkunde von 1253 auf. Der „Berliner Bär“ erscheint erst 1280 im Siegel- dafür gleich doppelt, den markgräflichen Adlersschild begleitend. Cölln führte sein eigenes Siegel. Als Markgraf Otto IV. 1280 den ersten nachweisbaren märkischen Landtag einberief, besaß die Doppelstadt schon die erste markgräfliche Münzstätte östlich der Elbe. Durch die Zollfreiheit begünstigt, entwickelten sich erste Handelsbeziehungen, besonders zu Hamburg. Neben der Ausfuhr von märkischen Bier und Holz wurde „Berliner Roggen“ aus der Kornkammer Barnim und Teltow bald zur geschätzten Handelsmarke (Export und Import florierten). Am 20.März 1307 fiel eine schicksalhafte Entscheidung, die für die Doppelstadt zukunftsbestimmend wurde.
Auf Initiative des Berliner Bürgermeisters Konrad von Beelitz genehmigte der Markgraf Hermann der Lange die Vereinigung der Schwesterstädte Berlin und Cölln zu einer einzigen Stadt. Daraufhin wurde ein gemeinsames Rathaus und die Gesamtstadt durch eine gemeinsame Mauer geschützt. Die Geschicke der Bürger wurden nun durch zwei Bürgermeister und 18 gewählte Ratsmannen (12 aus Berlin, 6 aus Cölln) bestimmt, die sämtlich dem Patriziat entstammten. Doch die neue Städteunion brachte nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern ermöglichte auch einen wirkungsvolleren Schutz vor dem ländlichen Raubadel, den die beiden gepanzerten Bären im Berliner Stadtsiegel symbolisierten. Nicht zuletzt diente der Zusammenschluß der Selbstbehauptung gegenüber den Herrschaftsansprüchen der Feudalfürsten. So schloß Berlin mit anderen brandenburgischen Städten Schutzbündnisse, die 1308 in der „heimlichen Hauptstadt“ besiegelt wurden. Ein Jahr später folgte der Bund mit Frankfurt an der Oder, Brandenburg und Salzwedel.
1319 starb der fürsorgliche Woldemar, unter dem die geteilte Mark Brandenburg noch einmal vereinigt worden war und ihre größte Ausdehnung erreichte. Nachfolger wurde sein elfjähriger Vetter Heinrich II., der kurz darauf ebenfalls verstarb. Mit ihm erlosch 1320 die AskanierDynastie in Brandenburg.
Ein 8jähriger Bayer wird Landesherr in Berlin - die königstreuen Bürger verbrennen den Probst
Nach dem Ende der brandenburgischen Askanier geriet Berlin in den Strudel blutiger Machtkämpfe. Sieger im Streit um das askanische Erbe blieben schließlich die Wittelsbacher. Nachdem König Ludwig der Bayer die Mark zum erledigten Reichslehen erklärt hatte, belehnte er am 4.Mai 1323 seinen 8jährigen Sohn Ludwig den Älteren, der zunächst unter königlicher Vormundschaft stand. Doch die Spannungen im märkischen Raum blieben, da Herzog Rudolf von Sachsen, der mit einer Askaniertochter verheiratet war und sich Hoffnungen auf den Markgrafentitel machte, seine Ansprüche weiterhin zu behaupten versuchte. Angesichts dieser bedrohlichen Wirren, die auch Willkürakte gegen die Städte befürchten ließen, schlossen noch im selben Jahr über 20 märkische Städte in Berlin ein Schutz- und Verteidigungsbund.
Wenig später wurde Berlin erstmals Schauplatz der unruhigen Reichspolitik, als es im Streit Ludwigs des Bayern mit Papst Johannes XXII. 1324 zu folgenschweren Spannungen zwischen den sächsich-askanischen Parteigängern und den wittelsbachischen Anhängern in der Bürgerschaft kam. Ausgelöst wurde der Konflikt durch den Berliner Probst und ehemaligen Kaplan des letzten askanischen Markgrafen Woldemar, Nikolaus von Bernau, der in den Auseinandersetzungen zwischen den Wittelsbachern und Herzog Rudolf von Sachsen für letzteren von der Kanzel herab Partei ergriff und den königstreuen Bürgern mit dem Bann drohte. Daraufhin zerrte die antipäpstlich gesinnte Volksmenge den Probst aus der Marienkirche auf den Markplatz, wo sie ihn erschlug und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Die Strafe des erzürnten Papstes ließ nicht lange auf sich warten: Er verhängte über Berlin-Cölln den Kirchenbann, sämtliche Kirchentüren wurden geschlossen, die Altarkerzen verloschen und die Glocken verstummten. Erst zwanzig Jahre später gelang es den Berlinern, sich aus dem Bann zu lösen. Der Preis: Zahlung eines hohen Lösegelds, Stiftung eines Altars für die Marienkirche und Errichtung eines steinernen Sühnekreuzes.
Der Landtag lehnt eine markgräfliche Sondersteuer ab- die Handwerker ziehen erstmals ins Rathaus ein.
Inzwischen gewann Berlin eigenes Profil. Bereits 1331 werden in einem Ratserlaß an Woll- und Leineweber unterzeichnenden höchsten Repräsentanten der Stadt als „magister consulum“ bezeichnet, also als Rats- bzw. Bürgermeister. Drei Jahre später wurden die ersten Polizei- und Kleiderordnungen durch das Patrizierrat erlassen. Diese richtete sich gegen die luxuriöse Kleidung der modebewußten Bürgerinnen sowie gegen verschwenderische Festlichkeiten und das Glücksspiel. Außerdem durfte nach dem letzten
Glockenschlag nicht mehr auf der Straße getanzt werden. Eine friedliche Zeit, wie es schien, trotz aller Wirren. Nun zierte auch der Berliner Bär erstmals die Hauptfläche des Siegelmedaillons auf einer Ratsurkunde von 1338. Dann heiratete der Markgraf Ludwig d. Ä. die Gräfin Margarete Maultasch von Tirol. Nachdem der Markgraf Ludwig d. Ä. noch 1345 dem Berliner Schultheißen Tyle Brügge das oberste Gericht übertragen und damit auf wesentliche Teile der Rechtssprechung verzichtet hatte, mußte er kurz darauf eine empfindliche Schlappe einstecken. Denn auf dem ersten allgemeinen Landtag in Berlin bewiesen die selbstbewußten Städter samt der Ritterschaft und den Bischöfen von Brandenburg und Havelberg erstaunlichen Mannesmut vor dem landesfremden Markgrafenthron, als sie die Forderung des Landesherrn nach Entrichtung eines Schoßes zur Soldatenbesoldung und markgräflicher Hofhaltung zurückwiesen. Darauf verpflichteten sich einige Monate später Ratsmänner, Gemeinde und Handwerkerinnungen schriftlich zu bedingungslosem Gehorsam gegenüber ihrem Landesherrn, der jetzt auch 6 Personen aus den Zünften delegierte.
Der Falsche Markgraf Woldemar wird mit der Mark belehnt - der entmachtete Bayer holt sich den Titel zurück
Die unglaubliche Geschichte des „falschen Markgrafen Woldemar“ begann im Sommer 1348, als in Wolmirstedt bei Magdeburg ein alter Pilgersmann auftauchte und behauptete , der 1319 angeblich verstorbene Askanier-Markgraf Woldemar zu sein: Sein Tod sei nur vorgetäuscht gewesen und in das Choriner Grab hätte man eine fremde Leiche gelegt, dann hätte er heimlich eine längere Pilgerreise angetreten, um seine Sünden zu büßen. Man glaubte ihm. Für König Karl IV. war das plötzliche Auftauchen des angeblichen Markgrafen eine willkommende Gelegenheit, die verhaßten Wittelsbacher zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Also belehnte er den falschen Woldemar mit der Mark Brandenburg. Da die Wittelsbacher die Gebiets-und Hoheitsverluste nicht weiter hinnehmen wollten, kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Als sie Karl IV. doch als deutschen König anerkannten, revanchierte sich dieser 1350 mit der Wiederbelehnung der Mark Brandenburg und ließ den falschen Woldemar zum Betrüger erklären. Dann zog der König beruhigt nach Italien. Als die antibayerisch eingestellten Berliner den König vergeblich um einen neuen Landesherrn baten, zogen Markgraf Ludwig d.Ä. und sein Bruder Ludwig „der Römer“ unter Beistand dänischer Truppen 1351 vor die widerspenstige Stadt und belagerten sie, bis die Berliner resignierten und mit ihrem bayrischen Landesherrn endlich Frieden schlossen.
Die Abneigung der christlichen Bürger gegen die jüdischen „Wucherer“ führt zum blutigen Pogrom.
Es bestand schon eine tiefe Kluft zwischen den Bürgern und den Geistlichen. Die Juden lebten nach einem Sonderbürgerrecht, doch mit wachsender Autonomie der Stadt kam es immer häufiger zu Konflikten, als sich die Juden durch zusätzlichen Fleischverkauf zu unbequemen Konkurrenten der zünftig zusammengeschlossenen Knochenhauer entwickelten. Durch den Zunftzwang vom Markt ausgeschlossen, blieb ihnen nur noch das Kreditgewerbe, in dem sich Mitte des 14.Jh. die beiden Berliner Juden Meyer und Mache ein Vermögen verdienten. Obwohl der „Wucherer“ bei Geldgeschäften ausdrücklich als notwendig anerkannt war, verstärkte sich allmählich die Abneigung gegen die „Wucherer“ und damit auch gegen alle anderen Juden. Als man dann schließlich im 14.Jh. für den „Schwarzen Tod“ Schuldige suchte, fand man sie schnell unter den Fremdlingen. So traf auch die Berliner Judengemeinde 1349 die „Vergeltung“, die mehreren jüdischen Mitbürgern das Leben kostete. Fünf Jahre später nahm Cölln mit markgräflicher Erlaubnis wieder 6 Juden als „Kammerknechte“ auf - eine willkommene Finanzquelle, denn für den persönlichen Schutz hatten die Juden Steuern zu zahlen. Ein Teil von ihnen war in städtischen Zinsbuden untergebracht.
Ludwig d. Ä. tritt die Mark an seine Brüder ab - Otto der Faule veräußert das Münzrecht
1351 überläßt Markgraf Ludwig seinen Brüdern Ludwig dem Römer und Otto dem Faulen die Mark Brandenburg. Diese verzichten dafür zu seinen Gunsten auf das Herzogtum Oberbayern. Bedeutsam war das Jahr 1356, als Kaiser Karl die „Goldenen Bulle“ erläßt. Darin zählte auch Markgraf Brandenburg zu denen die sich ab sofort Kurfürst nennen durften. Die Beförderung Ludwigs zum Kurfürsten hinderte Berlin keineswegs, seine eigene Machtposition weiter auszubauen. Auf dem hiesigen Landtag von 1359 wurde die Vorrangstellung der Spreestädte gegenüber den anderen märkischen Städten ausdrücklich bestätigt, und noch im selben Jahr nahmen die Berliner erstmals an einer Hansetagung in Kiel teil. Am 13. Juli 1363 erhielt der Berliner Rat durch den Kaiser davon Kenntnis, daß Ludwig und Otto in einer Erbverbrüderung mit dem Kaiserhaus Karls zweijährigem Sohn Wenzel die Mark zu gesichert hätten für den Fall, daß sie ohne Erben sterben sollten.
Zunächst erlebten die Berliner 1364 auf dem Marktplatz ein blutiges Spektakel, als des Magdeburger „Erzbischofs Theodorici“ Schreiber öffentlich enthauptet wurde. Dann starb im folgenden Jahr plötzlich Ludwig der Römer in Berlin (mit 35 Jahren).
Alleiniger Nachfolger wurde sein 18jähriger Bruder Otto, der wegen seines liederlichen Lebenswandels den Beinamen „der Faule“ erhielt.
Um den führungsschwachen und verschwenderischen Kurfürsten stärker an sich ran zu bringen, gab ihm der Kaiser 1366 seine Tochter zur Frau. Schon im folgenden Jahr konnte Karl IV. die von den Wittelsbachern an die Wettiner verpfändete Niederlausitz in seinen Besitz bringen, und nachdem Otto der Faule noch 1369 das Münzrecht für 6500 Mark an die Städte des Berliner Münzbezirks sowie das Dorf Pankow verkauft hatte, bemächtigte sich der Kaiser 1371 mit Gewalt der Mark Brandenburg.
Otto der Faule verkauft Brandenburg an den Kaiser - nach dem Stadtbrand droht die Teilung Berlins.
Otto der Faule verzichtete 1373 zugunsten des Kaisers auf die Mark Brandenburg und zog sich ins ferne Bayernland zurück. Damit war die Wittelsbacher Ära zu Ende, es begann die Zeit der Luxemburger. Diese führten sich in Berlin vielversprechend ein, indem Kaiser Karl und sein 12jähriges Söhnchen Wenzel den Berliner-Cöllner Bürgern sämtliche Privilegien einschließlich des neu erworbenen Münzrechts bestätigten. Der Euphorie folgte der erste Dämpfer, als der Kaiser den Elbort Tangermünde zur brandenburgischen Nebenresidenz erhob und als Stapelplatz ausbauen ließ. Damit war der wohlhabenden Handelsstadt Berlin- Cölln eine bedrohliche Konkurrenz erwachsen. So mochte es den Berlinern kaum ein Trost gewesen sein, daß Karl IV. der einzige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war, der ihre Stadt besuchte. Die Unzufriedenheit mit dem neuen Landesherrn zeigte auch der Cöllner Patrizier-Ratsherr Tyle Wardenberg, indem er 1374 einen Aufstand probte, um der Stadt Selbständigkeit zu ertrotzen. Der Versuch scheiterte. Einen interessanten Einblick in den Besitzstand der wohlhabenden Patrizier vermittelte das 1375 vom Kaiser geforderte „Landbuch der Mark Brandenburg“. Danach hatten viele Berliner Bürger ihr vor allem im Fernhandel erworbenes Kapital in nicht weniger als 94 Dörfern auf dem Umland angelegt. Berlin zählte damals schon zu den reichsten Städten , die auch die meisten Abgaben zu entrichten hatten. Um so schmerzlicher müssen die Bürger von den Stadtbränden getroffen worden sein. Auf der Suche nach dem Schuldigen von 1376 stieß man auf einen Pfarrer namens Nikolaus Hundewerper. Obwohl seine Schuld nie bewiesen wurde schaffte man ihn ins Kloster Lehnin, wo ihn der Bischof in „geistliche Haft“ nahm. Unvergleichlich schlimmer allerdings wütete 1380 im Berliner Teil eine zweite Feuersbrunst, die fast die gesamte Stadt, samt Kirchen einäscherte und Tausende von Todesopfern forderte. Diesmal wurde der Brandstifter entlarvt. Es war der Ritter Erich von Falke. Während wenig später der Rittersmann ermordet wurde, erließ der einsichtige Landesherr den ruinierten Bürgern für drei Jahre die Steuern. Trotzdem kam es zwischen Berlin und Cölln, aufgrund der hohen Kosten des Wiederaufbaus von öffentlichen Gebäuden, zum Konflikt der fast zur Teilung der Doppelstadt geführt hätte. Nur die „ernstliche“ Mahnung des Markgrafen verhinderte den Bruch. So Entstand Berlin und Cölln neu. Inzwischen war der Kaiser Karl IV. in seiner Prager Residenz 1378 gestorben. Sein 10jähriger Sohn Sigismund erhielt nun den Markgrafentitel.
Brandenburg wird verpfändet - die Raubritter verunsichern das vernachlässigte Land
Trotz aller Wirren erreichte Berlin-Cölln zwischen 1350 und Mitte des 15. Jh. den Zenit seiner wirtschaftlichen und politischen Macht. Die Berliner-Doppelstadt besann sich auf ihre eigenen Interessen und ließ um 1390 das „Berlinische Stadtbuch“ anlegen, das als Chronik alle Abschriften wichtiger Vertragsurkunden, Gesetzestexte und Gerichtsurteile festhielt - darunter allein 114 Hinrichtungen zwischen 1391-1448 mit der damals alltäglichen Folter durch Rädern, Verbrennung und Begraben bei lebendigem Leib. Dazwischen gelang es dem rührigen Rat, durch geschickte Zukäufe das Vorfeld stetig zu erweitern. So erwarb er 1385-98 zur Sicherung des Handelswegs die am Oberlauf der Spree gelegene Stadt und Burg Köpenick, deren Glanz aus der Zeit des Slawenfürsten Jacza (12 Jh.) längst verblaßt war. Weitere Erwerbungen kamen in der Folgezeit hinzu, nachdem schon 1370 Pankow zugefallen war. Darunter 1391 Lichtenberg, 1397 Reinickendorf, 1435 Mariendorf, Marienfelde, Rixdorf und schließlich auch Tempelhof. Den Berlinern gelang 1391 ein weiterer entscheidender Schritt zur Selbständigkeit, als sie vom Schulzen Tyle Brügge das wichtige Schultheißenamt samt Gerichtsbarkeit „an Hals und Hand“ gegen Zahlung von 356 Schock böhmischer Groschen erwarben. Damit waren sie nicht nur in Besitz wichtiger landesherrlicher Privilegien gekommen, sondern auch an eine ergiebige Einnahmequelle, weil sich mancher Übeltäter durch Zahlung einer „angemessenen“ Geldsumme der Vollstreckung des Urteils entziehen konnte.
Kurfürst Friedrich I. ernennt seinen Sohn Johann zum Statthalter - Hussiten unternehmen einen Rachefeldzug
Kaum war der ehemalige Burggraf Friedrich von Nürnberg zum brandenburgischen Kurfürsten avanciert, nahmen ihn die Reichsgeschäfte derart in Anspruch, daß er noch im Benennungsjahr 1417 seinen ältesten Sohn Johann mit den Amtsgeschäften in der Kurmark betraute. Kein Wunder, daß sich die arbeitslosen Raubritter bald wieder zu Wort meldeten und durch erneute Übergriffe den lebenswichtigen Berliner Handel mit den Hansestädten Hamburg und Lübeck bedrohten. Daraufhin schloß Berlin-Cölln 1431 wieder ein Schutzbündnis mit Alt- und Neubrandenburg sowie Frankfurt an der Oder gegen Fürstengewalt.
Die Stadtregierung wird entmachtet - die Bürger rebellieren gegen die Cöllner „Zwingburg“
Als der seit 1426 ständig abwesende Kurfürst Friedrich I. seine brandenburgischen und fränkischen Lande 1437 teilte, drehte sich das hohenzollernsche Machtkarussell: Albrecht Achailles erhielt Ansbach, der bisherige Brandenburger Statthalter Johann „der Alchimist“ wurde ins Fürstentum Bayreuth zurückbeordert, Friedrich der Fette nahm die Altmark mit Prignitz in Besitz, und Friedrich II. „Eisenzahn“ wurde neuer Kurfürst von Bandenburg. In den Hussitenkämpfen glücklos, war es ihm nicht gelungen, die hohenzollernsche Hausmacht zu vergrößern, und nach dem Tod Sigismunds 1437 und Albrechts II. hatte er sich zweimal vergeblich um die deutsche Königskrone beworben. Nun war der Weg frei für seinen 22 jährigen Sohn Friedrich II. Als die zu politischer Macht strebenden Innungen im Jahr darauf mit dem Patrizizierrat wieder einmal in Streit gerieten, wandten sich Gewerke und Gemeine an den Landsherrn um Vermittlung. Ein willkommener Anlaß für den Kurfürsten, seine eigene
Stärke zu demonstrieren und die Macht der Spreestädter zu brechen. Dazu reichten ihm 600 bewaffnete Reiter, die 1442 in der Stadt „groß schrecken“ machten und die Bürger zur Öffnung der Stadttore zwangen. Zunächst trennte er die gemeinsame Stadtverwaltung von Berlin-Cölln und schränkte das Bündnisrecht ein, um in Zukunft die stärkende Bindung an andere Städte zu verhindern. Als der Kurfürst 1443 eigenhändig den Grundstein zum Schloßbau auf der Werderinsel legte, sahen sie ein Symbol ihrer Unterwerfung. Der Konflikt war somit vorgezeichnet. Der inzwischen angestaute bürgerliche Unmut steigerte sich schließlich zum Aufstand. Da jedoch die Unterstützung durch andere Städte ausblieb, brach die Bürgerrevolution schnell zusammen. Nun dominierte der siegreiche brandenburgische Adler, der sich im Rücken des unterworfenen Berliner Bärens krallte. Die Niederlage Berlins war perfekt.
Der Kurfürst bezieht in Cölln sein neues Schloß - die Untertanen tilgen die landesherrlichen Schulden
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Berlin-Cölln als Handelsmetropole 1237-1486"?
Der Text beschreibt den Aufstieg von Berlin-Cölln von einer Doppelstadt zu einer bedeutenden Handelsmetropole im Zeitraum von 1237 bis 1486. Er beleuchtet politische Ereignisse, wirtschaftliche Entwicklungen und soziale Veränderungen in dieser Zeit.
Was ist die "Geburtsurkunde" von Cölln und wann wurde Berlin gegründet?
Die "Geburtsurkunde" ist eine Urkunde vom 28. Oktober 1237, in der Cölln erstmals erwähnt wird. Dieses Datum wurde von den Berlinern als Geburtstag ihrer Stadt betrachtet. Der Text erwähnt keine exakte Gründungsdatum für Berlin, aber es ist bekannt, dass die beiden Siedlungen sich entwickelten, um die Petrikirche (Cölln) und den "Olden Markt" mit der Nikolaikirche (Berlin).
Welche Rolle spielten die Askanier in der Entwicklung von Berlin-Cölln?
Die askanischen Markgrafen förderten Berlin-Cölln, indem sie der Kaufmannsstadt um 1251 Zollfreiheit gewährten, was ihre Bedeutung steigerte.
Welche Handelsbeziehungen pflegte Berlin-Cölln?
Berlin-Cölln hatte Handelsbeziehungen, besonders zu Hamburg. Der Export von "Berliner Roggen" aus der Kornkammer Barnim und Teltow war bedeutend, neben dem Export von märkischem Bier und Holz.
Was war der Teltow-Krieg?
Der Teltow-Krieg war ein Konflikt (1238-45) zwischen den askanischen Markgrafen und Heinrich dem Erlauchten von Meißen und dem Magdeburger Erzbischof, in dem es um das Gebiet des östlichen Teltows mit Köpenick und Mittenwalde ging.
Wann vereinigten sich Berlin und Cölln zu einer Stadt?
Berlin und Cölln vereinigten sich im Jahr 1307. Dadurch entstand ein gemeinsames Rathaus und eine gemeinsame Stadtmauer.
Was war der Grund für den Kirchenbann über Berlin-Cölln?
Der Kirchenbann wurde verhängt, nachdem der Berliner Probst Nikolaus von Bernau von der Bevölkerung getötet und verbrannt wurde, weil er im Streit zwischen Ludwig dem Bayern und dem Papst Partei gegen die königstreuen Bürger ergriffen hatte.
Wer war der "falsche Markgraf Woldemar"?
Der "falsche Markgraf Woldemar" war ein Mann, der 1348 auftauchte und behauptete, der 1319 verstorbene Markgraf Woldemar zu sein. König Karl IV. nutzte dies aus, um die Wittelsbacher unter Druck zu setzen.
Was geschah beim Pogrom von 1349 in Berlin?
Im Jahr 1349 kam es zu einem Pogrom gegen die jüdische Gemeinde in Berlin, bei dem mehrere jüdische Mitbürger getötet wurden. Dies geschah im Kontext der Suche nach Schuldigen für den "Schwarzen Tod".
Welche Rolle spielte die "Goldene Bulle" für Brandenburg?
Die "Goldene Bulle" von 1356 erhob den Markgrafen von Brandenburg zu einem der Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches.
Warum wurde Otto als "der Faule" bezeichnet?
Otto erhielt den Beinamen "der Faule" aufgrund seines liederlichen Lebenswandels und seiner schwachen Führung.
Was war das "Landbuch der Mark Brandenburg"?
Das "Landbuch der Mark Brandenburg" war ein 1375 vom Kaiser gefordertes Verzeichnis, das Einblick in den Besitzstand der wohlhabenden Patrizier gab.
Welche Auswirkungen hatten die Stadtbrände auf Berlin-Cölln?
Die Stadtbrände, besonders der von 1380, verursachten große Zerstörungen und hohe Kosten für den Wiederaufbau, was zu Konflikten zwischen Berlin und Cölln führte.
Was war das "Berlinische Stadtbuch"?
Das "Berlinische Stadtbuch" war eine Chronik, die ab etwa 1390 angelegt wurde und wichtige Vertragsurkunden, Gesetzestexte und Gerichtsurteile festhielt.
Was geschah unter Kurfürst Friedrich I. und Friedrich II.?
Friedrich I. ernannte seinen Sohn Johann zum Statthalter. Friedrich II. versuchte die Macht der Spreestädter zu brechen und baute ein Schloß auf der Werderinsel, was zu einem Bürgeraufstand führte.
Wann wurde Berlin Residenzstadt?
Die Geburtsstunde der Residenzstadt war 1486, nachdem ein Stadtbrand 1484 Teile der Doppelstadt einäscherte und die Pest wütete.
- Arbeit zitieren
- Jan B. (Autor:in), 2001, Berlin-Cölln als Handelsmetropole, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101023