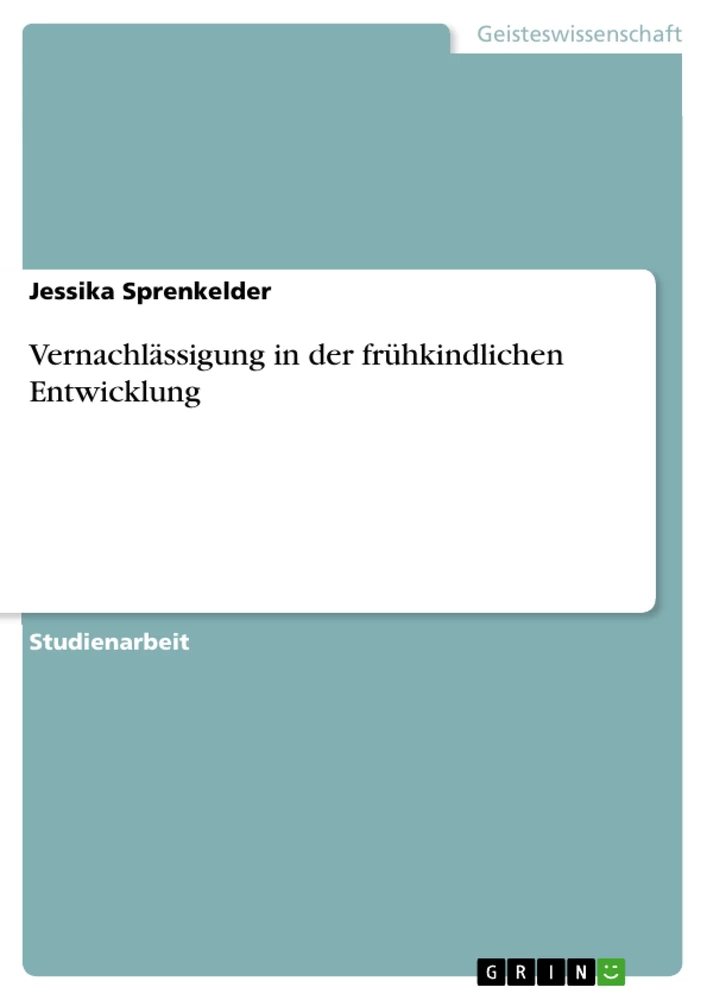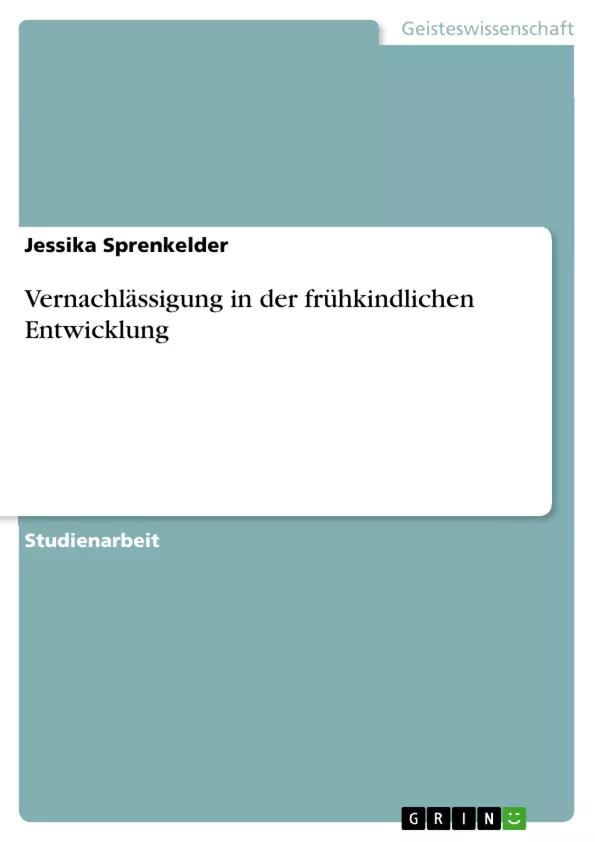Das Thema dieser Hausarbeit ist die Vernachlässigung von Kindern in deren frühkindlicher Entwicklung und widmet sich in besonderem Maße den Folgen dieser Vernachlässigung.
Das Bürgerliche Gesetzbuch, welches erstmalig im Jahr 1896 unter Wilhelm dem II. verabschiedet worden ist, hält in §1626 Absatz 1 fest, dass Eltern sowohl die Pflicht als auch das Recht haben, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen. Dies beinhalte sowohl die Sorge um die Person des Kindes als auch die um das Vermögen des Kindes.
Dennoch wird, unter anderem in den Medien, diskutiert, dass diese Pflichten häufig verletzt und Kinder somit nicht gesetzeskonform versorgt werden. Inwiefern sich die Vernachlässigung der Kinder von anderen Formen der Kindesmisshandlung unterscheidet und welche langfristigen Folgen die Vernachlässigung für die betroffenen Kinder hat wird
in dieser Hausarbeit erörtert.
Hierzu wird zunächst in Kapitel 2 die frühkindliche Entwicklung definiert. Anschließend werden die altersgemäßen Entwicklungsschritte in körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht sowie die Entwicklung des Gehirns in dieser Altersspanne erläutert. Anschließend werden in Kapitel 3 die kindlichen Bedürfnisse und deren Abhängigkeit voneinander anhand der Bedürfnispyramide nach Maslow verdeutlicht.
Auf dieser Basis werden in Kapitel 4 der Begriff sowie die Formen der Vernachlässigung erklärt und es erfolgt eine Abgrenzung zu anderen Formen der Kindesmisshandlung, ehe auf die Folgen von Vernachlässigung anhand bisheriger Literatur sowie Studienergebnissen eingegangen wird.
Abschließend wird in Kapitel 5 aus den Erkenntnissen dieser Hausarbeit ein Fazit darüber gezogen, welche langfristigen Folgen die Vernachlässigung von Kindern in der frühkindlichen Entwicklung hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Frühkindliche Entwicklung
- 2.1 Körperliche Entwicklung
- 2.2 Kognitive Entwicklung
- 2.3 Emotionale Entwicklung
- 2.4 Soziale Entwicklung
- 2.5 Entwicklung des Gehirns
- 3 Bedürfnispyramide nach Maslow
- 4 Vernachlässigung
- 4.1 Aspekte der Vernachlässigung
- 4.2 Abgrenzung zu anderen Formen der Kindesmisshandlung
- 4.3 Folgen von Vernachlässigung in der frühkindlichen Entwicklung
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Vernachlässigung von Kindern in ihrer frühkindlichen Entwicklung und analysiert insbesondere die Folgen dieser Vernachlässigung. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schreibt Eltern die Pflicht und das Recht zur Sorge für ihre minderjährigen Kinder vor, doch die Diskussion um Verletzung dieser Pflichten und die daraus resultierenden Folgen für Kinder ist aktuell. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich die Vernachlässigung von Kindern von anderen Formen der Kindesmisshandlung unterscheidet und welche langfristigen Auswirkungen sie auf die betroffenen Kinder hat.
- Definition und Abgrenzung der frühkindlichen Entwicklung (3-6 Jahre)
- Entwicklungsschritte in körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht sowie die Entwicklung des Gehirns
- Die Bedürfnispyramide nach Maslow und die Abhängigkeit kindlicher Bedürfnisse
- Definition und Formen der Vernachlässigung im Vergleich zu anderen Formen der Kindesmisshandlung
- Langfristige Folgen der Vernachlässigung auf die frühkindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Die Arbeit definiert zunächst die frühkindliche Entwicklung zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, auch Vorschulalter genannt. Sie beleuchtet die körperliche Entwicklung, die in diesem Alter langsamer voranschreitet als in den ersten Lebensjahren, sowie die Weiterentwicklung des zentralen Nervensystems und die Verbesserung der Grob- und Feinmotorik.
- Kapitel 3: Anschließend werden die kindlichen Bedürfnisse und ihre Abhängigkeit voneinander im Zusammenhang mit der Bedürfnispyramide nach Maslow erläutert.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel wird der Begriff Vernachlässigung definiert und in verschiedenen Formen dargestellt. Außerdem wird die Abgrenzung zu anderen Formen der Kindesmisshandlung beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet auch die Folgen der Vernachlässigung auf die frühkindliche Entwicklung, basierend auf bereits vorliegenden Studien und Literatur.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Entwicklung, Vernachlässigung, Kindesmisshandlung, Bedürfnispyramide nach Maslow, Körperliche Entwicklung, Kognitive Entwicklung, Emotionale Entwicklung, Soziale Entwicklung, Entwicklung des Gehirns, Folgen der Vernachlässigung, Langfristige Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter frühkindlicher Entwicklung verstanden?
In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff auf das Alter zwischen drei und sechs Jahren, auch als Vorschulalter bekannt.
Wie unterscheidet sich Vernachlässigung von anderen Formen der Kindesmisshandlung?
Vernachlässigung ist oft durch das Unterlassen notwendiger Fürsorge (körperlich, emotional, kognitiv) gekennzeichnet, während andere Misshandlungen aktive Gewaltanwendung beinhalten.
Welche Rolle spielt die Maslowsche Bedürfnispyramide in der Untersuchung?
Sie dient dazu, die Abhängigkeit der verschiedenen kindlichen Bedürfnisse voneinander zu verdeutlichen und aufzuzeigen, welche Defizite durch Vernachlässigung entstehen.
Was sind langfristige Folgen von Vernachlässigung im Vorschulalter?
Vernachlässigung kann zu massiven Störungen in der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung sowie zu bleibenden Beeinträchtigungen der Gehirnstruktur führen.
Was sagt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) zur elterlichen Sorge?
Gemäß §1626 Abs. 1 BGB haben Eltern die Pflicht und das Recht, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen (Personen- und Vermögenssorge).
- Quote paper
- Jessika Sprenkelder (Author), 2021, Vernachlässigung in der frühkindlichen Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1010284