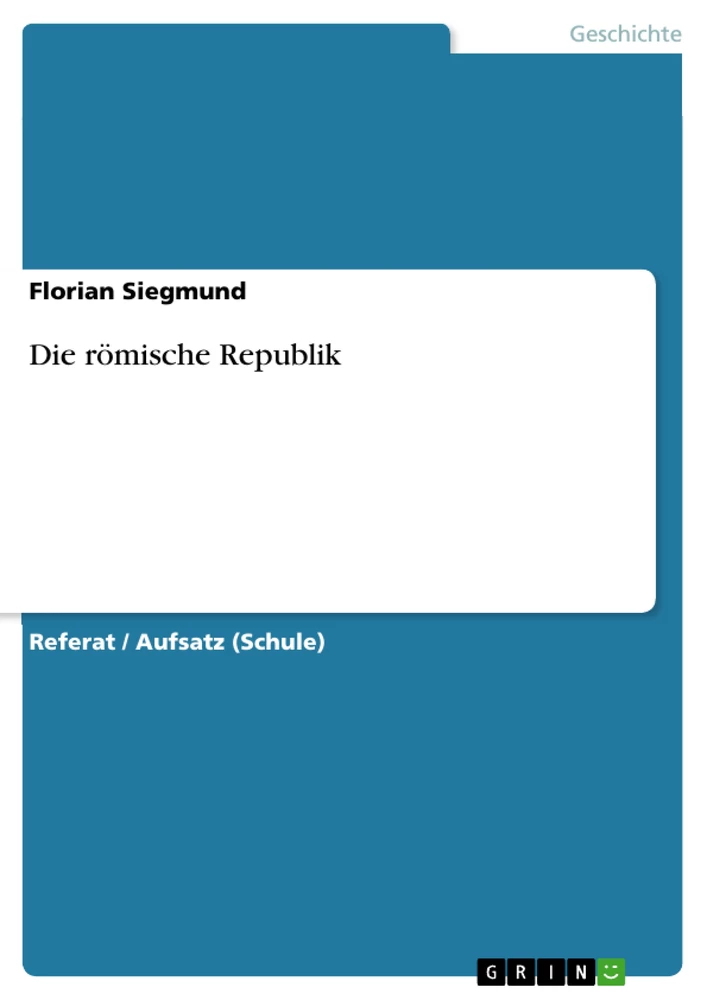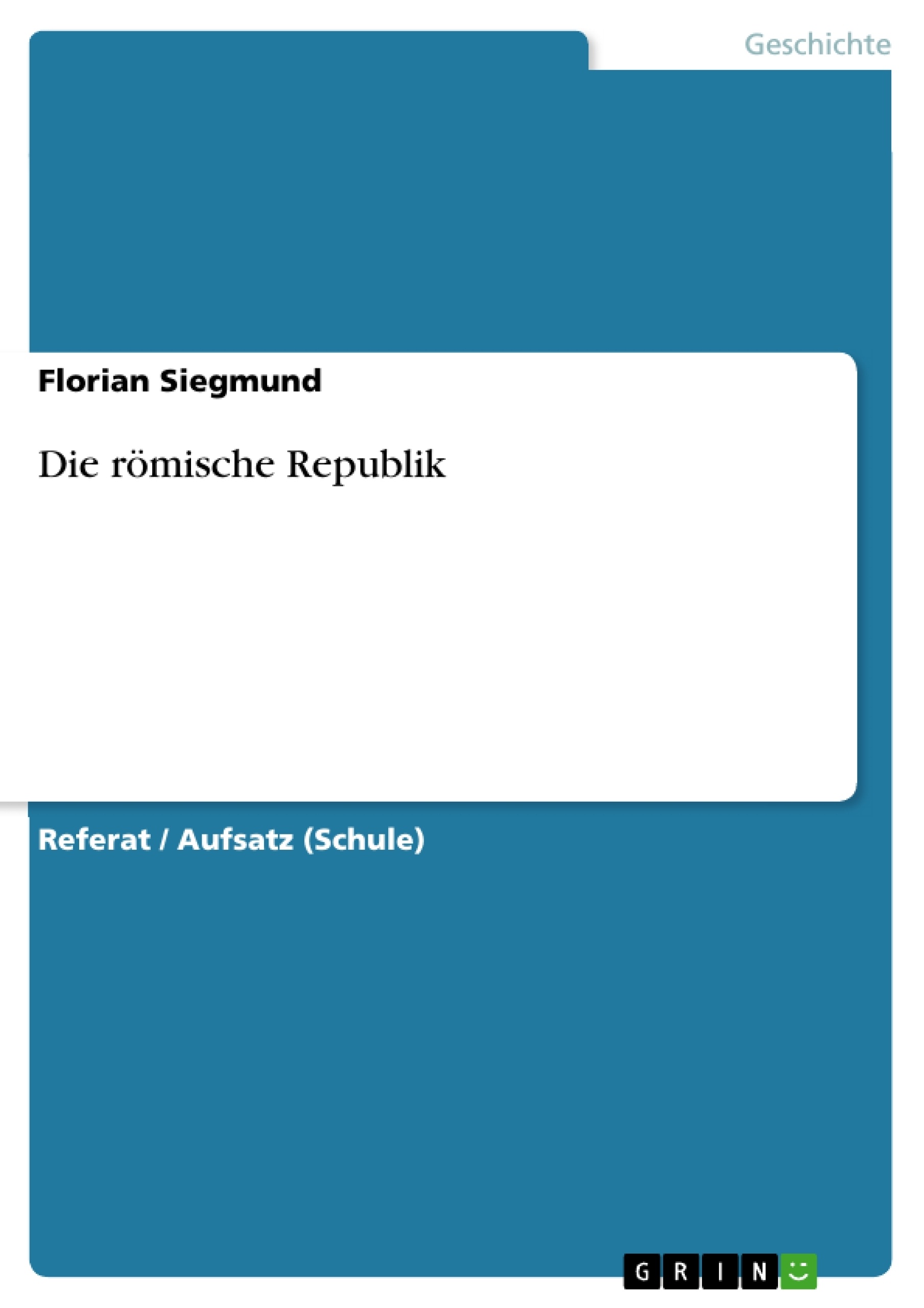Sturz des Königtums
- 509 v. Chr.: Beseitigung des Königtums
- Zusammenbruch der Vormacht der Etrusker
- Vertreibung des letzten Königs Tarquinius Superbus
- militärische, rechtliche, kultische Befugnisse an Adel der Patrizier (sakrale Aufgaben an „Opferkönig“, Priester; militärische, rechtliche Aufgaben an „praetor maximus“ = Herzog)
- Plebejer von allen Ämtern ausgeschlossen
- Landnot (Erbteilung= Verkleinerung des nutzbaren Landes), Verschuldung...
- rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Plebejer
- Gegensatz: Patrizier – Plebejer: Konflikt = Bürgerkrieg
Die Ständekämpfe
- Forderung der Plebs: bessere Lebensbedingungen, Verminderung der Schulden, politisches Mitspracherecht, Beteiligung an der Staatsführung
- Druckmittel:
- „Staat im Staat“ = Institutionen, Versammlungen, Beschlüsse, Volkstribune, Ädilen, eigene Magistrate (= Repräsentanten der Plebs)
- Immer größere Beteiligung der reicheren Plebs an der Kriegsführung
- Forderung nach politischer Mitsprache
- Beide Seiten um Kompromiss bemüht
- 200 Jahre Kämpfe: neue gesellschaftliche und staatliche Ordnung
- Grundlage für Machtstellung Roms
- 287 v. Chr.: Ende der Ständekämpfe
- Ergebnis:
- Beteiligung der Plebejer an höchsten Magistratswahlen
- Aufhebung des Heiratsverbots zw. Plebs + Patriziern
- Plebejer erhielten Zugang zu allen patrizischen Ämtern, aber nicht umgekehrt
- Anfang 4.Jhrdt: Konsulatsverfassung der römischen Republik
- Magistratur
- Ende 4.Jhrdt:
- Plebejer erhalten Zugang zu Priesterämtern
- Bürger erhalten provocatio ad populum (= Recht auf Berufung bei der Volksversammlung gegen Zugriff des römischen Magistrats) = Grundprinzip
- Besserung der wirtschaftliche Lage der Plebs durch Gründung von Kolonien und Bereitstellung von Ackerland
- Verbot der Schuldknechtschaft
Die Nobilität
- Immer mehr Plebejer werden Konsuln
- Begrenzter Kreis konsularischer Familien (Patr./Plebs)
- fest geschlossene Gruppe
- Nobilität = pol. Führungsschicht
- Enger Zusammenhalt dieser Gruppe erschwert Zugang
- Aufsteiger in die Nobilität (z.B. Cicero) = homo novus
- Zugehörigkeit nicht für immer: durch politische Tätigkeit unter Beweis stellen
- Einfluss auf Magistrate
Die Magistratur
- Anzahl der Ämter klein: Nobilität behält Einfluss auf Beamte
- Nur Ehrenämter: kein Lohn
- Hilfskräfte der Magistrate: z.B. Schreiber, Boten, Liktoren (= „rechte Hand“: wichtige Aufgaben, auch Verhaftungen und Urteilsvollstreckungen)
- Höhere Beamte = Magistratus: Kein Diener des Staates, sondern Repräsentant der staatlichen Gewalt
- Drei Säulen des römischen Staatswesens: Volksversammlung, Senat, Magistratur
- Magistrate konnten nicht abgesetzt oder rechtlich belangt werden
- Konsuln: uneingeschränkte Befehlsgewalt
- Keine Trennung zwischen zivilen/militärischen Aufgaben
- Später: Aufgabenverteilung auf Quästoren, Ädilen...
- Nach Rängen gegliederte Struktur (z.B. mehr Liktoren als andere)
- Weisungsbefugnisse auf niedere Beamte
- Amtszeit: 1 Jahr ( Ausnahme: Zensoren, Diktatoren: 18 Monate)
- Kollegialität: alle Ämter (außer Diktatur) mit zwei Beamten besetzt
- Schutz vor Missbrauch
- Keine Gewaltenteilung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Magistrate
- Volkstribun
- Während der Ständekämpfe Führungsspitze der plebejischen Magistrate;
- „großer Bruder“: Die Volkstribune verfügten über das Recht, Angehörige der Plebejer in allen Straffällen zu verteidigen, über das Vetorecht gegen jegliche Senatsbeschlüsse und über persönliche Unverletzlichkeit während ihrer Amtszeit.
- Konsul
- Titel der beiden obersten Beamten der antiken römischen Republik, die von der Volksversammlung bzw. konsularische Familien auf jeweils ein Jahr gewählt bzw. in der Kaiserzeit von den Kaisern ernannt wurden. Die Consules waren zuständig für die Heeresführung, Berufung und Leitung der Komitien (gesetzgebenden Versammlungen des gesamten Volkes) und des Senats.
- Ädilen
- römische Beamte, zu deren Funktionen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Aufsicht über Tempel, öffentliche Gebäude, Märkte (...), Versorgung der Bevölkerung mit Getreide und die Ausrichtung öffentlicher Spiele durch Ausübung der polizeilichen Gewalt gehörten. Ädilen bestanden anfangs nur aus Plebejern, später aber aus senatorischen Familien.
- Zensoren
- zuständig für Finanzwesen (Vermögensschätzung, Verpachtung...), Musterung der Bürger und Ritter, bzw. Sittenaufsicht und wählten die Mitglieder des Senats aus.
- Quästoren
- Gehilfen der Konsuln, später auch Verwalter der Kriegs-, Staatskassen (...), in den Provinzen; Vertreter des Statthalters. ~ Finanzbeamter
- Prätoren
- ständige Vertreter der Konsuln im Kriegsfall, zuständig für die Rechtssprechung zwischen den Bürgern Roms, später auch zwischen Fremden.
Häufig gestellte Fragen
- Was waren die Hauptpunkte beim Sturz des Königtums?
- Der Sturz des Königtums im Jahr 509 v. Chr. beinhaltete die Beseitigung des Königtums, den Zusammenbruch der etruskischen Vormacht, die Vertreibung des letzten Königs Tarquinius Superbus und die Übertragung militärischer, rechtlicher und kultischer Befugnisse an den Adel der Patrizier. Plebejer wurden von allen Ämtern ausgeschlossen, was zu Landnot, Verschuldung und einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Plebejer führte. Dies führte zu einem Konflikt zwischen Patriziern und Plebejern, der einem Bürgerkrieg ähnelte.
- Was waren die Ständekämpfe und deren Ziele?
- Die Ständekämpfe waren durch die Forderung der Plebs nach besseren Lebensbedingungen, Schuldenverminderung, politischem Mitspracherecht und Beteiligung an der Staatsführung gekennzeichnet. Sie nutzten Druckmittel wie "Staat im Staat"-Institutionen, Versammlungen, Volkstribune und Ädilen. Nach 200 Jahren des Kampfes entstand eine neue gesellschaftliche und staatliche Ordnung, die die Grundlage für die Machtstellung Roms bildete. Die Kämpfe endeten 287 v. Chr.
- Was waren die Ergebnisse der Ständekämpfe?
- Die Ergebnisse der Ständekämpfe umfassten die Beteiligung der Plebejer an höchsten Magistratswahlen, die Aufhebung des Heiratsverbots zwischen Plebs und Patriziern, den Zugang der Plebejer zu allen patrizischen Ämtern (jedoch nicht umgekehrt) und die Etablierung der Konsulatsverfassung der römischen Republik im frühen 4. Jahrhundert. Weiterhin erhielten Plebejer Zugang zu Priesterämtern, Bürger erhielten das Recht auf Berufung bei der Volksversammlung (provocatio ad populum), die wirtschaftliche Lage der Plebs wurde durch Koloniegründungen verbessert und die Schuldknechtschaft wurde verboten.
- Was ist die Nobilität?
- Die Nobilität entstand, als immer mehr Plebejer Konsuln wurden. Sie bildete einen begrenzten Kreis konsularischer Familien (Patrizier/Plebejer), der eine fest geschlossene Gruppe und die politische Führungsschicht darstellte. Der enge Zusammenhalt dieser Gruppe erschwerte den Zugang. Aufsteiger in die Nobilität wurden als "homo novus" bezeichnet. Die Zugehörigkeit zur Nobilität war nicht dauerhaft und musste durch politische Tätigkeit bewiesen werden. Sie übte Einfluss auf Magistrate aus.
- Was waren die Merkmale der Magistratur?
- Die Magistratur umfasste eine geringe Anzahl an Ämtern, wodurch die Nobilität ihren Einfluss auf die Beamten behielt. Es handelte sich um Ehrenämter ohne Lohn. Hilfskräfte der Magistrate waren Schreiber, Boten und Liktoren. Höhere Beamte (Magistratus) waren Repräsentanten der staatlichen Gewalt. Drei Säulen des römischen Staatswesens waren Volksversammlung, Senat, Magistratur. Magistrate konnten nicht abgesetzt oder rechtlich belangt werden. Konsuln hatten uneingeschränkte Befehlsgewalt, und es gab keine Trennung zwischen zivilen und militärischen Aufgaben. Später erfolgte eine Aufgabenverteilung auf Quästoren, Ädilen usw. Es gab eine nach Rängen gegliederte Struktur mit Weisungsbefugnissen auf niedere Beamte.
- Welche Prinzipien galten für die Amtszeit der Magistrate?
- Die Amtszeit betrug in der Regel 1 Jahr (Ausnahme: Zensoren und Diktatoren mit 18 Monaten). Es galt das Prinzip der Kollegialität, wobei alle Ämter (außer Diktatur) mit zwei Beamten besetzt waren, um Schutz vor Missbrauch zu gewährleisten. Es gab keine Gewaltenteilung.
- Welche verschiedenen Magistrate gab es und welche Funktionen hatten sie?
- Zu den Magistraten gehörten:
- Volkstribun: Führungsspitze der plebejischen Magistrate, Verteidigung der Plebejer in Straffällen, Vetorecht gegen Senatsbeschlüsse, persönliche Unverletzlichkeit.
- Konsul: Oberste Beamte, zuständig für Heeresführung, Berufung und Leitung der Komitien und des Senats.
- Ädilen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Aufsicht über Tempel, Gebäude, Märkte, Versorgung mit Getreide, Ausrichtung öffentlicher Spiele.
- Zensoren: Zuständig für Finanzwesen, Musterung der Bürger und Ritter, Sittenaufsicht, Wahl der Senatsmitglieder.
- Quästoren: Gehilfen der Konsuln, Verwalter der Kriegs- und Staatskassen, Vertreter des Statthalters (Finanzbeamter).
- Prätoren: Vertreter der Konsuln im Kriegsfall, zuständig für Rechtssprechung zwischen den Bürgern Roms, später auch zwischen Fremden.
- Promagistrate: Verlängerung der Amtszeit von Konsuln/Prätoren in militärischen Konflikten, Ernennung/Absetzung durch den Senat.
Fin de l'extrait de 8 pages
- haut de page
- Citation du texte
- Florian Siegmund (Auteur), 2001, Die römische Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101032
Lire l'ebook