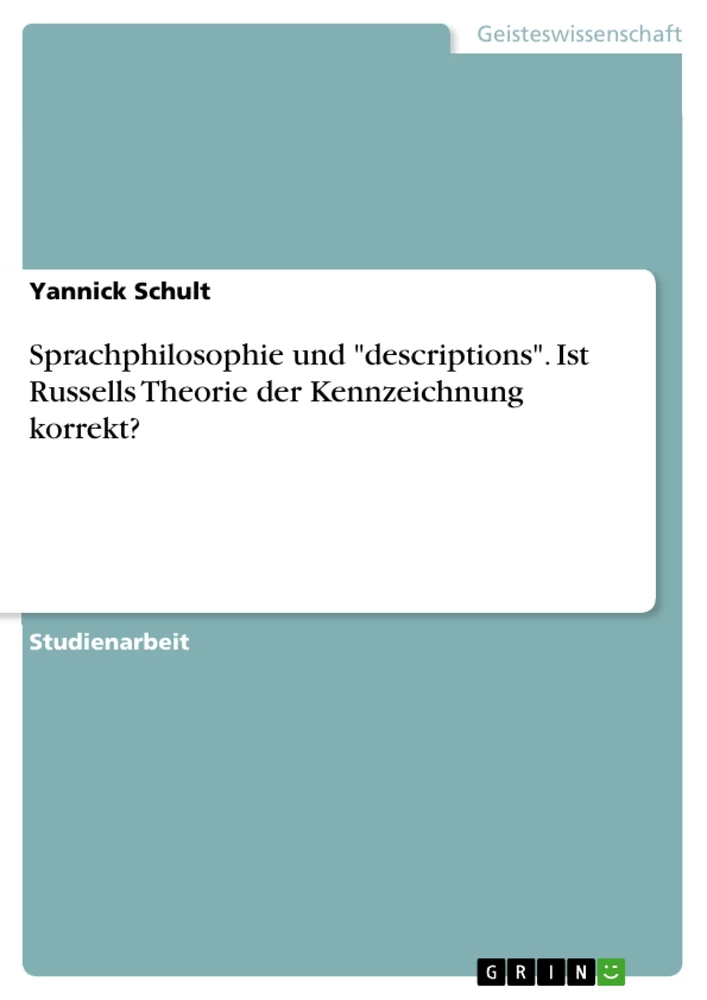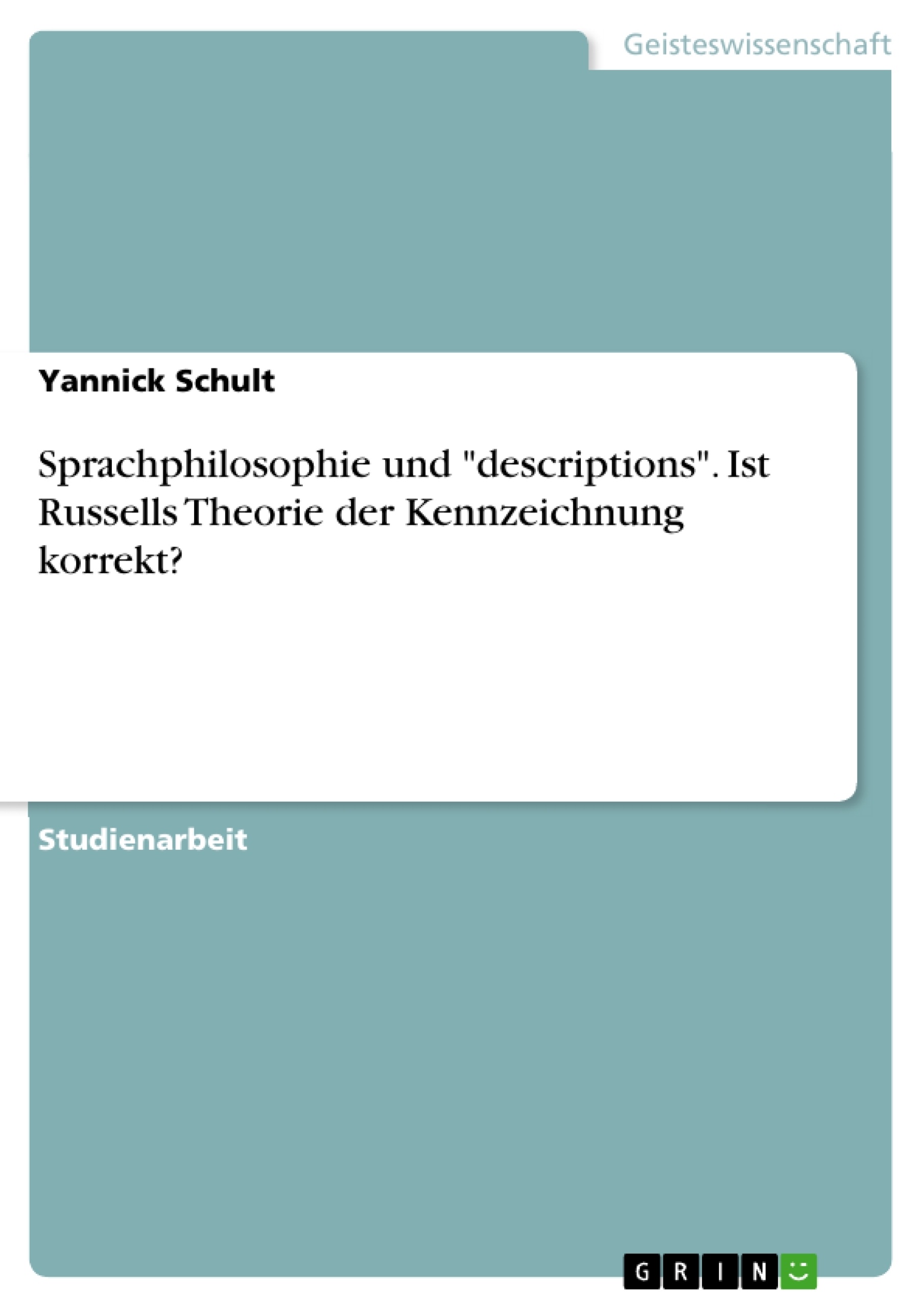Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der Sprachphilosophie auseinander, wobei besonders die Theorie der Kennzeichnungen von Bertrand Russell im Fokus steht. Der Text "On Referring" legte den Grundstein für eine Weiterentwicklung der Theorie zu Kennzeichnungen und hatte einen großen Anteil an der Begründung der modernen analytischen Philosophie, sodass viele modernere Theorien auf diesem Werk basieren.
Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, Russells Theorie zu bewerten und letztendlich zu entscheiden, ob sie zutreffend ist oder nicht. Um dieses Ziel zu erreichen wird die Theorie als solches erläutert und eine Weiterentwicklung und Kritik von Peter Strawson behandelt, um eine andere mögliche Perspektive aufzuzeigen. Zunächst wird in Kapitel 2 die Sprachphilosophie als Teilbereich der Philosophie kurz vorgestellt und einige wenige Grundbegriffe werden erläutert. In Kapitel 3 wird der Kennzeichnungsterm und die Geschichte seiner Entstehung dargestellt, was auch den Text von Russell beinhaltet und seine Analyse in drei unterschiedlichen Teilen. Die Kapitel 4 und 5 beschäftigt sich mit der Kritik und Weiterentwicklung von Russells Arbeit, wozu ebenfalls der Text von Peter Strawson zählt. Im 6. Kapitel schließlich folgt das Fazit mit der abschließenden Evaluierung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachphilosophie und ihre Komponenten
- Kennzeichnungen - Entwicklung des Begriffs
- Bertrand Russell
- Kritik an Russell
- Die drei Arten der Kennzeichnung
- Peter Strawsons Kritik und Weiterentwicklung
- Peter Strawsons „On Referring“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Sprachphilosophie und analysiert insbesondere die Theorie der Kennzeichnungen von Bertrand Russell. Sie zielt darauf ab, Russells Theorie zu bewerten und zu beurteilen, ob sie zutreffend ist. Dazu wird die Theorie vorgestellt und eine Weiterentwicklung sowie Kritik von Peter Strawson analysiert, um eine alternative Perspektive zu beleuchten.
- Sprachphilosophie und ihre Komponenten
- Kennzeichnungen und ihre Entwicklung
- Russells Theorie der Kennzeichnungen
- Kritik und Weiterentwicklung der Theorie
- Bewertung der Theorie von Bertrand Russell
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 gibt einen groben Überblick über die Sprachphilosophie und erläutert einige grundlegende sprachphilosophische Begriffe. Kapitel 3 beleuchtet den Begriff der Kennzeichnung und seine historische Entwicklung, einschließlich Russells Analyse in drei Teilen. Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Kritik und Weiterentwicklung von Russells Theorie, einschließlich des Beitrags von Peter Strawson. Das Fazit in Kapitel 6 evaluiert die Ergebnisse und stellt eine abschließende Beurteilung der Theorie von Bertrand Russell dar.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt zentrale Themen der Sprachphilosophie, insbesondere die Theorie der Kennzeichnungen, die Entwicklung des Begriffs, die Kritik an Russell und die Weiterentwicklung der Theorie durch Strawson. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind Eigenname, Satz, Bedeutung und Sinn.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Russells Theorie der Kennzeichnung?
Bertrand Russells Theorie analysiert Sätze mit Kennzeichnungen (z.B. „Der gegenwärtige König von Frankreich“), um logische Widersprüche bei nicht existierenden Objekten zu lösen.
Was kritisierte Peter Strawson an Russell?
Strawson argumentierte in „On Referring“, dass Russell den Unterschied zwischen einem Satz und dem Gebrauch eines Satzes in einer konkreten Situation missachtete.
Was ist der Unterschied zwischen „Sinn“ und „Bedeutung“?
In der Sprachphilosophie bezieht sich Bedeutung oft auf das Objekt in der Welt, während Sinn die Art und Weise der Gegebenheit dieses Objekts beschreibt.
Warum ist Russells Theorie für die analytische Philosophie wichtig?
Sie legte den Grundstein für die moderne Logik und Sprachanalyse, indem sie zeigte, wie die grammatikalische Form eines Satzes seine logische Form verbergen kann.
Was passiert laut Russell, wenn eine Kennzeichnung auf nichts zutrifft?
Laut Russell ist ein solcher Satz nicht sinnlos, sondern schlichtweg falsch.
- Quote paper
- Yannick Schult (Author), 2020, Sprachphilosophie und "descriptions". Ist Russells Theorie der Kennzeichnung korrekt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1010490