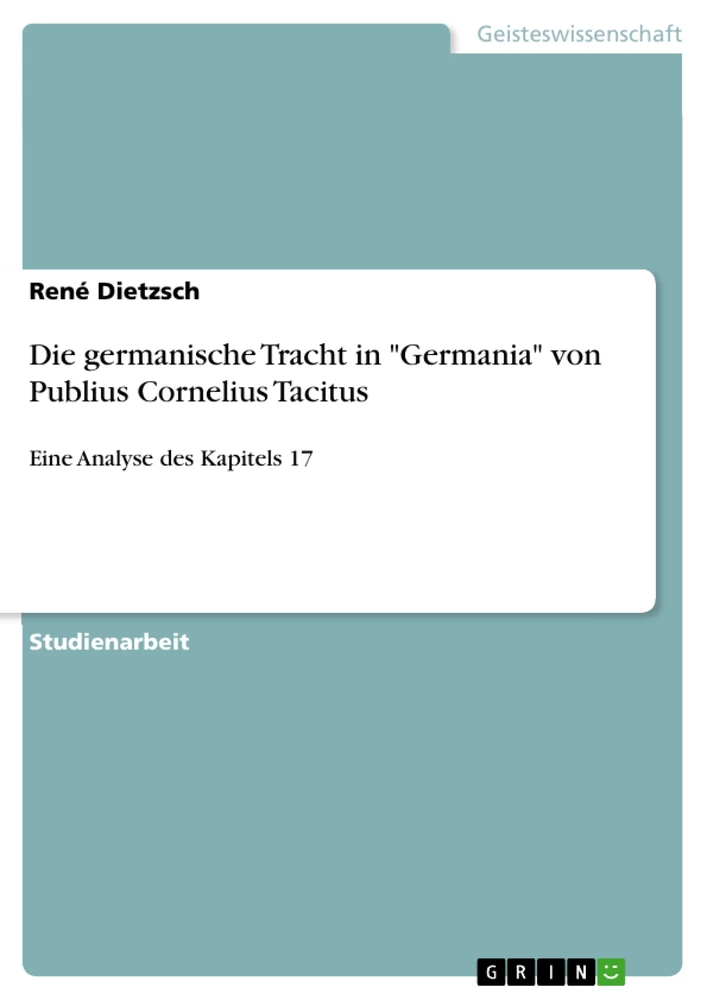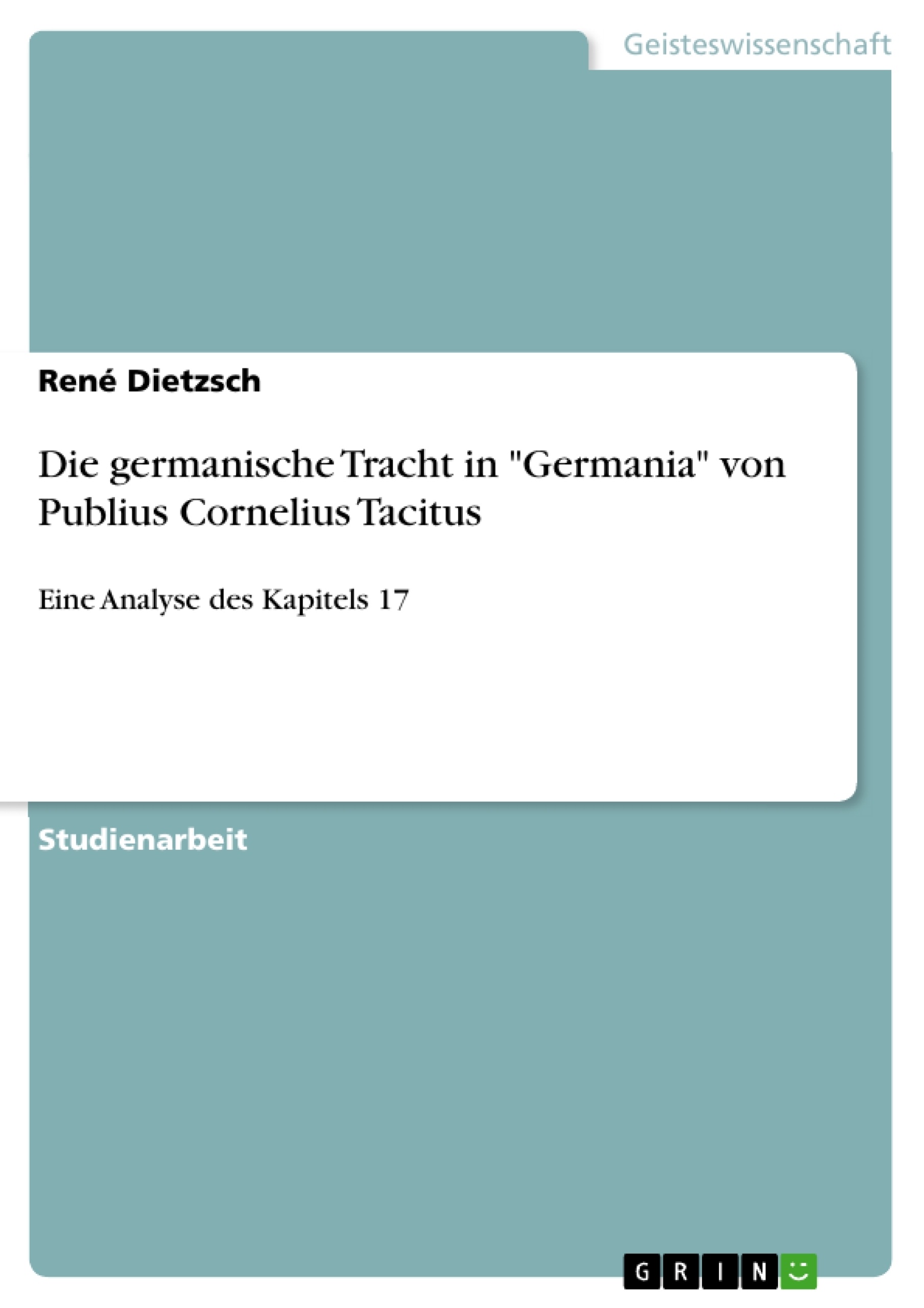In der Arbeit wird das Kapitel 17 der "Germania", in dem Tacitus eine Beschreibung der Kleidung der germanischen Männer und Frauen bietet, einer inhaltlichen Analyse unterzogen. Stilistische Auffälligkeiten wie die Verknüpfung mit vorangehendem und nachfolgendem Kapitel sollen einbezogen werden. Für die inhaltliche Deutung werden die Kommentare von Rudolf Much, Georg Ammon und J. G. C. Andersen herangezogen. An geeigneter Stelle soll der Blick auch auf ausgewählte Werke anderer römischer und griechischer Autoren, die Referenzstellen zum behandelten Kapitel liefern, gerichtet werden. Ein Übersetzungsvorschlag des Kapitels 17 findet sich im Anhang und soll den Abschluss der Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Biografisches zu Tacitus. Generelles zur Germania
- Die Tracht der Germanen in Tacitus' Germania
- Kleidung der Männer
- Kleidung der Frauen
- Materialkunde der germanischen Tracht
- Bedeutungspotenzial des Kapitels 17 und der gesamten Germania
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Kapitel 17 der Germania von Tacitus, welches eine Beschreibung der Kleidung der germanischen Männer und Frauen bietet. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Analyse des Kapitels, wobei stilistische Auffälligkeiten und Verknüpfungen mit vorangehenden und nachfolgenden Kapiteln berücksichtigt werden. Die Arbeit beleuchtet die Darstellung der germanischen Tracht im Kontext der Germania und setzt sie in Beziehung zu den Lebensgewohnheiten, der Kampfweise und den Wertvorstellungen der Germanen.
- Darstellung der germanischen Tracht in Tacitus' Germania
- Vergleich der Kleidung von Männern und Frauen
- Bedeutung der Tracht als Ausdruck von Lebensweise, Werten und Kultur
- Analyse von stilistischen Auffälligkeiten und Verknüpfungen mit anderen Kapiteln
- Einordnung des Kapitels 17 in den Kontext der Germania als Ganzes
Zusammenfassung der Kapitel
Biografisches zu Tacitus. Generelles zur Germania
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Biografie von Tacitus und seinen Kontext als römischer Historiker. Es beleuchtet die Germania als ethnografische Prosaschrift und diskutiert die Quellen und den methodischen Ansatz des Werkes. Die Darstellung der Germanen als ein "fremdes Volk" und die Verwendung von Vergleichspunkten zum römischen Leben werden erörtert.
Die Tracht der Germanen in Tacitus' Germania
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Beschreibung der germanischen Tracht. Es analysiert die Kleidung der Männer und Frauen, wobei die verschiedenen Kleidungsstücke und ihre Materialien im Detail behandelt werden.
Schlüsselwörter
Tacitus, Germania, germanische Tracht, Kleidung, Männer, Frauen, Materialkunde, ethnografie, römische Kultur, Vergleich, Lebensweise, Werte, Kultur, stilistische Auffälligkeiten, Kapitel 17,
Häufig gestellte Fragen
Was beschreibt Tacitus in Kapitel 17 der „Germania“?
Tacitus liefert in diesem Kapitel eine detaillierte Beschreibung der Kleidung und Tracht der germanischen Männer und Frauen.
Welche Materialien wurden für die germanische Tracht verwendet?
Tacitus erwähnt vor allem Felle von Wildtieren sowie Leinen, das oft von Frauen getragen und mit Purpurfarben verziert wurde.
Wie unterschied sich die Kleidung von Männern und Frauen?
Männer trugen oft einfache Mäntel, die mit einer Fibel zusammengehalten wurden. Frauen trugen häufiger leinene Gewänder, die ihre Arme und Teile der Brust frei ließen.
Was war Tacitus' Ziel mit der „Germania“?
Die Schrift diente als ethnografisches Werk, um den Römern ein Bild der germanischen Völker zu vermitteln, wobei er oft deren einfache Sitten als Kontrast zur römischen Dekadenz darstellte.
Welche Kommentare werden zur inhaltlichen Deutung genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf wissenschaftliche Kommentare von Rudolf Much, Georg Ammon und J. G. C. Andersen.
Gibt es eine Übersetzung des Kapitels in der Arbeit?
Ja, ein vollständiger Übersetzungsvorschlag des Kapitels 17 findet sich im Anhang der Arbeit.
- Citar trabajo
- René Dietzsch (Autor), 2007, Die germanische Tracht in "Germania" von Publius Cornelius Tacitus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1010550