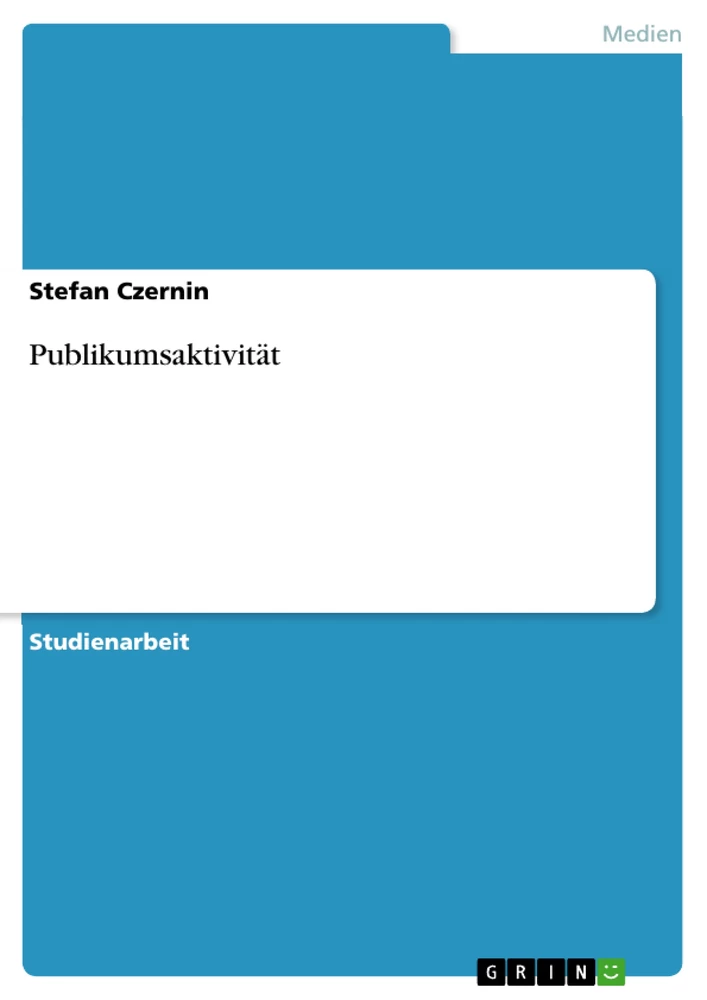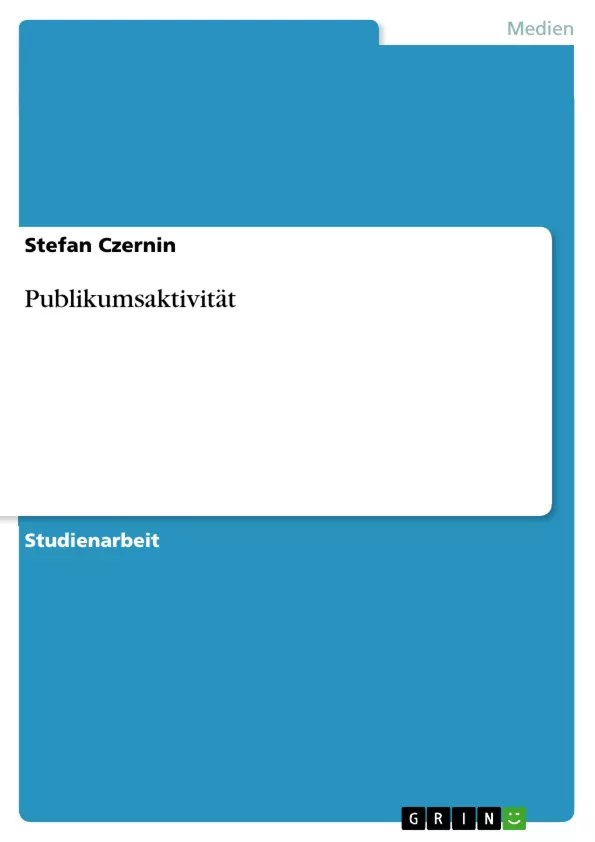Publikumsaktivität
1. Einleitung
Das „ aktive Publikum“ ist elementarer Bestandteil der publikumszentrierten Wirkungsforschung. Was aber bedeutet „ Publikumsaktivität“ und wie äußert sich diese im konkreten Fall? Das sind die beiden Hauptfragestellungen, denen in dieser Arbeit nachgegangen werden soll. Im ersten Teil soll hierbei eine theoretische Hinführung zum Thema versucht werden, während im zweiten Teil am Beispiel der Fernsehnutzung einige Aspekte des „ aktiven Publikums“ kurz aufgezeigt werden sollen. Das Konzept der Publikumsaktivität wird in der Kommunikationsforschung kontrovers diskutiert. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, sollen im dritten Teil exemplarisch einige Kritikpunkte knapp angerissen werden, ohne ihnen in diesem Rahmen allerdings die eigentlich nötige Tiefe zuteil werden lassen zu können.
2. Was heißt „ Publikumsaktivität“?
2.1. Grundannahmen
Das Konzept der Publikumsaktivität ist eng verknüpft mit dem „ uses and gratifications“- Ansatz und einer neuen Perspektive in der Publikums- und Wirkungsforschung. Als Begründung für die Gratifikationsforschung führen Katz und Foulkes, neben Rosengren zwei bedeutende Vertreter dieser Theorie, an: „ It is often argued that the mass media „ give the people what they want“ and that the viewers, listeners, and readers ultimately determine the content of the media by their choices of what they will read, view, or hear. Whether or not this is a valid characterization of the role of the mass in relation to the media, it is only an arc of circular reasoning unless there is independent evidence of what the people do want. More particularly, there is great need to know what people do with the media, what uses they make of what the media now give them, what satisfaction they enjoy, and, indeed, what part the media play in their personal lives.” ( Katz und Foulkes 1962 zitiert nach: Jäckel 1999, S. 71) Stark vereinfacht ausgedrückt, beinhaltet der Kern dieses Ansatzes, dass sich Menschen den Medien freiwillig, absichtsvoll und sinnhaft zuwenden, um bestimmte, subjektive Bedürfnisse zu befriedigen. Nicht länger die Fragestellung „ Was machen die Medien mit den Menschen“ stand im Mittelpunkt der Betrachtung sondern „ Was machen die Menschen mit den Medien?“ ( vgl. Jäckel 1999, S. 69), die Entwicklung wies also in Richtung eines publikumszentrierten Modells.
Dem Publikum wird eine gewisse Eigendynamik, ein Selbstbewusstsein zugebilligt. Das Publikum bzw. die Rezipienten werden nicht länger als weitgehend passiv angesehen, die sich in einer potentiellen Opferrolle befinden und den Medienwirkungen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert sind. Der passive, einer Vielzahl von „ Stimuli“ ausgesetzte Rezipient gewinnt in dieser Perspektive eine aktive Komponente. ( vgl. Schenk 1987, S.369 ff.) Das „ aktive Publikum“ wendet sich Medieninhalten gezielt und motiviert zu, trifft nach individuellen Zielen, Interessen, Bedürfnissen, Werten, persönlichen Einstellungen sowie durch den sozialen Kontext beeinflusst eine Auswahl unter den Medienangeboten.
Renckstorf fasst die Idee vom „ aktiven Publikum“ wie folgt zusammen: „ Massenmediale Aussagen tragen keine Bedeutung in sich, sondern gewinnen diese für den Rezipienten erst im Verlaufe seiner Interpretation; seine Handlungen unterliegen seiner Konstruktion und Kontrolle, werden orientiert an seinen Zielen ( Bedürfnissen und Werten) und seinen gegenwärtigen und gewünschten Erfahrungen mit sozialen ( also: Normen, Rollen und Verhaltenserwartungen) und nicht- sozialen ( also: physische und biologische Hindernisse und Grenzen) Mitteln und Wegen, um diese Ziele zu erreichen ( goal attainment). (...)
In diesem Sinne haben wir davon gesprochen, dass die Rezipienten als die eigentlichen, nämlich die subjektiven Produzenten der handlungsrelevanten Botschaften im Prozess der Massenkommunikation zu gelten hätten, denn erst deren Bedeutungszuweisungen machen die gültige Botschaft aus.“ ( vgl. Renckstorf 1973, S. 190)
In diesem Kontext sei noch das Phänomen der „ selektiven Erinnerung“ kurz erwähnt. Themen sind, wie Renckstorf ausführt, nicht „ interessant“ oder „ bedeutsam“ an sich, sie werden dies vielmehr erst ( oder auch nicht) im Zuge der Sinngebung und Bedeutungs- Zumessung durch die Zuschauer. Die Identifizierung bestimmter Nachrichten als „ relevant“ bzw. „ irrelevant“, die jeweils vor dem Hintergrund der gegebenen Bedürfnis-, Problem- und Interessenlagen erfolgt, beeinflusst Quantität und Qualität der Erinnerungen. ( vgl. Renckstorf 1984, S. 99) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Idee des aktiven Publikums folgende Annahmen zugrunde ( vgl. Schenk 1978, S. 214 f.):
1. Das Publikum der Massenmedien ist aktiv, es besitzt Eigeninitiative und Zielstrebigkeit. Der Rezipient stellt Erwartungen an die Massenmedien. Das aktive Publikum verwendet Medienangebote zur Erreichung bestimmter Ziele.
2. Der Rezipient wird zur Schlüsselfigur, der bestimmt, ob ein Kommunikationsprozess stattfindet oder nicht. Die Zuwendung zu den Medien erfolgt freiwillig. Diese dem Rezipienten zuerkannte Rolle stellt gleichzeitig einen gewissen Schutz für ungewollten Medienwirkungen für diesen dar.
3. Die Massenmedien konkurrieren mit anderen, auch nicht medialen Quellen der Bedürfnisbefriedigung. Dem Bedürfnis nach Entspannung kann beispielsweise durch fernsehen, aber auch durch Sport entsprochen werden. Ein Beleg für die vorhandene Konkurrenz zwischen medialen und nicht- medialen Quellen stellt auch die Beobachtung dar, dass im Sommer, bedingt durch das schöne Wetter, Medien wie das Fernsehen weniger genutzt werden. Welche Quellen, medial oder nicht- medial, sich besonders zur Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses eignen, entscheidet der Rezipient unter subjektiven Gesichtspunkten.
4. Das aktive Publikum ist sich seiner Bedürfnisse, Motive und Ziele bewußt, die es veranlassen die Massenmedien zu nutzen.
Das aktive Publikum wendet sich den Massenmedien bewusst und zielgerichtet zu, um bestimmte Bedürfnisse, wie z.B. dem Wunsch nach Information, Unterhaltung oder der Flucht aus der Alltagswelt ( „escape“), zu befriedigen. Eine umfangreichere Aufzählung möglicher Motive der Mediennutzung befindet sich im Anhang ( vgl. Anhang I.)
2.2. Fünf Typen der Publikumsaktivität
Das dargelegte Konzept von Aktivität unterlag in der Diskussion verschiedenen Auslegungen, wobei u.a. die jeweiligen Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt wurden. In diesem, oben geschilderten Zusammenhang, unterscheidet Biocca fünf Formen der Publikumsaktivität, die in Forschungsliteratur auftauchen. ( vgl. D. McQuail 1994, S. 316)
1. selectivity: Mit Selektivität meint Biocca die Zuwendung bzw. auch die Vermeidung bestimmter Medieninhalte. Sehr starker Mediengebrauch, insbesondere beim Fernsehen, wird in der Regel als „ nicht selektiv“ eingestuft. Der Begriff der Selektivität kann ziemlich weit gefasst werden, was die Frage aufwirft, wann Mediennutzung als selektiv betrachtet werden kann und wann nicht. Auf dieses Problem soll später noch genauer eingegangen werden.
2. utilitariansim: Der Punkt der Nützlichkeit ähnelt dem der Selektivität.
Medienkonsum findet unter rationalen Gesichtspunkten, geleitet durch persönliche Erfahrung zur Erreichung bestimmter Ziele statt. Die Definition der Nützlichkeit beinhaltet Selektivität, aber Selektivität beinhaltet nicht zwangsläufig auch, dass die ausgewählten Medieninhalte auch nützlich sind.
3. intentionality: Laut dieser Definition gilt ein Publikum dann als aktiv, wenn es über die Medien vermittelte Informationen in einem aktiven kognitiven Prozess verarbeitet und auf der Grundlage dieser Basis dann bewusste Entscheidungen trifft.
4. resistence to influence: Dieser von Biocca aufgeführte Punkt orientiert sich am Begriff des „ widerspenstigen Publikums“ (vgl. Jäckel 1999, S.64). Gemeint ist die Fähigkeit, sich gegen ungewollte Medienbotschaften zu schützen. Der Rezipient behält die Kontrolle darüber, welche Medieninhalte er an sich heranlässt und welche nicht. Medieninhalte können einen aktiven Rezipienten nicht beeinflussen, wenn diese Inhalte keinen subjektiven Sinn im persönlichen und sozialen Kontext des Rezipienten besitzen.
5. involvement: Der Begriff der Eingebundenheit beinhaltet u.a. das Gefühl, ein Teil der Handlung zu sein, die Identifikation mit einer Bildschirmfigur oder para- soziale Interaktion, über die später noch mehr gesagt werden soll. Eingebundenheit stellt eine Form der Publikumsaktivität dar.
Levy und Windahl entwarfen ein Schema, mit dessen Hilfe es ihnen gelang, verschiedene Formen von Aktivität im Ablauf einer Rezeptionssituation darzustellen. Dieses Modell soll nachfolgend kurz vorgestellt werden.
2.3. Das Modell von Levy und Windahl
Bei der Darstellung von Publikumsaktivität unterscheiden Levy und Windahl zwischen zwei verschiedenen Dimensionen, die ihrerseits wieder in jeweils drei Kategorien unterteilt werden. So umfasst die qualitative Dimension Selektivität, Involvement und Nützlichkeit, die zeitliche Dimension wird in eine präkommunikative, während der Kommunikation und in eine postkommunikative Phase unterteilt. ( vgl. Bonfadelli 1999, S.165)
Die Abbildung ( vgl. Anhang II.) verdeutlicht das von Levy und Windahl entworfene Schema. Exemplarisch soll an dieser Stelle auf drei Punkte genauer eingegangen werden.
Selektive Auswahl, im Schnittpunkt der Selektivität und der prä- kommunikativen Phase gelegen, meint dann beispielsweise, dass die Individuen unter einer vorgegebenen Anzahl von Medienangeboten auswählen. Diese Wahl ist zielorientiert und stellt ein Ergebnis zwischen individuellen Bedürfnissen, erlernten Erwartungen an Medieninhalte und eigenen Erfahrungen mit bestimmten Medien dar. So nutzt man Fernsehnachrichten um informiert zu sein oder anders ausgedrückt, um das Bedürfnis informiert zu sein zu befriedigen.
Der Punkt Aufmerksamkeit/ Identifikation/ parasoziale Interaktion umfasst den psychologischen Prozess, in diesem der aktive Rezipient versucht erhaltene Nachrichten mit einem subjektiven Sinn zu versehen. Dies geschieht, indem er über die Informationen reflektiert, nachdenkt und gegebenenfalls mit anderen Anwesenden darüber diskutiert.
Es geht also darum, erhaltene Informationen zu verstehen, zu organisieren und zu verarbeiten.
Die Aufmerksamkeit, die ein Individuum einem bestimmten Medienangebot zuteil werden lässt, ist höher, je besser ein Medieninhalt geeignet ist, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen.
Identifikation meint, wie bereits erwähnt, beispielweise das Hineinversetzen des Rezipienten in eine Bildschirmfigur. Ein interessanter Punkt der para- sozialen Interaktion wird als „ talking back“ bezeichnet ( vgl. Levy/ Windahl, S. 56). Als „talkin back“ wird der Umstand bezeichnet, dass Teile des Publikums dazu neigen den im Fernsehen auftauchenden Personen ein gewisses feedback zukommen zu lassen. So werden beispielsweise die Ausführungen eines Nachrichtensprechers kommentiert oder nach einer vergebenen Torchance der glücklose Stürmer beschimpft. Als para- sozial wird diese Form der Kommunikation bezeichnet, weil die angesprochenen Personen auf dem Bildschirm natürlich keine Möglichkeit haben, auf die Äußerungen des Zuschauers in irgendeiner Form zu reagieren. Kommunikation im eigentlichen Sinn findet folglich nicht satt.
Der Schnittpunkt zwischen der qualitativen Dimension Nützlichkeit und der post- kommunikativen zeitlichen Dimension wird von Levy und Windahl mit Themengebrauch/ Meinungsführerschaft bezeichnet. Bestimmte Mitglieder des Publikums richten ihren Medienkonsum gezielt daraufhin aus, wie viel Gesprächsstoff er ihnen liefert. Bestimmte Sendungen, wie zuletzt Big Brother, werden in der Öffentlichkeit, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz lebhaft diskutiert. Um aus solchen Gesprächen nicht ausgegrenzt zu werden, um mitreden zu können, wählen viele Zuschauer gezielt solche Sendungen aus. Ähnlich verhält es sich mit der Meinungsführerschaft. Der ( regelmäßige) Konsum bestimmter Angebote und die Verwendung der darin enthaltener Informationen kann dem Rezipienten die Meinungsführerschaft in einer Gruppe einbringen. Man denke in diesem Zusammenhang insbesondere auch an Musik- und Modesendungen oder auch an Big Brother ( wer gewinnt?/ wer fliegt raus?)
( vgl. Levy/ Windahl 1984, S. 53 ff.)
Einschränkend zum vom Levy und Windahl entwickelten Modell muss erwähnt werden, dass das Publikum keine homogene Masse darstellt und der Grad der Aktivität seitens des Publikums schwankt. Diese mehr oder weniger zeigt sich zum einem im Vergleich von Person zu Person; der eine zeigt sich aktiver in der Mediennutzung, der andere konsumiert eher passiv und weniger gezielt. Zum anderen lässt sich diese Schwankung in der Aktivität auch von Phase zu Phase im zeitlichen Ablauf der Kommunikation bei einer einzelnen Person beobachten. Die Aufmerksamkeit des Rezipienten stellt in der Kommunikationssequenz keine konstante Größe dar. ( vgl. Levy/ Windahl, S. 57f.)
So kann sich eine Nutzer beispielsweise in der ersten Phase durchaus passiv und unselektiv verhalten, um dann zufällig bei einer Sendung hängen zu bleiben. Entwickelt er dann eine gewisse Eingebundenheit wird der Nutzer erst während der eigentlichen Mediennutzung aktiv. Denkbar wäre auch das Beispiel einer Talkshow, auf die der Rezipient zufällig stößt, sie nur beiläufig konsumiert, am nächsten Tag sich aber an einem Gespräch über eben jene Talkshow beteiligt. Die Aktivität wurde sich dann erst in der post- kommunikativen Phase entfalten.
Nachdem nun das Konzept der Publikumsaktivität in allgemeiner Form kurz vorgestellt wurde, soll nun konkret am Beispiel der Fernsehnutzung auf einige Aspekte des aktiven Publikums eingegangen werden.
3. Publikumsaktivität am Beispiel der Fernsehnutzung
3.1. Zuschauertypologie
Inwieweit das Fernsehpublikum als aktiv bzw. passiv angesehen werden kann ist umstritten. Einige Kommunikationswissenschaftler betrachten die Fernsehnutzung und den Großteil des Angebots schlichtweg als zu trivial ( vgl. Zubayr 1996, S. 35f.), um den Publikum eine umfassende Form der Aktivität zuzugestehen. Für sie stellt sich Fernsehnutzung primär als passives sich berieseln lassen dar. Andere sehen durchaus den mündigen, rationalen Nutzer des Fernsehangebots. Ein wichtiger Punkt in diesem Diskurs stellt durchaus auch der Gegenstand dar, wie weit bzw. eng der Begriff der Selektivität, als Indiz für Aktivität, gefasst wird. Es scheint in diesem Zusammenhang also sinnvoll, sich zunächst mit einer Typologie der Fernsehzuschauer auseinanderzusetzen, um herauszufinden, bei welchem Anteil der Rezipienten überhaupt von einer aktiven Nutzung des Fernsehens gesprochen werden kann. Angemerkt werden soll auch noch, dass die hier benutzte Typologie nur eine mögliche darstellt und andere Erhebungen und Unterteilungen durchaus zu anderen Ergebnissen geführt haben.
Fernsehen als Routine, d.h. die Nutzung unterliegt einer gewissen Regelmäßigkeit in der Uhrzeit, gaben 30% der Befragten an; 19% sahen hauptsächlich ungeplant fern, also relativ unabhängig von der Uhrzeit und auch vom Angebot; Fernsehen als Nebenaktivität nutzten 17%; ebenso viele konnten sich in keine der Kategorien einordnen ( mal so, mal so); 3% gaben an, überhaupt nicht fernzusehen.
Nur oder immerhin 24%, also knapp ein Viertel, der Befragten gaben an, nur zu bestimmten Sendungen einzuschalten und danach, falls sie das Angebot nicht länger interessiert, wieder auszuschalten. Bei dieser Gruppe lässt sich also durchaus von einer gewissen Publikumsaktivität sprechen, da diese Rezipienten das Medium Fernsehen gezielt und motiviert zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse einsetzen. ( vgl. Jäckel 1996, S. 216)
In diesem Kontext merkt Jeffres an, dass allein die Entscheidung für eine bestimmte Sendung bereits eine ganz Reihe von selektiven Entscheidungen erfordert, die in der Tabelle Anhang ( vgl. Anhang III.) dargestellt sind.
Es lassen sich zwei Arten von Faktoren unterscheiden, die die Auswahl des Fernsehangebots beeinflussen. Dies sind zum einem inhaltsspezifische Faktoren, zum anderen inhaltsunspezifische Gesichtspunkte. (vgl. Zubayr 1996, S.30 ff.) Inhaltsspezifische Faktoren sind u.a. persönliche Präferenzen wie subjektive Bedürfnisse, Ziele und Motivationen. Das Verlangen nach Information, Unterhaltung oder Ablenkung seien hier kurz erwähnt. Obwohl einige behaupten, Fernsehen diene in erster Linie dazu, das Bedürfnis nach Langeweile zu erfüllen.
Unter die inhaltsunspezifischen Faktoren fällt beispielsweise die Zuschauergruppe, die sich vor dem Fernsehgerät versammelt hat. In einem Mehrpersonenhaushalt muss jeder bei der Auswahl seines Fernsehkonsums Kompromisse eingehen. Die Ehefrau sieht sich dann mit ausgiebigen Fußballübertragungen konfrontiert, während der Ehemann sämtliche Ärzte und Pfleger der Stadtklinik aufzuzählen weiß.
Die Kenntnis des Angebots stellt einen weiteren wesentlichen Faktor bei der Auswahl des Fernsehprogramms dar. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass wir ein Medienangebot nur dann wahrnehmen können, wenn wir wissen das, wann und wo es ausgestrahlt wird. Auch die Zuschauererreichbarkeit schränkt die Selektivität der Rezipienten, unabhängig vom Inhalt, ein. Vielen Menschen ist es unmöglich zu jeder bestimmten Tageszeit fernzusehen, da sie arbeiten oder sonstigen Verpflichtungen nachgehen. Folglich sind sie in der Auswahl des Fernsehprogramms eingeschränkt.
Außerdem ist jedes Publikum natürlich auch in gewisser Weise durch das Medienangebot an sich eingeschränkt. Das Angebot ist vorgegeben und es obliegt dem Rezipienten daraus das für ihn passende auszuwählen.
3.2. Fernsehen als „ Nebenbei- Medium“
Unterstellt man dem Fernsehpublikum eine gewisse Aktivität, setzt dies zwangsläufig voraus, dass die Nutzer dem Programm eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil werden lassen.
Läuft der Fernseher nur als Geräuschkulisse im Hintergrund, wird dieser weder rational noch zielgerichtet genutzt. Dies wäre mit dem Konzept der Publikumsaktivität nicht vereinbar, im Gegenteil, es würde sogar einen klaren Widerspruch darstellen.
Horst Opaschowski vertritt in seinen Untersuchungen die Meinung, dass immer mehr Fernsehzuschauer innerlich abschalten, Aufmerksamkeit und Konzentration der Zuschauer lassen zusehends nach. Opaschowski bezeichnet diese Phänomen als „ innere Abschaltquote“. ( vgl. Opaschowski 1999, S. 31f.)
Die Kluft zwischen Einschaltquote der Geräte und der Abschaltquote der Zuschauer wird größer. Besonders hohe „ innere Abschaltquoten“ weisen laut Opaschowski Game- und Talkshows auf, niedrige Abschaltquoten finden sich hingegen bei Nachrichtensendungen und bei der Übertragung aktueller Sportereignisse.
Die Hauptursachen für die größer werdenden „ inneren Abschaltquoten“ sieht Opaschowski vor allem darin, dass 1. das Fernsehen nichts besonderes, außergewöhnliches mehr darstellt, es ist alltäglich geworden und omnipräsent; 2. damit einhergehend das Fernsehen seinen Ereignis- und Erlebnischarakter zusehends eingebüßt hat; 3. die Fernesehprogramme immer austauschbarer wurden, man denke in diesem Zusammenhang nur an die Gameshow-, Comedy-, oder Talkshow- Inflation; 4. Fernsehkonsum zunehmend ein schlechtes Gewissen hinterlässt, da das Gefühl bleibt Zeit sinnlos verschwendet zu haben und 5. andere Freizeitbeschäftigungen immer wichtiger wurden, als Beispiel sei hier die Fitnesswelle erwähnt. ( vgl. Opaschowski 1999, S.31)
Bedingt durch die hohen „ inneren Abschaltquoten“ ist es nicht weiter verwunderlich, dass fernsehen immer mehr zu einer Nebentätigkeit wird. Die Nutzer beschäftigen sich zunehmend mit anderen parallelen Tätigkeiten währen das Fernsehgerät läuft. So gaben von je 100 Befragten, die am Abend zuvor ferngesehen haben, 24% an sich währenddessen unterhalten zu haben, 24% haben gegessen, 18% gelesen, 17% telefoniert und 8% geschlafen. Als weitere „ beliebte“ Nebentätigkeiten wurden u.a. bügeln oder sich mit den Kindern bzw. Haustieren beschäftigen genannt. ( vgl. Opaschowski 1999, S. 29) Das Fernsehen wird zunehmend in das Alltagsleben integriert. Es dient als Geräuschkulisse während wir essen, lesen, Hausarbeiten verrichten oder uns unterhalten. Fernsehen schlüpft in die Rolle, die früher das Radio einnahm, oft präsent, aber nur selten wirklich beachtet. Diese Tatsache muss auch in der Diskussion, inwieweit das Fernsehpublikums als aktiv bezeichnet werden kann, berücksichtigt werden. Denn dient das Fernsehen primär als „ Bügelbackground“ ( Opaschowski 1999, S. 30) ist die Nutzung nicht mehr sinnhaft, die Aktivität der Rezipienten bliebe auf der Strecke.
4. Kritikansätze am Konzept der „ Publikumsaktivität“
4.1. Das Problem der „ Selektivität“
Selektivität, also die bewusste und zielgerichtete Auswahl von Medienangeboten, gilt als ein entscheidendes Indiz für die Aktivität der Rezipienten. Wie bereits erwähnt, lässt sich dieser Begriff sehr weit fassen. Es stellt sich also die Frage, wann ein Publikum als selektiv bezeichnet werden kann und wann nicht. Gelangweiltes Zapping vor dem Bildschirm wird spontan wohl mehrheitlich als eher passiver Umgang mit dem Medium Fernsehen angesehen werden. Stuft Opaschowski nun das schnelle Wechseln der Kanäle als stillen Protest der Zuschauer am für sie unbefriedigenden Programm ein ( vgl. Opaschowski 1999, S. 33), spricht er dem Publikum damit gleichzeitig ein motiviertes Handeln zu, eben das Üben von Kritik. Jede Handlung erfordert Entscheidung, inwieweit diese unter rationalen Gesichtspunkten gefällt werden, oder sich mehr oder weniger zufällig ergeben, ist nur schwer festzustellen.
Vor diesem Hintergrund bemerkt Biocca: „ It is, by definition, nearly impossible for the audience not to be active.“ ( vgl. McQuail 1994, S. 317
4.2. Der „ allmächtige Nutzer“
Einen weiteren Ansatzpunkt für Kritik an der Idee vom aktiven Publikum stellt die Gefahr da, dass die frühere Annahme vom „ allmächtigen Kommunikator“ durch das Bild vom „ allmächtigen Nutzer“ ersetzt wird. Wie bereits kurz angesprochen gingen die älteren theoretischen Ansätze überwiegend von der Fragestellung aus, was die Medien mit den Menschen machen. Der Rezipient war, laut diesen Theorien, den Medienwirkungen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Das Publikum war Beeinflussungen seitens der Medien weitgehend passiv ausgesetzt, ohne die Möglichkeit wirksame Filter gegen unerwünschte Medieninhalte zu entwickeln. Der „ uses and gratifications“- Ansatz brachte einen Paradigmenwandel mit sich. Nicht länger die Frage „ Was machen die Medien mit den Menschen?“ stand im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Fragestellung „ Was machen die Menschen mit den Medien?“.
Die Idee vom „ allmächtigen Kommunikator“ wurde ersetzt von der Annahme eines mündigen Rezipienten, der durchaus gegen Medieneinflüsse gewappnet ist. Eine Gefahr bei diesem Ansatz besteht nun allerdings darin, das Bild vom mündigen Publikum quasi zu übersteigern, den „ allmächtigen Kommunikator“ durch den „ allmächtigen Nutzer“ zu ersetzen.
Kann man aber davon ausgehen, dass sich die Rezipienten ihrer Bedürfnisse voll und zu jeder Zeit bewusst sind? Kann sich der Nutzer wirklich durch die rationale Auswahl bzw. Vermeidung von Medienangeboten wirkungsvoll gegen bestimmte Einflüsse schützen?
So wenig das Bild des schutzlosen Rezipienten überzeugen kann, der von den Medien mit Reizen und Stimuli „ beschossen“ wird und darauf in nahezu mechanischer Weise reagiert, genauso wenig scheint ein in allen Phasen rationaler und selbstbestimmter Nutzer, der sich komplett gegen Beeinflussungen seitens der Medien abschotten kann, realistisch.
4.3. Einige kritische Studien zur Aktivität des Fernsehpublikums
Goodhart betrachtet in seinen Studien das Auswahlverhalten des Fernsehpublikums kritisch . Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass nur eingeschränkt von einer zielgerichteten Auswahl der Fernsehprogramme durch die Rezipienten gesprochen werden kann. Er belegt dies in seinen Untersuchungen dadurch, dass nur eine sehr geringe Anzahl des Publikums gezielt nur bestimmte Genres bevorzugt. So ist es beispielsweise gleichgültig, ob eine Komödie einer Komödie oder eine Nachrichtensendung einer Komödie folgt- die Zuschauerüberschneidung ist gleich hoch. Fernsehsendungen „ erben“ sozusagen einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Zuschauer aus dem vorangegangenen Programm. ( vgl. Zubayr 1996, S. 41)
Ähnliches bemerkt W. Schulz, wenn er bemerkt, dass „ fernsehen kein selektiv gesteuertes Verhalten ist, sondern eine Gewohnheit, ein Ritual.“ ( W. Schulz, zitiert nach: Jäckel 1996, S. 201)
Auch Vorderer verortet eher eine Kanal- denn eine Genre- Treue wenn er anführt: „ Derartige Phänomen verdeutlichen vielleicht am besten, wie problematisch die Annahme eines allseits aktiv- selektiven Fernsehpublikums ist. Denn die Beeinflussung der Angebotswahl durch die „ Treue“ der Zuschauer zu einem bestimmten Sender spricht für eine weitgehende Unabhängigkeit der Selektion von konkreten Angebot.“
( vgl. Vorderer 1992, S. 68 f.)
Für Webster und Wakshlag gestaltet sich in diesem Sinne die Definition der Aktivität sehr eindeutig: Sie beschreiben Zuschauer dann als aktiv, wenn ihre Fernsehnutzung durch spezielle Programminhalte motiviert ist. Alle anderen Möglichkeiten sind im Sinne der Selektivität passiv. ( vgl. Zubayr 1996, S. 50)
Rubin dagegen unterscheidet zwischen instrumenteller und ritualisierter Fernsehnutzung. Instrumentelle Fernsehnutzung beschreibt eine aktive, zielgerichtete Suche vorwiegend nach Informationssendungen, wohingegen eine habituelle, entspannende und zeitfüllende Fernsehnutzung als ritualisiert bezeichnet wird. Mit Hilfe wiederholt durchgeführter Befragungen wurden diese beiden Typen der Auswahl unterschieden, wobei beachtet werden muss, dass beide Selektionstypen auch bei einer einzelnen Person anzutreffen sind, eine interpersonelle Unterscheidung folglich nicht immer möglich ist. ( vgl. Rubin, S. 66f.)
5. Zusammenfassung
Zur der erwähnten einschränkenden Kritik am „ aktiven Publikum“ scheint dieses Konzept in heutigen modernen Gesellschaften passender. Die Abkehr von der „ linearen Wirkungsperspektive“ ( Schenk 1987, S. 370) ist berechtigt. Umgang mit Medien ist alltäglich geworden und zwar von Kindheit an. Eine passende, unverkrampfte Heranführung an die verschiedenen Medien seitens der Eltern vorausgesetzt, ist der selbstbewusste, kritische Rezipient, der sich selektiv dem Medienangebot zuwendet und für ihn passende Inhalte herausfiltert, durchaus realistisch.
Der „ aktive“ Rezipient ist angesichts der Flut von Informationen mehr denn je gefordert. Insbesondere neue Medien wie das Internet ermöglichen eine zuvor nie dagewesene Chance auf eine Unzahl von Informationen in sehr kurzer Zeit zuzugreifen. Um diese Chance allerdings im angemessenen Rahmen wahrnehmen zu können, ohne das Symptome der Überforderung auftreten, erfordert zwangsläufig die Fähigkeit der Selektivität des Nutzers.
Insbesondere im Internet muss der Rezipient dazu in der Lage sein, glaubwürdige Information, Gerüchte und offensichtliche Falschinformationen auseinanderhalten zu können Die Tatsache, das wohl jeder die Medien, insbesondere das Fernsehen, auch passiv, d.h. unselektiv nutzt, bringt das Bild des mündigen Publikums nicht nachhaltig ins Wanken. Fernsehen als bloße Entspannung kann durchaus passiv konsumiert werden, auch ist es bei der Fülle des heutigen Medienangebots allgemein gar nicht mehr möglich, sämtliche Angebote „ aktiv“ wahrzunehmen.
Jeder Rezipient nutzt die vorhandenen Medienangebote sowohl aktiv als auch passiv. Reine Unterhaltung, sich „ treiben lassen“ in der Medienflut darf als passive Nutzung gelten, was allerdings in keiner Weise ausschließt, das derselbe Nutzer auch fähig ist, in rationaler und zielgerichteter Weise mit den Medien umzugehen, beispielsweise, um an für ihn relevante Informationen zu gelangen.
Literatur:
J.G. Blumler/ E. Katz ( Hrsg.): The Uses of Mass Communication, London 1974
H. Bonfadelli: Medienwirkungsforschung I, Konstanz 1999
M. Jäckel: Wahlfreiheit in der Fernsehnutzung, Opladen 1996
M. Jäckel: Medienwirkungen, Opladen 1999
M.R. Levy/ S. Windahl : Audience activity and gratifications in : Communication Research 11, 1984
D. McQuail: Mass Communication Theory, 3. Auflage, London 1994
H. Opaschowski: Generation @, Hamburg 1999
K. Renckstorf: Alternative Ansätze der Massenkommunikationsforschung: Wirkungsvs. Nutzenansatz in: Rundfunk und Fernsehen 21 1973
K. Renckstorf: Menschen und Medien in der postindustriellen Gesellschaft, Berlin 1984
A.M. Rubin: Ritualized and Instrumental Television Viewing in: Journal of Communication 34
M. Schenk: Publikums- und Wirkungsforschung, Tübingen 1978
M. Schenk: Medienwirkungsforschung, Tübingen 1987
P. Vorderer: Fernsehen als Handlung, Berlin 1992
Häufig gestellte Fragen zu "Publikumsaktivität"
Was ist Publikumsaktivität?
Publikumsaktivität bezeichnet die aktive Rolle des Publikums bei der Auswahl, Nutzung und Interpretation von Medieninhalten. Es geht darum, dass Zuschauer, Zuhörer oder Leser nicht nur passive Empfänger von Informationen sind, sondern Medienangebote bewusst und zielgerichtet nutzen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Was sind die Grundannahmen des Konzepts der Publikumsaktivität?
Die Grundannahmen umfassen:
- Das Publikum ist aktiv, eigeninitiativ und zielstrebig.
- Der Rezipient ist die Schlüsselfigur, die über den Kommunikationsprozess entscheidet.
- Massenmedien konkurrieren mit anderen Quellen der Bedürfnisbefriedigung.
- Das Publikum ist sich seiner Bedürfnisse, Motive und Ziele bewusst.
Welche Typen der Publikumsaktivität gibt es laut Biocca?
Biocca unterscheidet fünf Formen:
- Selektivität (Zuwendung oder Vermeidung von Inhalten)
- Utilitarismus (Medienkonsum unter rationalen Gesichtspunkten)
- Intentionalität (Aktive kognitive Verarbeitung von Informationen)
- Resistenz gegen Beeinflussung (Fähigkeit, sich gegen unerwünschte Botschaften zu schützen)
- Involvement (Gefühl der Eingebundenheit, Identifikation)
Wie stellen Levy und Windahl Publikumsaktivität dar?
Levy und Windahl unterscheiden zwischen einer qualitativen (Selektivität, Involvement, Nützlichkeit) und einer zeitlichen Dimension (präkommunikativ, während der Kommunikation, postkommunikativ).
Was bedeutet "Selektivität" im Kontext der Publikumsaktivität?
Selektivität bezieht sich auf die bewusste Auswahl von Medieninhalten durch das Publikum, basierend auf individuellen Bedürfnissen, Interessen und Erwartungen.
Was bedeutet "parasoziale Interaktion"?
Parasoziale Interaktion beschreibt das Phänomen, bei dem Zuschauer das Gefühl haben, eine Beziehung zu Personen auf dem Bildschirm (z.B. Nachrichtensprecher, Schauspieler) aufzubauen und mit ihnen zu interagieren, obwohl eine echte Kommunikation nicht stattfindet.
Wie äußert sich Publikumsaktivität am Beispiel der Fernsehnutzung?
Publikumsaktivität im Fernsehen zeigt sich in der bewussten Auswahl von Sendungen, der gezielten Nutzung zur Befriedigung von Bedürfnissen (Information, Unterhaltung) und der aktiven Verarbeitung der Inhalte.
Was sind inhaltspezifische und inhaltsunspezifische Faktoren bei der Fernsehauswahl?
Inhaltsspezifische Faktoren sind z.B. persönliche Präferenzen, Bedürfnisse und Motivationen. Inhaltsunspezifische Faktoren umfassen z.B. die Zusammensetzung der Zuschauergruppe und die Kenntnis des Angebots.
Was ist die "innere Abschaltquote" laut Opaschowski?
Die "innere Abschaltquote" beschreibt das Phänomen, dass Zuschauer zwar den Fernseher einschalten, aber innerlich abschalten und dem Programm wenig Aufmerksamkeit schenken.
Welche Kritikpunkte gibt es am Konzept der Publikumsaktivität?
Kritikpunkte umfassen:
- Das Problem der Definition von "Selektivität" (wann ist ein Publikum wirklich selektiv?)
- Die Gefahr, den "allmächtigen Kommunikator" durch den "allmächtigen Nutzer" zu ersetzen (Überschätzung der bewussten Kontrolle des Publikums)
- Studien, die zeigen, dass Fernsehnutzung oft eher Gewohnheit als gezielte Auswahl ist.
Was ist instrumentelle und ritualisierte Fernsehnutzung laut Rubin?
Instrumentelle Fernsehnutzung ist eine aktive, zielgerichtete Suche nach Information. Ritualisierte Fernsehnutzung ist eine habituelle, entspannende und zeitfüllende Nutzung.
Welche Rolle spielt das Internet im Zusammenhang mit Publikumsaktivität?
Das Internet bietet eine nie dagewesene Fülle an Informationen und Möglichkeiten zur Interaktion, erfordert aber auch eine hohe Fähigkeit zur Selektivität und kritischen Bewertung der Inhalte.
- Arbeit zitieren
- Stefan Czernin (Autor:in), 2000, Publikumsaktivität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101116