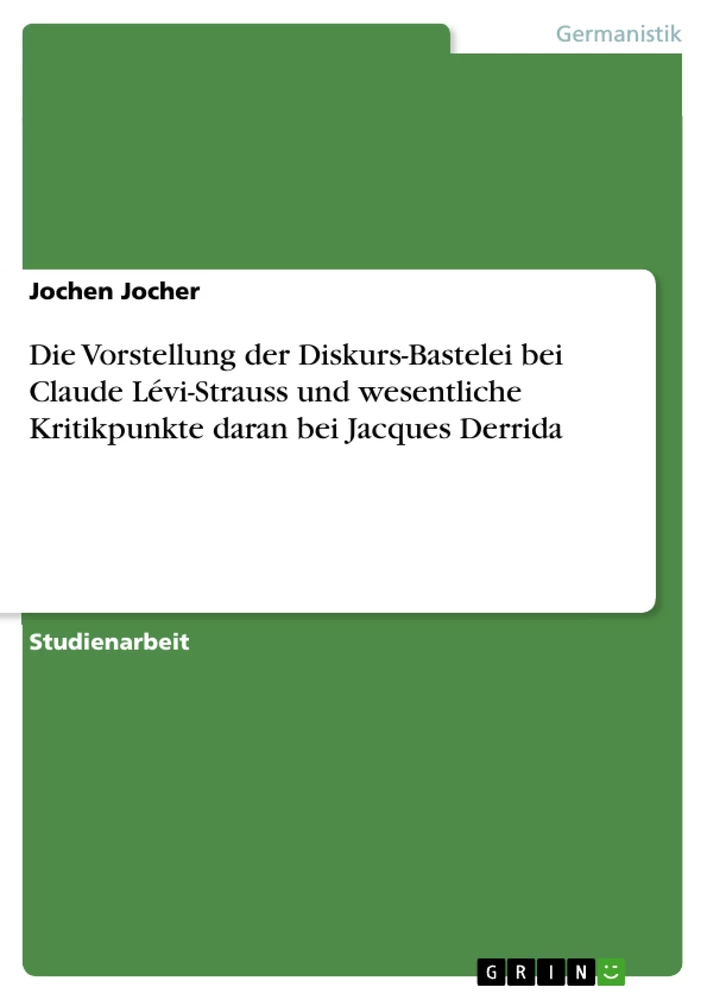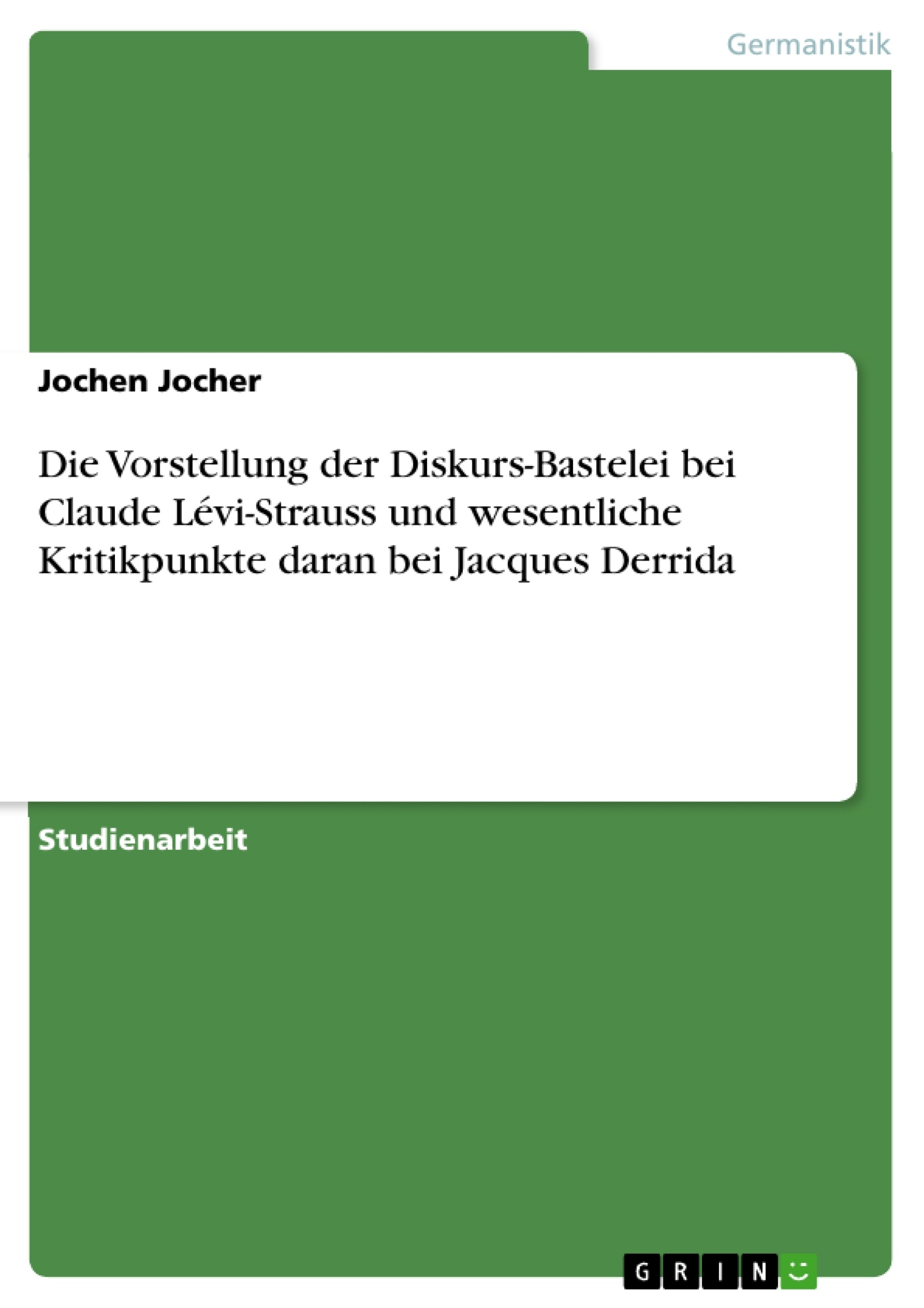Was wäre, wenn die Grundfesten unseres Denkens auf einem Irrtum beruhen? Diese provokante Frage durchdringt die vorliegende Analyse der Auseinandersetzung zwischen Claude Lévi-Strauss und Jacques Derrida über das Konzept der "Bastelei" im Kontext von Strukturalismus und Poststrukturalismus. Lévi-Strauss' Idee der Diskursbastelei, wonach Diskurse aus vorgefundenen, tradierten Sprachelementen zusammengesetzt werden, wird hier einer kritischen Würdigung unterzogen. Die Arbeit beleuchtet, wie Derrida, der Begründer der Dekonstruktion, diese strukturalistische Vorstellung hinterfragt und infrage stellt. Im Zentrum steht Derridas Kritik an der Vorstellung einer Totalisierung der Sprache, die Lévi-Strauss' Konzept zugrunde liegt. Derrida argumentiert, dass die Sprache aufgrund ihres unendlichen Reichtums und des freien Spiels der Elemente nicht vollständig erfasst werden kann. Zudem wird Derridas Einwand gegen den mechanischen Charakter der Bastelei untersucht, der implizit eine Wertung durch die Auswahl der Elemente beinhaltet. Die Arbeit zeigt auf, dass Derrida die Bastelei als eine kritische Sprache versteht, in der die Individualität des "Bastlers" durchscheint. Darüber hinaus wird Derridas Kritik an der mythopoetischen Grundlage der Bastelei analysiert, die auf dem Mythos des Ingenieurs als Schöpfer der Sprache basiert. Derrida argumentiert, dass dieser Mythos unzuverlässig ist, da Mythen prinzipiell ungreifbar und unstetig sind. Diese Gegenüberstellung der beiden Denker eröffnet einen intrigierenden Einblick in die fundamentalen Unterschiede zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus und regt zur Reflexion über die Natur der Sprache und des Denkens an. Eine tiefgreifende Untersuchung für jeden, der sich mit Sprachtheorie, Literaturwissenschaft, Dekonstruktion, Poststrukturalismus, Claude Lévi-Strauss und Jacques Derrida auseinandersetzt. Die Analyse bietet eine prägnante Zusammenfassung von Derridas Kritikpunkten und verdeutlicht die weitreichenden Implikationen für unser Verständnis von Diskursen und der Konstruktion von Bedeutung. Ein Muss für Studierende und Forscher der Geisteswissenschaften, die ein tieferes Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Sprache, Denken und Kultur suchen. Entdecken Sie die feinen Unterschiede und die tiefgreifenden Konsequenzen dieser intellektuellen Debatte, die bis heute nachwirkt.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Begriff der Bastelei bei Claude Lévi-Strauss
3. Wesentliche Kritik durch Jacques Derrida
4. Derridas Kritik im Überblick
1. Einleitung:
In der Literatur des Strukturalismus und des Poststrukturalismus begegnet man immer wieder der Methode der ‘Bastelei’ von Diskursen. Als Begründer oder geistiger Vater dieser Methode gilt Claude Lévi-Strauss; eine ausführliche Darstellung der Bastelei bietet sein Werk „Das wilde Denken”; dort beschreibt Lévi-Strauss die Diskursbastelei als praktisch handwerkliche Methode: Mit ihr ist die Vorstellung verbunden, dass Diskurse aus sprachlichen Elementen zusammengesetzt sind, die jedem Diskursbastler aus der Überlieferung anderer, schon vorhandener Diskurse zur Verfügung stehen.1 Dabei grenzt Lévi-Strauss den Bastler vom Ingenieur ab, denn dieser benutzt keine überlieferten, schon verwendete Bausteine, sondern erschafft sich, um seinen Diskurs zu entwickeln seine Bausteine und damit sein ganzes Sprachsystem selbst. Doch Lévi-Strauss’ strukturalistische Bastelvorstellung wurde besonders in der Phase der Dekonstruktion kritisiert und uminterpretiert. Die Dekonstruktion als literaturwissenschaftliche Methode des Poststrukturalismus, dessen Existenz und Benennung eine selbstkritische Phase des Strukturalismus indizieren,2 lehnt zwar die Bastelvorstellung nicht total ab, problematisiert diese aber und übt - besonders durch den Begründer der Dekonstruktion Jacques Derrida - bedeutsame Kritik am strukturalistischen Bastelbild. Deshalb soll diese Arbeit durch die Gegenüberstellung der Bastelvorstellung bei Lévi-Strauss zu kritischen Anmerkungen Derridas in beschränktem Umfang die Ausarbeitung relevanter Kritikpunkte Derridas an Lévi-Strauss’ Diskursbastelei leisten.
2. Der Begriff der Bastelei bei Claude Lévi-Strauss:
„Nennt man Bastelei die Notwendigkeit, seine Begriffe dem Text einer mehr oder weniger kohärenten oder zerfallenen Überlieferung entlehnen zu müssen, dann muß man zugeben, daß jeder Diskurs Bastelei ist”.3 In diesem Zitat stecken zwei wichtige Aussagen Derridas über Diskurse: Erstens nimmt Derrida die Vorstellung an, dass man um neue Diskurse zu bilden, auf alte Bausteine zurückgreifen müsse, die überliefert sind und schon in Diskursen verwendet wurden. Das heisst also, dass auch für Derrida ein Diskurs zustande kommt, indem er zusammengesetzt wird aus Elementen die auf Tradition basieren. Zweitens gesteht Derrida ein, dass der Gedanke der Zusammensetzung von Diskursen aus Elementen oder Bausteinen der Bastelei, wie sie Lévi-Strauss beschreibt, entspreche. Lévi-Strauss beschreibt den Diskursbastler als Handwerker und dementsprechend die Bastelei von Diskursen primär als eine handwerkliche Arbeit. Der Bastler müsse ständig mit Restbeständen auskommen und aus einer begrenzten Anzahl von Werkzeugen und Bausteinen etwas zusammenbasteln oder zusammentüfteln.4 Die Bausteine oder Materialien sind dabei „heterogen”:5 Das bedeutet, sie sind nicht in ihrem Zweck vorbestimmt, „sondern das zufällige Ergebnis aller sich bietenden Gelegenheiten”6 ; der Bastler setzt also die - aus der Überlieferung in begrenzter Anzahl vorhandenen - Bausteine mehr oder weniger zufällig zusammen, ohne vorher Steine für sein Projekt ausgewählt zu haben; das Ergebnis ist nicht durch die Auswahl der Steine intendiert. Dem Bastler stellt Lévi-Strauss den Ingenieur oder Gelehrten gegenüber, der im Gegensatz zum Bastler aus einem unbegrenzten Repertoire schöpft, da er erst die „Totalität seiner Sprache, Syntax und Lexik konstruieren”7 muss; der Ingenieur wählt also seine Elemente vorausschauend aus, indem er nur bestimmte, auf einen Sinn hingerichtete, Bausteine erschafft und verwendet. Der gebastelte Diskurs dagegen hat nur einen Sinn, der sich aus der Stellung der Bausteine untereinander im abgeschlossenen Diskurs ergibt, und nicht dadurch, dass die Bausteine vorher jeweils mit einem Sinn oder einer Bedeutung durch den Vorgang des Auswählens oder der sinnbestimmenden Zusammensetzung aufgeladen wurden. Denn der Bastler trägt im Basteln dazu bei, „ein Ganzes zu bestimmen, das es zu verwirklichen gilt, das sich aber am Ende von der Gesamtheit seiner Werkzeuge nur durch die innere Disposition der Teile unterscheiden wird.”8 Der Sinn oder die Bedeutung der Elemente und des Ganzen, also die übergeordnete Bedeutung des Diskurses, ergibt sich demnach nur in der Differenzialmethode: Nur durch die Oppositionsstellung der Bausteine zu anderen Bausteinen erhält die Gesamtheit des Diskurses einen Sinn, nicht durch die vorherbestimmende Auswahl. Doch man darf sich die Elemente des gebastelten Diskurses vor ihrem Einsatz nicht als völlig sinn-los vorstellen, denn alle Bausteine, ob für einen spezifischen Diskurs ausgewählt oder nicht, weisen schon, durch die Überlieferung als Teile von Diskursen und somit durch eine bestimmte Verwendung ‘vorbelastet’, auf eine Bedeutung hin. Durch diese individuelle oder „besondere Geschichte jedes Stücks”9 und „durch das, was an Vorbestimmten in [ihnen] steckt”10, bedeutet jedes Einsetzen eines anderen Elementes in einen vorhandenen Diskurs eine völlig veränderte Struktur, einen völlig neuen Diskurs.11 Diese auf Überlieferung beruhende Vorbestimmung der Bedeutung der Elemente, die man auch auf „Zwänge, die einen Zivilisationszustand zum Ausdruck bringen”12, also auf Konventionen, um die Arbitrarität von Zeichen zu bewältigen, zurückführen kann, markiert wiederum einen Unterschied zwischen dem Bastler und dem Ingenieur: Während sich der Bastler logischerweise unter die Zwänge des Zivilisationszustandes unterordnen muß, weil schon eine Bedeutung der Elemente eben durch die Verwendung in überlieferten Diskurse existiert, stellt sich der Gelehrte, oder Ingenieur, über diese Zwänge. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen Kategorien der Materialien, die den beiden zur Verfügung stehen: Der Gelehrte arbeitet mit ‘Begriffen’, deren für die Diskursbildung wesentliche Eigenschaft die der Transparenz bezüglich der Wirklichkeit ist; der Bastler dagegen muß sich mit ‘Zeichen’ begnügen, welche immer schon implizit zulassen und fordern, dass ihr Bezug zur Wirklichkeit durch den Menschen geprägt ist.13 Die Zeichen des Bastlers weisen als Stellvertreter einer Bedeutung also immer schon auf eine Referenz hin. Im Blick auf das Sprachsystem als Ganzes bewirkt der Begriff „die Eröffnung des Ganzen”14 ; hier weist Lévi-Strauss wiederum auf die Aufgabe des Gelehrten hin, sich die Totalität seines Sprachsystem von Grund auf erschaffen zu müssen. Die Bezeichnung des Bastlers hingegen arbeitet mit tradierten Bestandteilen ‘innerhalb’ des Systems, denn der Bastler „erweitert das Ganze nicht, noch erneuert [er] es; [er] beschränkt sich darauf, seine (=des Sprachsystems; d. Verf.) verschiedenen Umwandlungen zu erhalten”.15
Doch Lévi-Strauss setzt in die Bastelvorstellung auch eine hermeneutische Komponente ein: Dadurch, dass sich der Bastler nicht nur mit den Bausteinen als Mittel äußert, sondern sich auch mittels der Auswahl der Bausteine aus seinem begrenzten Repertoire offenbart, legt er etwas von seinem Charakter, von seinem Leben in den Diskurs.16 Der Bastler verleiht seinem Diskurs also eine bestimmte Bedeutung, die sich allerdings wie gezeigt aus Opposition ergibt, durch die Auswahl der Bausteine, die unter Berücksichtigung seiner individuellen Prägung durch seinen Charakter und seine Erfahrung im Sinne der Hermeneutik geschieht. Letztendlich spricht Lévi-Strauss dem Bastler nicht grundsätzlich seine Individualität ab, wie man es vielleicht aus der Gegenüberstellung zum Ingenieur folgern könnte, welcher nicht durch Konventionen eingeschränkt arbeitet. Weiterhin wesentlich für die Idee der Bastelei ist die schon angesprochene Totalisierung des Sprachsystems. Lévi-Strauss zufolge setzt die Bastelei die Totalisierung, also die komplette Erfassung der Sprache als System, voraus,17 da der Bastler alle überlieferten Bausteine kennen müsste, um sie richtig einsetzen zu können. Dies kann durch die Aufteilung des Ganzen, also des Sprachsystems, in Segmente im strukturalistischen Sinne erreicht werden; eine erste Aufteilung vollziehen die gebastelten Diskurse als Modelle des Sprachsystems.18 Der Diskurs als ein vom Menschen gebastelter stellt somit einen Erfahrungswert über das komplette Sprachsystem dar, denn „im verkleinerten Modell [geht] die Erkenntnis des Ganzen [..] voraus”.19 Die Bastelei setzt damit einerseits die Totalisierung der Sprache voraus, andererseits dient sie selbst dieser Aufgabe.
3. Wesentliche Kritik durch Jacques Derrida:
Doch bei der Totalisierung der Sprache setzt ein wichtiger Kritikpunkt Derridas ein. Im Gegensatz zur strukturalistische Sichtweise Lévi-Strauss’ erachtet Derrida die Totalisierung aus verschiedenen Gründen als unnötig und als unmöglich: Schon auf empirischer oder epistemischer Ebene ist die Totalisierung einer Sprache zum einen unnötig, da man, um beispielsweise die Grammatik einer fremden Sprache kennenzulernen, nicht die Gesamtheit der Wörter dieser Sprache verzeichnet haben müsse.20 Zum anderen ist dieses Vorhaben auch als unmöglich zu betrachten, weil der „unendliche Reichtum”21 der Totalität der Sprache sich nicht in einem endlichen Diskurs ausdrücken lassen würde; empirische Methoden und Begriffe würden Derrida zufolge versagen; man würde die Totalisierung nicht bewältigen können, weil es auch „vieles und immer mehr [gibt], als man zu sagen vermag.”22 Aber auch in der dekonstruktivistisch geprägten Begrifflichkeit läßt die Beschaffenheit der Sprache ihre Totalisierung nicht zu: Obwohl das Sprachsystem selbst abgegrenzt ist, gibt es durch das freie Spiel, die freie Bewegung der Elemente in der Endlichkeit unendliche Substitutionen, das heißt unendliche Zuordnungsmöglichkeiten von Signifikanten und Signifikaten, weil das in strukturalistischer Sichtweise noch existierende Zentrum, das die Elemente auf einen übergeordneten Sinn hin ausrichtet, und somit das freie Spiel der Elemente begrenzt, laut Derrida fehlt, beziehungsweise nicht bestimmbar ist.23 Dieses Zentrum ist nun nicht mehr bestimmbar, weil im freien Spiel der Elemente immer wieder ein anderes Zeichen hinzutritt, „welches das Zentrum ersetzt, es supplementiert, in seiner Abwesenheit seinen Platz hält,”24 wodurch das supplementierende Zeichen jeweils noch als Ergänzung zu den anderen Zeichen gesehen werden muß, sodass durch diese Hinzufügung die Menge der Substitutionen ins Unendliche steigt und damit die Totalisierung als komplette Erfassung der Sprache unmöglich macht.25
Doch auch den mechanischen, handwerklichen Vorgang des Bastelns kommentiert Derrida. In der Vorstellung des unperfekten Zusammensetzens von vorhandenen Bausteinen zu einem Diskurs , also „im Bild der Bastelei ist [.] eine Kritik der Sprache erhalten”.26 Derrida meint hier nicht negative Kritik an der Sprache, sondern geht bei ‘Kritik’ von der Grundbedeutung ‘Wertung’ oder ‘Bewertung’ dieses Wortes aus. Die Bastelei selbst ist demnach eine kritische Sprache, also eine wertende Sprache, was nur logisch erscheint, wenn man Lévi-Strauss’ Vorstellung des Bastlers, der zwar zufällig Bausteine auswählt und zusammenbastelt, dabei auch gesellschaftlichen Konventionen unterliegt, aber dennoch zumindest im Unbewußten durch individuelle von anderen Bastlern sich unterscheidende Prägungen die Wahl beeinflusst. Die Kritik als Wertung vollzieht sich also in der Wahl des Bastlers, diesen statt jenen Baustein zu verwenden. Hier akzeptiert Derrida wohl bereitwilliger hermeneutische Aspekte als Lévi-Strauss in seinem Bestreben, die Differenz zum Ingenieur aufrecht zu erhalten.
Lévi-Strauss’ Meinung, dass die Bastelei mythopoetisch sei,27 weil sie auf dem Mythos des Ingenieurs als einem Gelehrten beruht, der sich die Totalität seiner Sprache selbst erschafft und nicht mit überlieferten Segmenten bastelt, bewirkt weitere kritische Anmerkungen Derridas. Derridas Anliegen ist es, aufzuzeigen, wie unzuverlässig ein Mythos als Basis für die strukturalistische Vorstellung der Bastelei ist. Dieser Mythos als Basis ergibt sich aus der Tatsache der Verwendung überlieferter Bausteine; folglich muss die Überlieferung einen Anfangspunkt in der Vergangenheit haben, der nach der Bastelvorstellung nur die schlagartige Erschaffung der Sprache durch einen Ingenieurs- Diskurs sein kann, auf den sämtliche Basteldiskurse reduzierbar sind. Doch der Gedanke der „Einheit des Mythos [ist] nur tendenziell und projektiv, sie spiegelt nie einen Zustand oder Moment wider.”28 Das bedeutet, dass der Mythos als solcher prinzipiell ungreifbar weil unstetig ist; er verändert ständig seine innere Struktur, weil er definitionsgemäß ohne Verfasser existiert.29 Damit unterliegt er in der Weitergabe im Gegensatz zu schriftlichen Dikursen mit Autorrechten unfixiert absichtlichen oder unabsichtlichen Wandlungen, wodurch weder der Mythos eine feste Grundlage für die Apologie oder Selbstlegitimation der Bastler darstellt, noch der Ingenieursdikurs als Bezugspunkt für sämtliche gebastelten Diskurse greifbar oder wiederherstellbar ist.
4. Derridas Kritik im Überblick:
Obwohl Derrida grundsätzlich der Bastelvorstellung zuzustimmen scheint, wie eingangs festgestellt, übt er erhebliche Kritik an der Ausarbeitung dieser Vorstellung bei Lévi- Strauss. Zum Einen erstreckt sich diese Kritik auf die Methode des Bastelns selbst, da diese schon durch die vorbestimmende Auswahl von Elementen eine Wertung impliziert.
Auch durch diese Wertung werden die Bausteine bereits im strukturalistischen Sinne statisch auf den übergeordneten Sinn des Diskurses hin ausgerichtet. Zum Anderen verweist Derrida darauf, dass die Bastelvorstellung im strukturalistischen Sinne auf dem unzureichenden Fundament eines Mythos fußt. Die Analyse eines Mythos beziehungsweise der Mythos selbst sei jedoch in seiner Unstetigkeit eher mit dekonstruktivistischen Vorstellungen vereinbar als mit der strukturalistischen Sichtweise Lévi-Strauss’ und deshalb als Grundlage für die strukturalistische Bastelvorstellung illegitim.
Weiterhin lehnt Derrida die Totalisierung der Sprache in ihrer Zweiseitigkeit als unnötiges und unmögliches Unternehmen ab: Einerseits als Voraussetzung der Bastelei und andererseits als einen Erkenntnisertrag, der aus den gebastelten Diskursen als modellhafte Verkleinerungen des Ganzen gezogen werden könne. Damit erschüttert Derrida nicht nur zwei wichtige Prämissen der Bastelei, sondern auch einen möglichen Sinn oder Gewinn der Bastelvorstellung des Strukturalismus, sodass man sich fragt, inwiefern Derrida der Bastelvorstellung die im Zitat erwähnte Anerkennung zollend diese dekonstruktivistisch ausarbeiten würde, was zu untersuchen jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Literatur
- Derrida, Jacques: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, in: J.D.: Die Schrift und die Differenz. Aus dem Frz. von Rodolphe Gasché, Frankfurt/Main 1976, S. 422-442.
- Lévi-Strauss, Claude: Das wilde Denken. Aus dem Frz. von Hans Naumann, Frankfurt/Main 1997.
- Bolz, Norbert: Strukturalismus, Poststrukturalismus, in: Walter Killy (Hrsg.): Literatur Lexikon, Bd. 14 Begriffe, Realien, Methoden, hrsg. von Volker Meid, München 1993, S. 408-410.
[...]
11 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Aus dem Frz. von Hans Naumann, Frankfurt/Main 1997.
22 Norbert Bolz: Strukturalismus, Poststrukturalismus, in: Walter Killy (Hrsg.): Literatur Lexikon, Bd. 14 Begriffe, Realien, Methoden, hrsg. von Volker Meid, München 1993, S. 408-410, hier S.408.
33 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, in: J.D.: Die Schrift und die Differenz. Aus dem Frz. von Rodolphe Gasché, Frankfurt/Main 1976, S. 422-442, hier S. 431.
44 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 30.
55 ebenda.
66 ebenda.
77 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, S. 431.
88 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 31.
99 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 32.
1010 ebenda.
1111 ebenda.
1212 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 33.
1313 ebenda.
1414 ebenda.
1515 ebenda.
1616 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 34f.
1717 ebenda.
1818 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 37.
1919 ebenda.
2020 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, S. 436.
2121 ebenda.
2222 ebenda.
2323 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, S. 437.
2424 ebenda.
2525 ebenda.
2626 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, S. 431.
2727 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, S. 30.
2828 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, S. 433.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text befasst sich mit dem Begriff der "Bastelei" von Diskursen, wie er von Claude Lévi-Strauss im Strukturalismus vorgestellt wurde, und der Kritik daran durch Jacques Derrida im Poststrukturalismus.
Wie definiert Lévi-Strauss den Begriff der "Bastelei"?
Lévi-Strauss beschreibt die Bastelei als eine handwerkliche Methode, bei der Diskurse aus bereits vorhandenen sprachlichen Elementen zusammengesetzt werden, die aus der Überlieferung anderer Diskurse stammen. Er unterscheidet den "Bastler" vom "Ingenieur", der seine eigenen Bausteine erschafft.
Worin besteht die wesentliche Kritik von Jacques Derrida an Lévi-Strauss' Bastelei-Konzept?
Derrida kritisiert die Vorstellung der Totalisierung der Sprache, die Lévi-Strauss voraussetzt. Er argumentiert, dass die Totalisierung unnötig und unmöglich sei. Weiterhin kritisiert er, dass die Bastelvorstellung auf dem Mythos des Ingenieurs basiert, was Derrida für unzuverlässig hält.
Was ist die Rolle der Überlieferung im Bastelprozess laut Lévi-Strauss?
Die Überlieferung spielt eine zentrale Rolle, da der Bastler auf überlieferte Bausteine zurückgreift. Diese Bausteine sind durch ihre Verwendung in früheren Diskursen bereits "vorbelastet" und weisen auf eine Bedeutung hin. Jedes Element hat eine individuelle Geschichte, die das neu entstehende Gesamtbild maßgeblich prägt.
Inwiefern unterscheidet sich der "Bastler" vom "Ingenieur" nach Lévi-Strauss?
Der Bastler arbeitet mit tradierten Elementen innerhalb eines bestehenden Sprachsystems, während der Ingenieur das gesamte Sprachsystem von Grund auf neu konstruiert. Der Bastler unterliegt den Zwängen der überlieferten Bedeutung der Elemente, während der Ingenieur sich über diese Zwänge hinwegsetzt.
Welche hermeneutische Komponente sieht Lévi-Strauss in der Bastelei?
Lévi-Strauss betont, dass der Bastler durch die Auswahl der Bausteine etwas von seinem Charakter und seiner Lebenserfahrung in den Diskurs einbringt. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Prägung des Bastlers.
Warum lehnt Derrida die Totalisierung der Sprache ab?
Derrida lehnt die Totalisierung sowohl auf empirischer als auch auf begrifflicher Ebene ab. Er argumentiert, dass die Totalität der Sprache sich nicht in einem endlichen Diskurs ausdrücken lasse und dass das freie Spiel der Elemente unendliche Substitutionen ermögliche, wodurch ein festes Zentrum fehlt.
Inwiefern ist die Bastelei laut Derrida eine "kritische Sprache"?
Derrida versteht die Bastelei als eine wertende Sprache, da die Wahl der Bausteine durch den Bastler eine Bewertung impliziert. Die Kritik vollzieht sich in der bewussten oder unbewussten Entscheidung, bestimmte Elemente zu verwenden oder zu verwerfen.
Warum hält Derrida den Mythos des Ingenieurs für unzuverlässig?
Derrida argumentiert, dass der Mythos als solcher prinzipiell ungreifbar und unstetig ist. Er unterliegt ständigen Wandlungen und bietet daher keine feste Grundlage für die strukturalistische Vorstellung der Bastelei.
- Quote paper
- Jochen Jocher (Author), 2000, Die Vorstellung der Diskurs-Bastelei bei Claude Lévi-Strauss und wesentliche Kritikpunkte daran bei Jacques Derrida, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101121