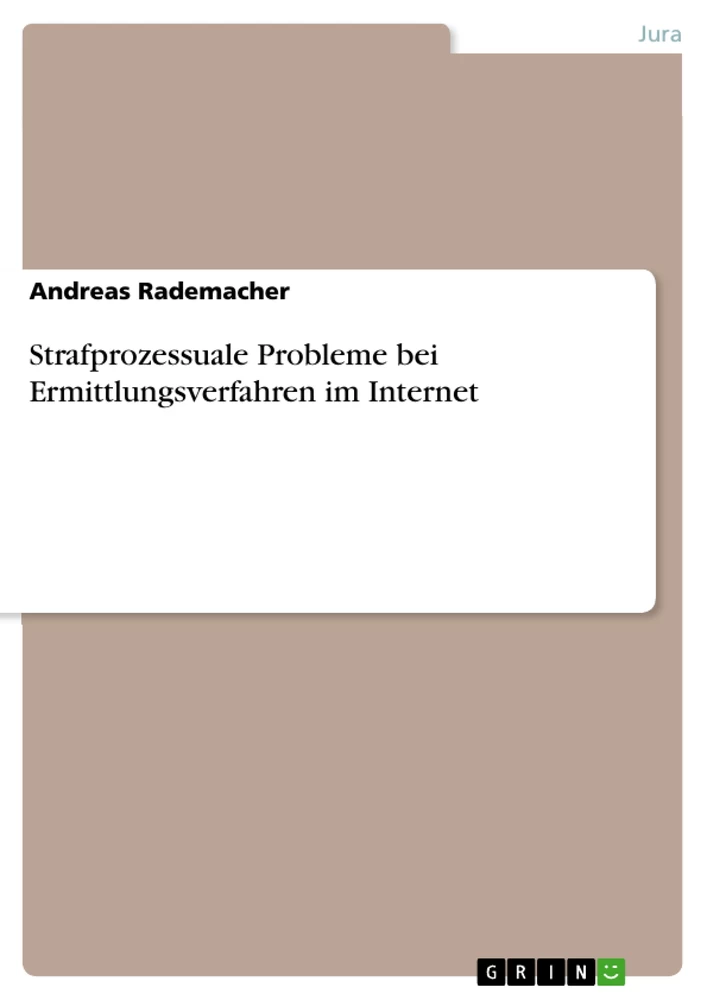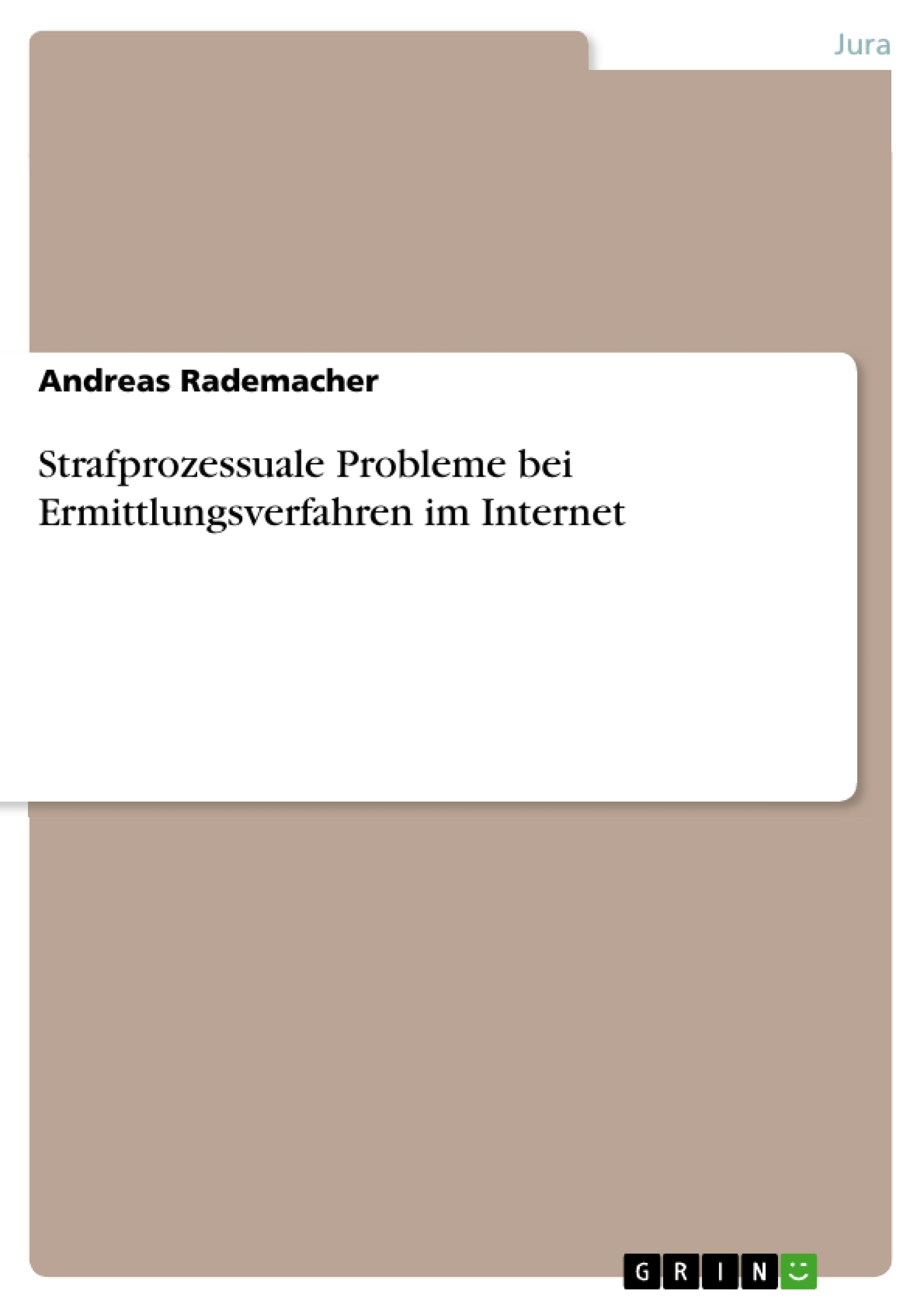A.Einführung
I. Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts
Den ersten Anknüpfungspunkt für die Verfolgung von Straftaten im Internet durch die deutsche Strafrechtspflege stellt das sogenannte "internationale Strafrecht" (§§ 3-9 StGB) dar. Es ist gekennzeichnet durch das Territorialitätsprinzip, das Personalitätsprinzip, das allgemeine Schutzprinzip, daß Weltrechtsprinzip sowie das Prinzip der stellvertretenden Rechtspflege welche im Folgenden kurz erläutert werden sollen.
1. "Internationales Strafrecht"
Das Territorialitätsprinzip (§ 3 StGB) stellt den Kernbereich der Anwendung des deutschen Strafrechts dar. Es bezieht sich auf Handlungen, die - unabhängig von der Nationalität des Handelnden -auf deutschem Staatsgebiet begangen werden. Das Territorialitätsprinzip wird durch das Flaggenprinzip ergänzt, dem zufolge Straftaten, welche auf Schiffen oder Flugzeugen unter deutscher Flagge begangen werden. Hierbei ist zu beachten, daß ein Informationsangebot, welches auf einem ausländischen Server liegt, jedoch mittels einer von der DeNIC vergebenen de-Domain abrufbar ist, nicht dem Flaggenprinzip unterfällt.
Das Personalitätsprinzip (§ 7 II Nr. 1 StGB) bezieht sich auf Handlungen die von deutschen Staatsbürgern - im In- oder Ausland - begangen werden. Hier ist die Anwendung des deutschen Strafrechts jedoch auf die Delikte der Staatsverunglimpfung, der Straftaten gegen die Landesverteidigung und die sexuelle Selbstbestimmung sowie den Schwangerschaftsabbruch und einiger Straftaten von Amtsträgern beschränkt.
Das allgemeine Schutzprinzip (§ 5 StGB) greift ein, wenn inländische Rechtsgüter betroffen sind. Hierbei ist es belanglos, ob es sich um staatliche (Staatsschutzprinzip) oder persönliche (Individualschutzprinzip) Rechtsgüter handelt.
Das Weltrechtsprinzip (§ 6 StGB) ermöglicht die Ahndung von Straftaten gegen Rechtsgüter, die im Interesse aller Kulturstaaten liegen. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung von pornographischen Schriften.
Das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege (§ 7 II Nr. 2 StGB) ermöglicht die Anwendung des deutschen Strafrechts in den Fällen, in welchen die zuständige ausländische Strafrechtspflege aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht tätig werden kann. Es ist jedoch in diesen Fällen erforderlich, daß die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist.
2. Tatort
Da sich die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts maßgeblich an den im Territorialitätsprinzip umschriebenen Umständen orientiert, ist für Straftaten im Internet insbesondere die Frage nach dem Tatort von besonderm Interesse, da sowohl Tathandlung als auch Taterfolg durch die weltweite Verbreitung des Internets überall auf der Welt erfolgen können. Maßgeblich für die Abgrenzung der Zuständigkeit deutscher Strafrechtspflege ist die Ubiquitätstheorie, wonach als Tatort sowohl der Ort der Tathandlung als auch der Ort des Taterfolges in Betracht kommen.
Der Handlungsort ist Deutschland, sofern das Tatobjekt ein Server in Deutschland ist, ein Informationsangebot (z.B. Website) auf einem in Deutschland befindlichen Server gespeichert ist oder von Deutschland aus auf einem ausländischen Server gespeichert wurde. Hier wird der Begriff des deutschen Staatsgebietes durch das "Flaggenprinzip" erweitert.
Die Frage nach dem Erfolgsort erübrigt sich bei den klassischen Erfolgsdelikten (z.B. Zerstörung durch Computerviren). Im Falle der konkreten Gefährdungsdelikte ist der Ort des Taterfolgs mit der örtlichen Zuordnung des konkret gefährdeten Rechtsgutes gleichzusetzen. Wo der Erfolg bei abstrakten Gefährdungsdelikten eintritt ist umstritten. Die h.M. geht davon aus, es gebe bei solchen Delikten nur einen Handlungs-, keinen Erfolgsort. Diese Auffassung ist jedoch zu eng, was zu der zweiten Ansicht, daß der Erfolg überall da eintrete, wo eine Gefährdung möglich sei, geführt haben dürfte. Hinsichtlich der weltweiten Einbindung ins Internet ist diese Auffassung jedoch wiederum zu weit gefaßt. Eine dritte Auffassung geht von einer Umdeutbarkeit der abstrakten Gefährdungsdelikte in Erfolgsdelikte mit überindividuellem Rechtsgut als geschütztem Gut aus. Hierbei ist vor allem relevant, ob die rechtswidrigen Inhalte bzw. Programmfunktionen aktiv mittels sogenannter push-Technologien (insbes. durch Versendung via electronic mail) oder durch pull- Technologien (v.a. Bereitstellung von "Hyperlinks" zu den rechtswidrigen Inhalten) ins Inland verbracht werden. Dieser Ansicht ist zu folgen, da die Verbringung ins Inland durch den willentlichen und aktiven Einsatz von technologischen Möglichkeiten einen subjektiven Bezug des Handelnden zum deutschen Inland aufweist.
I. Delikte mit Bezug zum Internet
Soweit das deutsche Strafrecht anwendbar ist, stellt sich die Frage, nach welchen Normen Handlungen im Internet strafbar sein können. Die in Betracht kommenden Delikte sollen im Folgenden in einem Kurzabriß dargestellt werden. Das Bindeglied zwischen den nun folgenden Abgrenzungskriterien stellt das sogenannte "Hacking" dar. Aus strafrechtlicher Sicht handelte es sich hierbei um das Ausspähen von Daten, § 202a StGB.
1. Straftaten (auch) gegen den "Otto Normalverbraucher"
Der durchschnittliche User befürchtet vor allem die Löschung oder Unbrauchbarmachung seiner Festplatte durch Computerviren oder "Würmer". Die dazu notwendigen Handlungen erfüllen den Tatbestand der Datenveränderung bzw. der Computersabotage, §§ 303a, 303b StGB. Ein derzeit im Internet kaum beachtetes jedoch mit dem Vormarsch der digitalen Signatur in Zukunft wohl bedeutsames Delikt ist die Fälschungen beweiserheblicher Daten, § 269 StGB.
2. Straftaten gegen Unternehmen
Neben den bereits genannten Delikten sind hier vor allem der weit gefaßte Computerbetrug, § 263a StGB, aber auch die Störung von Fernmeldeanlagen, § 317 StGB, zu erwähnen.
3. Straftaten gegen geistiges Eigentum
Hinsichtlich der Umstände und Gebräuche im Internet dürfte bei dieser Gruppe die erste Assoziation die Verletzung von Urheberrechten, § 106 UrhG, sein. Sie liegt bei Vervielfältigung, Verbreiterung und öffentlicher Wiedergabe einer fremden geistigen Schöpfung (§ 2 II UrhG) vor und ist leider im Internet schon nahezu zum Kavaliersdelikt avanciert.
In § 17 UWG ist der Schutz von Betriebsgeheimnissen in zweierlei Hinsicht gewährleistet. Während in Abs. 1 die Tathandlung sehr weit gefaßt ist, der Täterkreis sich jedoch auf die im Betrieb beschäftigten Personen beschränkt, ist Abs. 2 ein Jedermannsdelikt, wobei die Tathandlung - natürlich unter dem Grundsatz der freien Verwertbarkeit - sehr restriktiv auszulegen ist. Die Geheimnisverwertung im Ausland ist durch § 17 IV UWG und die Vorlagenfreibeuterei in § 18 UWG unter Strafe gestellt. In Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 96/9/EG ist die Verletzung Urheberrechts-verwandter Schutzrechte insbesondere bei Datenbanken, § 108 Nr. 8 UrhG, mit Strafe bedroht.
4. Straftaten gegen persönliche Geheimnisse
Die sogenannten Berufgeheimnisse werden in §§ 203 ff. StGB, 43 BDSG geschützt. Es handelt sich dabei um die Mitteilung von persönlichen Geheimnissen in einem weit gefaßten Begriff, welche auch durch Unterlassen (z. B. von Sicherung) begangen werden kann. Allerdings ist der Täterkreis auf die in der Norm genannten Personen, welche von den Geheimnissen berufsbedingt Kenntnis erlangen, beschränkt. Bei diesen Delikt ist die Rechtfertigung durch Einwilligung von besonderer Relevanz.
5. Äußerungsdelikte
Bei der Verbreitung pornographischer Schriften, § 184 StGB, welcher durch die Einfügung des Wortes "Datenspeicher" in Abs. 2 auch im Falle des Internet greift, ist vor allem auf die strafrechtliche Definition der "einfachen Pornographie", welche sittlich provozierend den Menschen als Objekt sexueller Begierde darstellt und der "harten Pornographie", welche Sodomie, Kindesmißbrauch oder Sexualdarstellungen in Verbindung mit Gewaltsverherrlichung darstellt. Im ersten Fall ist ausschließlich die Zugänglichmachung für Jugendliche, im zweiten Fall in jedwede Verbreitung strafbar. Das JÖSChG ist grundsätzlich nicht anwendbar, das GjSM (§§ 3,4,5 GjSM) greift nur einen, wenn die Darstellungen bereits in die Liste aufgenommen sind.
Zuletzt sind noch die Äußerungen zu nennen, welche den demokratischen Rechtsstaat, §§ 86a, 111, 130, 130a StGB 111 OWiG, oder die öffentliche Ordnung, §§ 131, 185 ff. StGB, gefährden. Hier kommen vor allem Äußerungen mit nationalsozialistischem Gedankengut oder Gewaltverherrlichungen in Betracht.
A.Strafprozessuale Probleme aus dogmatischer Sicht
Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Probleme sich bei der Verfolgung von Internet-Straftätern aus dogmatischer Sicht stellen. Die einschlägigen Normen des Strafprozeßrechtes werden im Hinblick auf den Umfang dieser Arbeit vorausgesetzt und nicht näher erläutert.
I. Beweissuche
Hinweise können sich u. U. leicht ergeben, indem sich eine mit der Ermittlung betraute Person mittels eines Gastzugangs in den Memberspace der jeweiligen Website einloggt. Hier wird der Grundrechtseingriff als gering erachtet, da der Content-Provider sich generell mit einer Nutzung des Angebotes durch jedermann einverstanden erklärt hat. Daher sind solche Methoden regelmäßig zulässig. Jedoch sind die Grenzen zwischen einer Nutzung des Angebotes und einer Überwachung des Angebotes hier fließen. Einer Ü berwachung allerdings richtet sich nach § 100a StPO. Demnach ist eine Überwachung nur bei den dort abschließend aufgelisteten sogenannten "Katalogtaten" zulässig. Handelt es sich nicht um eine solche Katalogtat, sind die gefundenen Beweise nicht verwertbar. Für den Internet-Bereich ist hier besonders problematisch, daß "Hacking", Computerbetrug, Computersabotage u. ä. keine Katalogtaten darstellen.
Verdeckte Ermittler können nur eingesetzt werden, wenn andernfalls eine Aufklärung aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre, § 110a StPO. Dies dürfte jedoch unproblematisch sein, da im Falle des § 110a StPO Formfehler nicht zur Unverwertbarkeit der Beweise führen.
II. Beweisbeschaffung
Eine Durchsuchung bei einem Verdächtigen, § 102 StPO, wird überwiegend als unproblematisch erachtet. Soll die Durchsuchung hingegen bei Drittpersonen durchgeführt werden, § 103 StPO, so werden an die Voraussetzungen hohe Anforderungen gestellt. Es müssen Tatsachen vorliegen, die eindeutig darauf schließen lassen, daß bei dieser Durchsuchung sachdienliche Beweise gefunden werden. Die Zulässigkeit eines Online- Zugriffs ist umstritten. Er gilt grundsätzlich als unzulässig, wird jedoch bei geringeren Eingriffen - wie zum Beispiel dem Zugriff auf eine Mailbox - kontrovers diskutiert. Der Ermittlungsrichter des BGH argumentiert, es handle sich hierbei lediglich eine Überwachung der Telekommunikation, räumt aber ein, daß neben den §§ 100a ff. StPO auch die Vorschriften über Durchsuchung und Beschlagnahme einschlägig seien. Die herrschende Literatur sieht in der Vermengung dieser beiden Eingriffsermächtigungen zu Recht die Gefahr einer untragbaren Rechtsunsicherheit. Zudem wird zutreffend auf den Schutzbereich des Art. 10 GG hingewiesen. Nach dieser Ansicht handelt es sich beim Zugriff auf eine Mailbox um eine Überwachung des elektronischen Briefverkehrs, der nicht den strengen Regeln des § 100 a StPO unterfällt, sondern durch Eröffnung des Schutzbereichs von Art. 10 GG wegen mangelnder Rechtfertigung gänzlich unzulässig ist. Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft - regelmäßig Kommissare der örtlichen Polizei - sind lediglich befugt die Beweise vorzusortieren, Kenntnis vom Inhalt dürfen sie sich nicht verschaffen, § 110 StPO. Dies könnte vor allem problematisch sein, sofern in den zu durchsuchenden Datenträgern für directories absichtlich sachfremde Namen vergeben wurden. In der Praxis wird diese Vorschrift jedoch großzügig gehandhabt, so daß sich daraus keine praktischen Probleme ergeben.
Die Durchsuchung führt in einem nächsten Schritt zwangsläufig die Beschlagnahme von Beweisen mit sich. Eine Beschlagnahme darf nur ein Richter durchführen, § 111e StPO. Dies ist jedoch praktisch bedeutungslos, da mit dem Durchsuchungsbeschluß regelmäßig auch gleichzeitig der Beschlagnahmebeschluß gefaßt wird. Ein ernsteres Problem stellen Zeugnisverweigerungsrechte und Presse- bzw. Rundfunkrechte dar. Diese führen im ersten Fall nach § 97 I Nr. 1 StPO, im zweiten nach § 97 V i.V.m. § 53 I Nr. 5 StPO zu einem Beschlagnahmeverbot. Ein Verstoß hiergegen führt zu einem Verwertungsverbot. Strittig ist hierbei, ob Daten, welche teilweise diesen Beschlagnahmeverboten unterlägen, verwendet werden dürfen, soweit sie diesem Beschlagnahmeverbot nicht unterfallen.
III. Aktive Mitwirkungspflichten
Die Staatsanwaltschaft kann sich bei ihren Ermittlungen auf die Mitwirkungspflichten einiger Beteiligten berufen. So trifft die Zeugen eines laufenden Verfahrens eine Aussagepflicht, welche auch die Nennung von Paßwörtern und Codes umfaßt. Gegenüber Betreibern von Mailboxen, Online-Diensten und Internet Service Providern kann die Staatsanwaltschaft Auskunft über bereits erfolgten Fernmeldeverkehr verlangen, § 12 FAG. Dies so erhaltenen Informationen sind im weiteren Verfahren uneingeschränkt verwertbar. Allerdings erstreckt sich die Auskunftspflicht des § 12 FAG nur auf Daten und Umstände, nicht auf den Inhalt der Kommunikation. Zudem wird vom Gesetz ein dringender Verdacht gefordert, daß die erlangten Daten beweisrelevant sein werden. Zudem darf die Auskunft nur über vergangene Kommunikation verlangt werden, also ist bestenfalls jeden Tag eine Anordnung bezüglich des vorangegangenen Tages zu treffen. In der Praxis ist dies freilich nicht praktikabel. Eine Anordnung, die für einen zukünftigen Zeitraum jeweils die Anordnungen für die Auskunft über die bis dahin vergangenen Kommunikationen beinhaltet, also quasi ein Auskunft-Abonnement, wäre die Lösung dieses Problems. Dies wiederum würde jedoch im Ergebnis einer Überwachung der Telekommunikation und somit eine Umgehung der Vorschriften des § 100a StPO darstellen. Zumindest müssen die Betreiber jedoch nach § 90 I TKG Kundendateien führen und diese auch auf Verlangen der Staatsanwaltschaft an diese übermitteln, § 89 VI TKG.
A.Tatsächliche Probleme bei den Ermittlungsverfahren
Viele der dargestellten Problemstellungen sind rein dogmatischer Natur und für die Praxis nicht relevant. Es soll nun dargestellt werden, welche Lösungsansätze tatsächlich praktiziert werden und wo die praktischen Probleme eines tatsächlichen Ermittlungsverfahrens liegen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich großteils auf die Informationen der Staatsanwaltschaft München I.
I. Internationales Strafrecht
Hinsichtlich des "Internationalen Strafrechts" wird seitens der Ermittlungsbehörden die Ansicht vertreten, der Erfolg bei abstrakten Gefährdungsdelikten (regelmäßig der Fall bei Informations-Angeboten auf Websites) trete überall ein, wo die Seite abrufbar sei, also auch im deutschen Rechtskreis. Diese Ansicht "umschifft" zwar das Problem der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts, führt aber in der Praxis in ca. 60% der Fälle zur Einstellung des Verfahrens, da es sich hierbei um - von vorn herein aussichtslose - Anzeigen gegen Unbekannt handelt.
Liegt ein Informationsangebot vor, welches von Deutschland aus gespeichert und für Deutsche bestimmt ist, jedoch auf einem ausländischen Server gespeichert ist, liegt unstreitig die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts vor. Allerdings kann in diesen Fällen keine Ermittlung stattfinden, da dadurch die Hoheitsrechte des betroffenen Staates verletzt würden. Hier bleibt den deutschen Behörden nur der Weg, die Unterstützung des anderen Staates zu beantragen. Dieser Weg ist jedoch aufwendig und daher in den meisten Fällen unverhältnismäßig, so daß die Staatsanwaltschaft auf den goodwill der ausländischen Provider angewiesen ist. Anders liegt der Fall, wenn der ausländische Provider eine Filiale in der Bundesrepublik unterhält. In diesem Fall kann ein FAG-Beschluß ergehen, so daß der Provider gezwungen ist, die Daten herauszugeben.
II. Beweissuche
Im Bereich der Netzwerkfahndung klagt die Praxis vorwiegend über Personalmangel.
III. Beweisbeschaffung
Besonders problematisch ist in der Praxis die Beschaffung der Verbindungsdaten. Zwar muß der Provider diese auf Verlangen an die Staatsanwaltschaft übermitteln (s.o.), jedoch sieht § 90 I TKG nur eine Speicherung der Kundendaten vor, regelt aber nicht die Dauer der Aufbewahrung dieser Daten. Entsprechend kurz sind diese Aufbewahrungszeiträume von den Providern bemessen. Der Provider mit der längsten (internen) Aufbewahrungsanweisung hält die Daten nur 80 Tage bereit. Es liegt auf der Hand, daß dies die Staatsanwaltschaft unter erheblichen zeitlichen Druck setzt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "internationale Strafrecht" im deutschen Rechtssystem?
Das "internationale Strafrecht" (§§ 3-9 StGB) regelt, wann das deutsche Strafrecht auf Straftaten angewendet werden kann, die im Ausland begangen wurden oder ausländische Bezüge haben. Es umfasst das Territorialitätsprinzip, das Personalitätsprinzip, das allgemeine Schutzprinzip, das Weltrechtsprinzip und das Prinzip der stellvertretenden Rechtspflege.
Was ist das Territorialitätsprinzip?
Das Territorialitätsprinzip (§ 3 StGB) besagt, dass das deutsche Strafrecht auf alle Handlungen angewendet wird, die auf deutschem Staatsgebiet begangen werden, unabhängig von der Nationalität des Täters. Dazu gehört auch das Flaggenprinzip für Schiffe und Flugzeuge unter deutscher Flagge.
Was ist das Personalitätsprinzip?
Das Personalitätsprinzip (§ 7 II Nr. 1 StGB) besagt, dass das deutsche Strafrecht auf Handlungen von deutschen Staatsbürgern im In- und Ausland angewendet werden kann. Allerdings ist dies auf bestimmte Delikte beschränkt, wie Staatsverunglimpfung, Straftaten gegen die Landesverteidigung, sexuelle Selbstbestimmung, Schwangerschaftsabbruch und Straftaten von Amtsträgern.
Was ist das allgemeine Schutzprinzip?
Das allgemeine Schutzprinzip (§ 5 StGB) greift ein, wenn inländische Rechtsgüter betroffen sind, unabhängig davon, ob es sich um staatliche (Staatsschutzprinzip) oder persönliche (Individualschutzprinzip) Rechtsgüter handelt.
Was ist das Weltrechtsprinzip?
Das Weltrechtsprinzip (§ 6 StGB) ermöglicht die Ahndung von Straftaten gegen Rechtsgüter, die im Interesse aller Kulturstaaten liegen, wie z.B. die Verbreitung pornographischer Schriften.
Was ist das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege?
Das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege (§ 7 II Nr. 2 StGB) ermöglicht die Anwendung des deutschen Strafrechts, wenn die zuständige ausländische Strafrechtspflege aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht tätig werden kann, vorausgesetzt die Tat ist am Tatort strafbar.
Wie wird der Tatort bei Straftaten im Internet bestimmt?
Bei Straftaten im Internet ist die Frage nach dem Tatort von besonderem Interesse, da Tathandlung und Taterfolg durch die weltweite Verbreitung des Internets überall auf der Welt erfolgen können. Maßgeblich ist die Ubiquitätstheorie, wonach sowohl der Ort der Tathandlung als auch der Ort des Taterfolges als Tatort in Betracht kommen.
Welche Straftaten im Internet sind relevant für den "Otto Normalverbraucher"?
Für den durchschnittlichen User sind vor allem die Löschung oder Unbrauchbarmachung der Festplatte durch Computerviren oder "Würmer" relevant, was den Tatbestand der Datenveränderung bzw. der Computersabotage (§§ 303a, 303b StGB) erfüllt. Auch die Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) ist von Bedeutung.
Welche Straftaten im Internet sind relevant für Unternehmen?
Neben den bereits genannten Delikten sind hier vor allem der weit gefasste Computerbetrug (§ 263a StGB) und die Störung von Fernmeldeanlagen (§ 317 StGB) zu erwähnen.
Welche Straftaten im Internet verletzen geistiges Eigentum?
Vor allem die Verletzung von Urheberrechten (§ 106 UrhG) durch Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe einer fremden geistigen Schöpfung (§ 2 II UrhG) ist im Internet relevant. Auch der Schutz von Betriebsgeheimnissen (§ 17 UWG) und Datenbanken (§ 108 Nr. 8 UrhG) sind von Bedeutung.
Welche Straftaten im Internet verletzen persönliche Geheimnisse?
Die sogenannten Berufsgeheimnisse werden in §§ 203 ff. StGB, 43 BDSG geschützt. Es handelt sich dabei um die Mitteilung von persönlichen Geheimnissen, welche auch durch Unterlassen (z. B. von Sicherung) begangen werden kann. Allerdings ist der Täterkreis auf die in der Norm genannten Personen beschränkt.
Welche Äußerungsdelikte sind im Zusammenhang mit dem Internet relevant?
Die Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184 StGB), insbesondere die Zugänglichmachung für Jugendliche im Falle "einfacher Pornographie" und jede Verbreitung im Falle "harter Pornographie", sowie Äußerungen, welche den demokratischen Rechtsstaat (§§ 86a, 111, 130, 130a StGB 111 OWiG) oder die öffentliche Ordnung (§§ 131, 185 ff. StGB) gefährden, sind relevant.
Welche Probleme stellen sich bei der Beweissuche im Internet?
Hinweise können sich durch Gastzugänge ergeben, wobei der Grundrechtseingriff als gering erachtet wird. Die Überwachung richtet sich nach § 100a StPO, ist aber nur bei den dort aufgelisteten Katalogtaten zulässig, zu denen "Hacking", Computerbetrug und Computersabotage u. ä. nicht gehören.
Unter welchen Umständen können verdeckte Ermittler im Internet eingesetzt werden?
Verdeckte Ermittler können nur eingesetzt werden, wenn andernfalls eine Aufklärung aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre, § 110a StPO.
Welche Probleme stellen sich bei der Beweisbeschaffung im Internet?
Eine Durchsuchung bei Drittpersonen (§ 103 StPO) unterliegt hohen Anforderungen. Die Zulässigkeit eines Online-Zugriffs ist umstritten und gilt grundsätzlich als unzulässig. Die Beschlagnahme von Beweisen darf nur ein Richter durchführen (§ 111e StPO). Es gibt Zeugnisverweigerungsrechte (§ 97 I Nr. 1 StPO) und Presse- bzw. Rundfunkrechte (§ 97 V i.V.m. § 53 I Nr. 5 StPO), die zu einem Beschlagnahmeverbot führen können.
Welche Mitwirkungspflichten gibt es bei Ermittlungen im Internet?
Zeugen haben eine Aussagepflicht, die auch die Nennung von Passwörtern und Codes umfasst. Gegenüber Betreibern von Mailboxen, Online-Diensten und Internet Service Providern kann die Staatsanwaltschaft Auskunft über bereits erfolgten Fernmeldeverkehr verlangen, § 12 FAG. Es gibt Kundendateien die durch die Betreiber geführt werden und diese auch auf Verlangen der Staatsanwaltschaft an diese übermitteln, § 89 VI TKG.
Welche tatsächlichen Probleme gibt es bei Ermittlungsverfahren im Internet?
Es gibt Personalmangel bei der Netzwerkfahndung, zu kurze Aufbewahrungszeiten der Verbindungsdaten durch Provider und lange Wartezeiten bei der Auswertung von Datenträgern.
- Quote paper
- Andreas Rademacher (Author), 2000, Strafprozessuale Probleme bei Ermittlungsverfahren im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101159