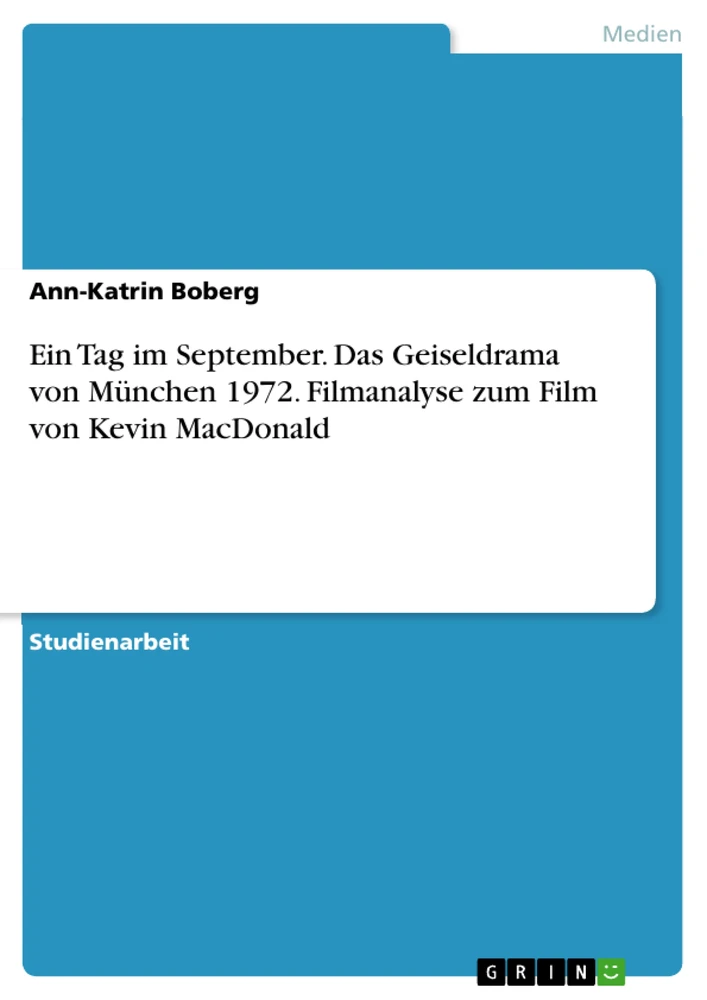Wie genau lässt sich diese Filmsprache in Bezug zu seinem politischen Momentum deuten und was ist rein aus der Position von Macdonald subjektiv eingebracht worden? Wie nähert sich ein britischer Regisseur von Künstlerporträts solch einem Ereignis, welches als eine Antwort / Tat auf den jüdisch-deutschen Konflikt zu werten ist? Es gilt das Verhältnis der eingesetzten Filmaufnahmen in Bezug zum realen Ereignis des Geiseldramas zu analysieren, denn der Film bezieht keine Stellung.
Vielmehr scheint die Dokumentation ein Porträt eines Ereignisses zu sein, ein Porträt, wo die Sache für sich steht. Es liegt also vielmehr an dem Zuschauer, welche Wirkung der Film auf ihn hat oder inwieweit Emotionen ausgelöst werden. Es gibt Stellungnahmen, aber keine Auseinandersetzung, keine Erläuterungen, die das Ereignis inhaltlich untermauern. Die Dokumentation führt ein Eigenleben, dessen Relevanz einer Auseinandersetzung bedarf. So wird anfangs die Filmmittel in seinen Einzelteilen analysiert und in den historischen Kontext gesetzt, um daraufhin sein politisches Momentum zu bewerten, immer in Bezug zum Regisseur und der eingesetzten Filmsprache.
Der 1999 erschiene Dokumentarfilm "Ein Tag im September. Das Geiseldrama München 1972", produziert von Arthur Cohn unter der Regie von Kevin Macdonald, gilt als "Der Bestseller der Zeitgeschichte" und "spannender als jede Thriller".
Wie diese Zitate andeuten, ist Macdonald ein Regisseur, der keine Grenze zwischen Dokumentation und Spielfilm zieht. "Ein Tag im September" setzt sich zusammen aus Archivaufnahmen, Interviewszenen - mit Opfern, Angehörigen der Todesopfer, deutschen und israelitischen Politikern, sowie dem Attentäter Jama Al Gashey und fiktiven Szenen. Diese Zusammensetzung der unterschiedlichen Filmaufnahmen versetzen den Zuschauer unmittelbar zurück nach München, den 5. September 1972.
Die Dokumentation beleuchtet chronologisch den Ablauf von den 21 Stunden Geiseldrama in 95 Minuten. Mittels einer tickenden Uhr wird der Tagesablauf mitsamt der überlieferten Geschehnisse sortiert und von damals Beteiligten, oder Anwesenden, analysiert wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Filmmittel
- Die Sprecher im Film
- Die Fiktion
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Filmanalyse untersucht die Filmsprache des Dokumentarfilms "Ein Tag im September. Das Geiseldrama München 1972" von Kevin Macdonald. Sie analysiert, wie Macdonald die Grenzen des Dokumentarischen überschreitet und die unterschiedlichen Filmmittel – Archivaufnahmen, Interviews, fiktive Szenen – einsetzt, um das Geiseldrama von München 1972 zu schildern.
- Analyse der Filmmittel: Untersuchung des Einsatzes von Archivaufnahmen, Interviews und fiktiven Szenen.
- Bewertung der Filmsprache im Kontext des politischen Moments: Untersuchung des Verhältnisses der Filmmittel zum realen Ereignis.
- Analyse der subjektiven Einflüsse des Regisseurs: Untersuchung, wie der britische Regisseur das Ereignis aus seiner Perspektive darstellt.
- Bewertung des politischen Moments: Untersuchung der Auswirkungen des Films auf das Verständnis des jüdisch-deutschen Konflikts.
- Die Rolle der Musik: Untersuchung der Verwendung von Musik als narrativem Element.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Dokumentarfilm „Ein Tag im September. Das Geiseldrama München 1972“ von Kevin Macdonald gilt als ein Meilenstein in der Zeitgeschichte. Der Film setzt sich aus Archivaufnahmen, Interviews und fiktiven Szenen zusammen, um den Zuschauer unmittelbar nach München, den 5. September 1972, zu versetzen. Die Einleitung stellt den Film und seine Thematik vor und erklärt die Zielsetzung der Analyse.
Die Filmmittel
Der Dokumentarfilm besteht aus zwei Zeitebenen: der Zeitgenössischen (5. September 1972) und der Zeit, als der Film entstand. Die erste Ebene wird mit zeitgenössischen Film- und Fotomaterial, wie Werbefilmen, Fernsehbeiträgen und Fotos von den Olympischen Spielen 1972, sowie Trainings- und Wettkampfbildern der Sportler, bestückt. Die zweite Ebene besteht aus Interviews mit Opfern, Hinterbliebenen, Attentätern und Politikern sowie nachgestellten, fiktiven Szenen. Der Film nutzt Musik als narrative Mittel, um die Emotionen und das Lebensgefühl der Zeit einzufangen.
Schlüsselwörter
Der Dokumentarfilm „Ein Tag im September. Das Geiseldrama München 1972“ von Kevin Macdonald befasst sich mit den Themen Terrorismus, Geiselnahme, Olympische Spiele, Geschichte, Erinnerung, Politik und Filmsprache. Die Analyse konzentriert sich auf die Filmmittel, das politische Momentum und die subjektiven Einflüsse des Regisseurs.
- Citation du texte
- Ann-Katrin Boberg (Auteur), 2017, Ein Tag im September. Das Geiseldrama von München 1972. Filmanalyse zum Film von Kevin MacDonald, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011633