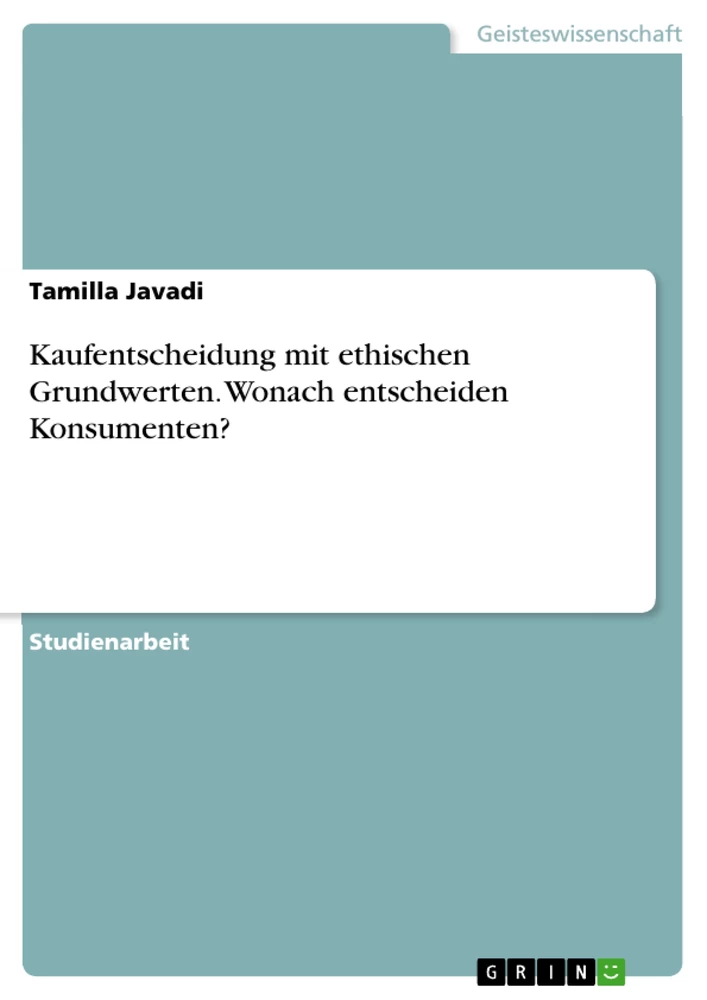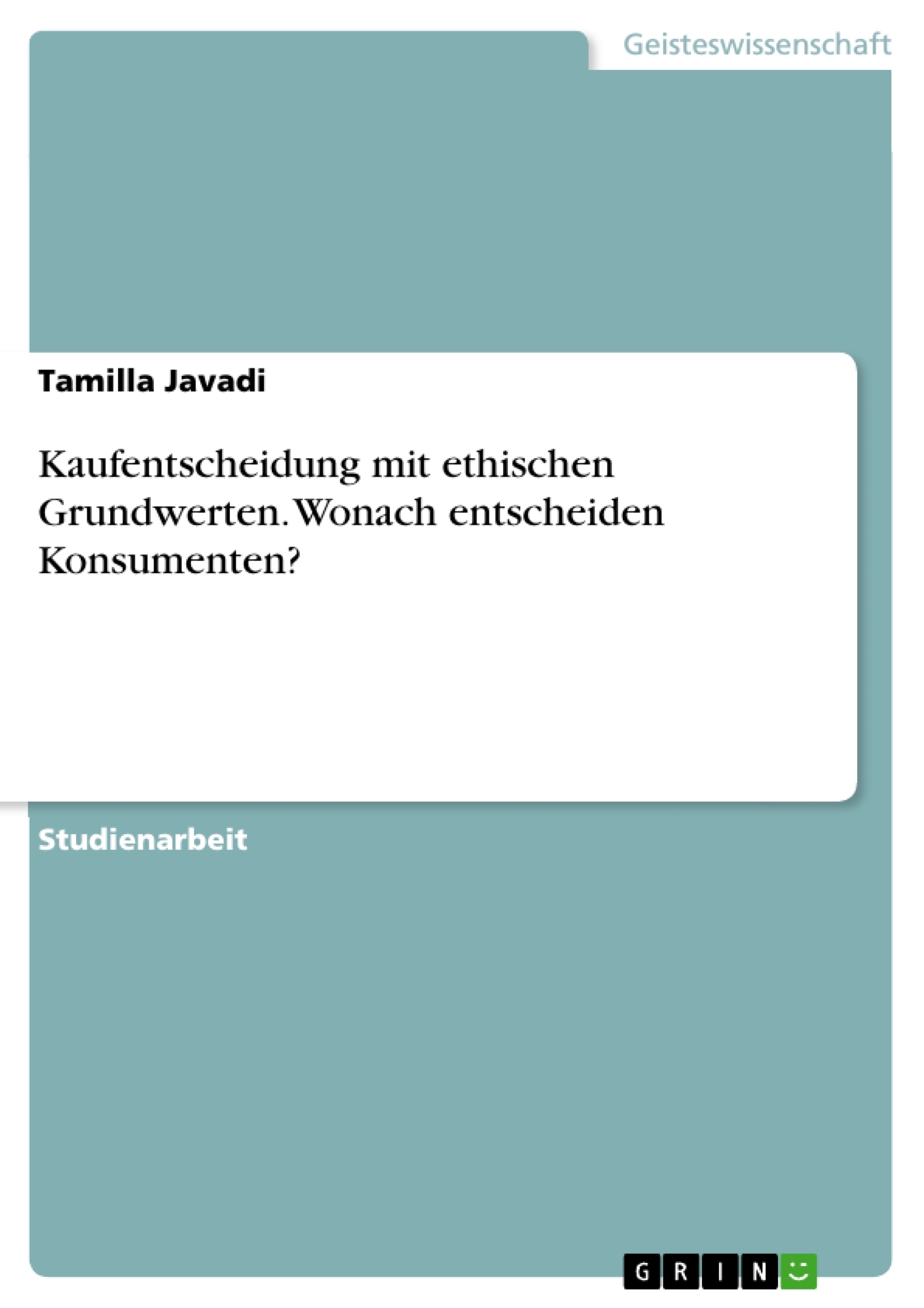Diese Arbeit untersucht die Frage: "Inwiefern entscheiden Konsumenten nach ethischen Standards bei Labeln?"
Ethischer Konsum ist populär. Die boomende Bewegung wird assoziiert mit einer modernen, Umwelt schonenden und altruistischen Weltanschauung. Durch diese ´Mainstream´ Bewegung, die von der raschen Globalisierung angetrieben wurde, gründeten sich gegen das Jahr 1950 Fair-Trade und weitere Öko Label, deren Ziel es ist benachteiligten Arbeitern und Produzenten faire Löhne für ihre Arbeit zu zahlen. Zudem wird beabsichtigt, sichere Arbeits- und bessere Handelsbedingungen zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Thesen
- 2. Extrinsische Motivation: Eco-label effect und Social desirability
- 3. Intrinsische Motivation und ethische Grundwerte: theory of planned behaviour.
- 4. Tatsächliches ethisches Kaufverhalten: ethical consumption intention-behavior gap
- 5. Fazit und Limitationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern Konsumentenentscheidungen durch ethische Labels beeinflusst werden und welche Art von Konsumenten aus welchen Gründen ethisch konsumiert. Dabei wird der Einfluss von Ökolabeln auf das Konsumverhalten beleuchtet. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, welche Faktoren die Entscheidung für oder gegen ethische Produkte beeinflussen.
- Einfluss des „Eco-label-Effects“ auf das Konsumverhalten
- Rolle der „Social Desirability“ bei Kaufentscheidungen
- Bedeutung von intrinsischen Motivationen und ethischen Grundwerten
- Untersuchung der „intention-behaviour gap“ im Kontext ethischen Konsums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Thesen
Die Einleitung stellt den Kontext ethischen Konsums vor und führt die drei zentralen Thesen der Arbeit ein. Die Thesen befassen sich mit der Rolle des „Eco-label-Effects“, der intrinsischen Motivation und dem „intention-behaviour gap“ im Kontext ethischen Konsums.
2. Extrinsische Motivation: Eco-label effect und Social desirability
Dieses Kapitel behandelt die extrinsische Motivation von Konsumenten, ethisch zu konsumieren. Es untersucht den Einfluss des „Eco-label-Effects“ und die Rolle der „Social Desirability“ bei Kaufentscheidungen.
3. Intrinsische Motivation und ethische Grundwerte: theory of planned behaviour.
Kapitel 3 befasst sich mit der intrinsischen Motivation von Konsumenten. Es wird die „Theory of Planned Behaviour“ vorgestellt und auf die Rolle von moralischen Normen, ethischer Selbstidentität und Wissen über fairen Handel für die Konsumentscheidung eingegangen.
4. Tatsächliches ethisches Kaufverhalten: ethical consumption intention-behavior gap
Dieses Kapitel untersucht die „intention-behaviour gap“ im Kontext ethischen Konsums. Es wird analysiert, warum die Absicht zu ethischem Konsum nicht immer zu tatsächlichem Kaufverhalten führt.
Schlüsselwörter
Ethischer Konsum, Ökolabel, Fairtrade, Eco-label-Effect, Social Desirability, Intrinsische Motivation, Theory of Planned Behaviour, Intention-Behaviour Gap, Ethical Consumption Intention-Behaviour Gap, Impression Management, Umweltschutz, Soziale Anerkennung, Moral, Einstellung, Identitätsvorstellungen, Nachhaltige Produktion, Handelsgerechtigkeit, Konsumentenverhalten
- Quote paper
- Tamilla Javadi (Author), 2020, Kaufentscheidung mit ethischen Grundwerten. Wonach entscheiden Konsumenten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011718