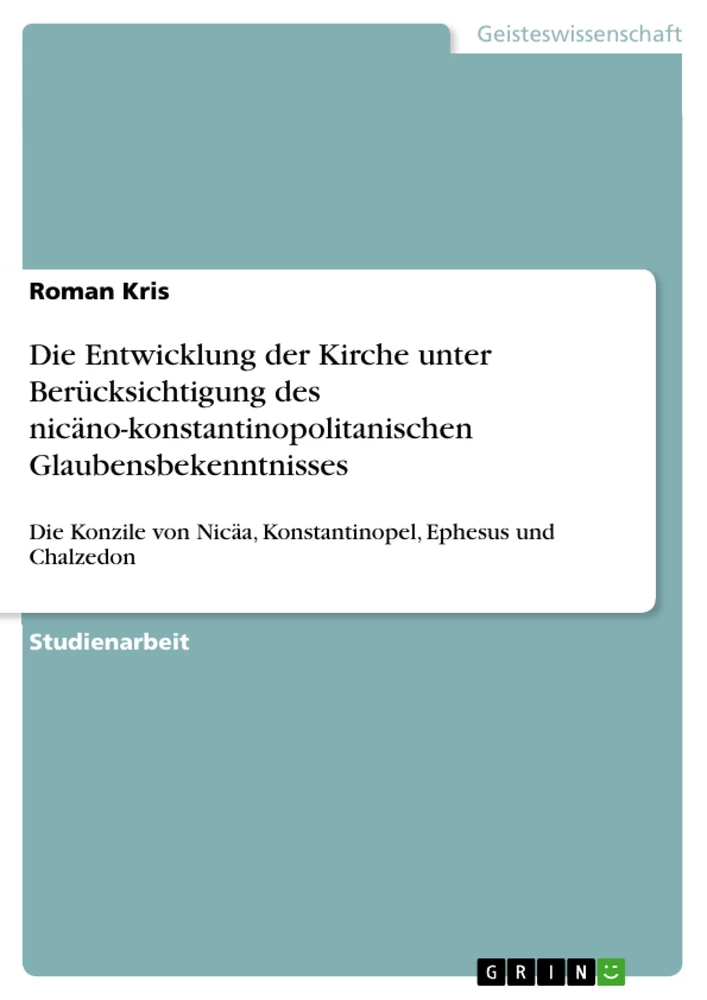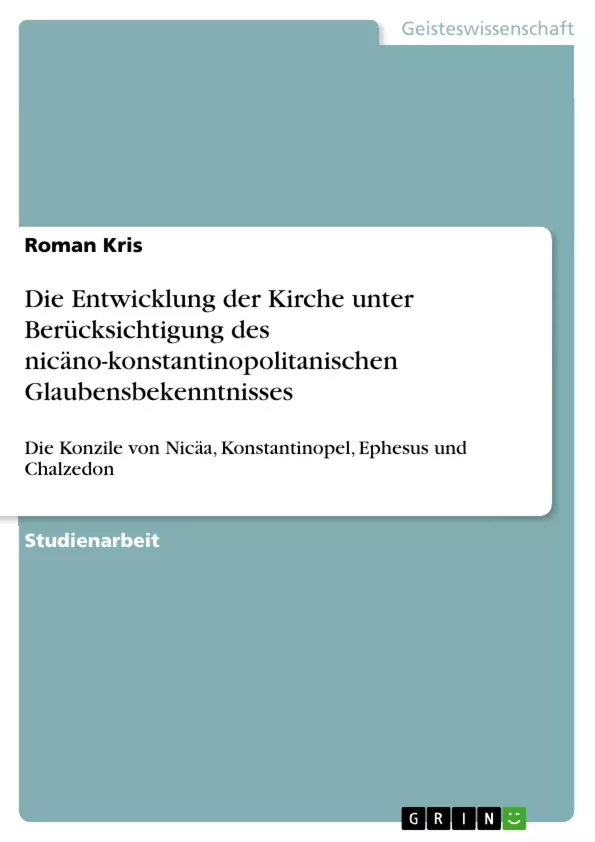Diese Arbeit hat das Ziel, die Entstehung der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten unter der besonderen Berücksichtigung des nicäno-konstantinopolitanischen Symbolums aufzuzeigen.
Der Fokus liegt überwiegend auf der kurzen Auseinandersetzung mit den vier ökumenischen Konzilen: Konzil von Nicäa (325), das Konzil von Konstantinopel (381), das Konzil von Ephesus (431) und das Konzil von Chalzedon (451). Des Weiteren wird auch auf die christologischen und trinitätstheologischen Entwürfe eingegangen.
Das lateinische Nomen concilium, das vielleicht vom Verbum calare = "rufen" und der Präposition cum = "zusammen" gebildet ist, bezeichnet im klassischen Wortsinn das bewirkte Zusammenkommen einer Gruppe von Menschen, beispielsweise an einem Verein oder bei einer Versammlung eines nicht römischen Volksstammes. Somit ist der Ursprung des Wortes "Konzil" aus dem lateinischen Sprachgebrauch von concilium zu Konzil übergegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Konzil: Bedeutung und ökumenischer Charakter
- Christologische und trinitätstheologische Entwürfe der ersten drei Jahrhunderte
- Konzil von Nizäa: Arianischer Streit, Symbolum Nicänum
- Das Konzil von Konstantinopel und die Beendigung des trinitarischen Streits
- Christologische Modelle der zweiten Hälfe des 4. Jh. und der Ursprung des Streites um Nestorius
- Der Streit um Nestorius und das Konzil von Ephesus
- Der Streit um Eutyches, Monophysitismus und die Räubersynode
- Die Räubersynode
- Konzil von Chalzedon
- Das Glaubensbekenntnis
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat das Ziel, die Entstehung der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten unter besonderer Berücksichtigung des nicäno-konstantinopolitanischen Symbolums aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den vier ökumenischen Konzilen: Konzil von Nicäa (325), Konzil von Konstantinopel (381), Konzil von Ephesus (431) und Konzil von Chalzedon (451). Darüber hinaus werden die christologischen und trinitätstheologischen Entwürfe beleuchtet. Der historische Verlauf der Entstehung wird anhand von markanten Ereignissen, darunter Konzile, Synoden, politische und kaiserliche Entscheidungen, chronologisch nachvollzogen. Zu Beginn wird kurz erläutert, was ein Konzil ist und welche Voraussetzungen es erfüllen muss, um als ökumenisch bezeichnet zu werden.
- Entstehung der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten
- Die vier ökumenischen Konzile
- Christologische und trinitätstheologische Entwürfe
- Definition und Bedeutung von Konzilien
- Der historische Verlauf der Kirchenentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beschreibt den Fokus und die Zielsetzung der Arbeit, welche die Entstehung der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten unter Berücksichtigung des nicäno-konstantinopolitanischen Symbolums beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die vier ökumenischen Konzile und die christologischen sowie trinitätstheologischen Entwürfe. Zudem wird ein kurzer Überblick über den historischen Ablauf und die Bedeutung von Konzilien gegeben.
Was ist ein Konzil: Bedeutung und ökumenischer Charakter
Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung und den Charakter von Konzilien. Es wird auf den Ursprung des Begriffs "Konzil" im lateinischen Sprachgebrauch eingegangen und die Entwicklung von kleinen Synoden zu den großen ökumenischen Konzilen dargestellt. Die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Konzils als "ökumenisch" werden erläutert, wobei die Unterscheidung zwischen den von der orthodoxen Kirche anerkannten sieben Konzilien und anderen Konzilen hervorgehoben wird.
Christologische und trinitätstheologische Entwürfe der ersten drei Jahrhunderte
Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen christologischen und trinitätstheologischen Modelle der ersten drei Jahrhunderte. Es wird auf die verschiedenen Versuche eingegangen, die Sendung und das Wesen Christi zu formulieren, darunter die Engelschristologie, der Subordinatianismus und der Monarchianismus. Die unterschiedlichen Modelle und ihre Auswirkungen auf die Frage der Gottessohnschaft Jesu und die Einheit Gottes werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten, wobei die ökumenischen Konzile und insbesondere das nicäno-konstantinopolitanische Symbolum im Zentrum stehen. Die zentralen Themen sind die Entwicklung des christlichen Glaubens, die christologische Frage, die Trinitätslehre, die Geschichte von Konzilen und Synoden sowie die Auseinandersetzung mit verschiedenen theologischen Strömungen und Häresien.
- Quote paper
- Roman Kris (Author), 2019, Die Entwicklung der Kirche unter Berücksichtigung des nicäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011948