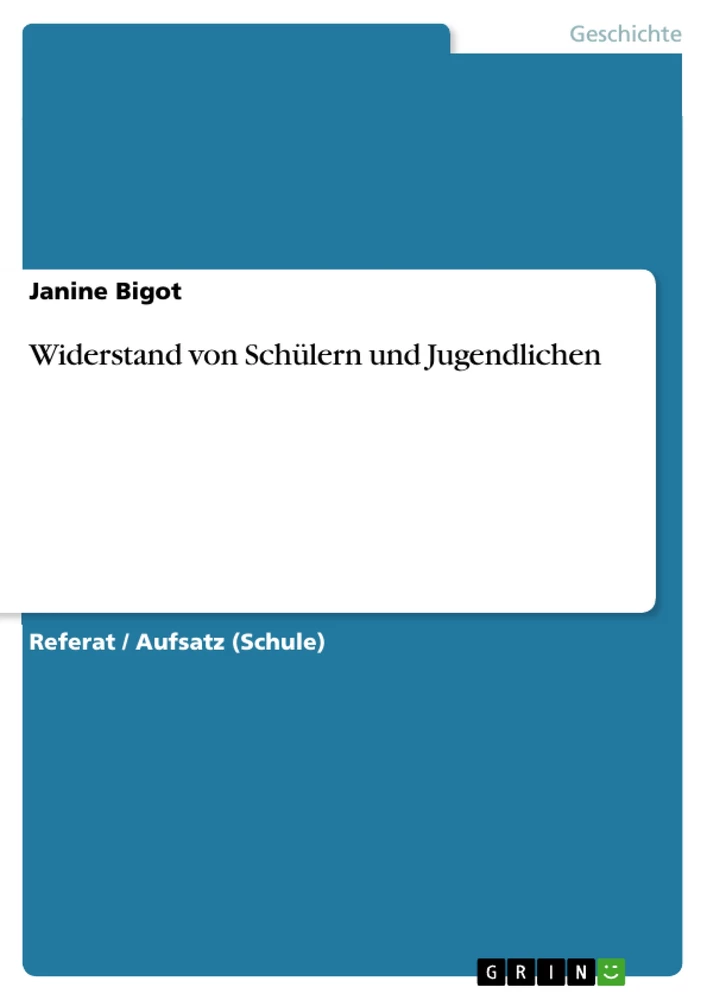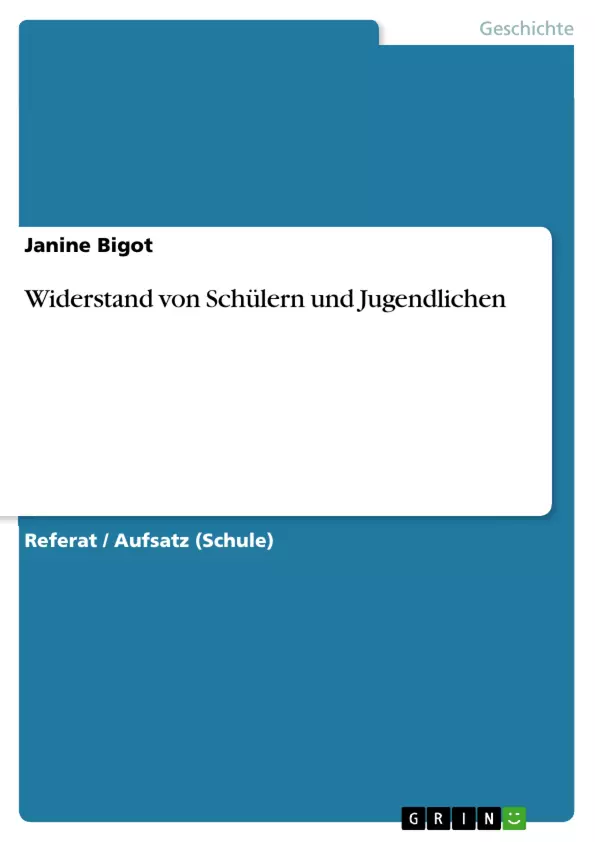Widerstand von Schülern und Jugendlichen
Einleitung
Je näher das Ende des Krieges kam, desto mehr Menschen entzogen sich der Naziherrschaft, verbargen sich in den Trümmern und bekämpften die Nazis. Soldaten auf Heimaturlaub und Jugendliche, die noch an die Front mussten, tauchten unter, sodass es zum Beispiel in Köln 1944 etwa 4000 (Internetquelle7) Deserteure gab. In dieser Zeit wuchsen die Widerstandsgruppen, vor allem die der Jugendlichen.
Das nationalsozialistische System schuf sich unter den Jugendlichen durch den militärischen Drill, die ständige Bevormundung und Gehorsamsübungen ein sehr hohes Widerstandpotenzial. Die Jugendlichen schlossen sich meistens aus Protest zusammen.
Der Widerstand von Jugendlichen wird von vielen bis Heute nicht als wirklicher Widerstand gesehen, da er teilweise nicht organisiert oder die Motive oft nicht gleich gesehen werden oder auch nicht da waren. Aber wenn man bedenkt, mit was für einem Aufwand auch der Widerstand der Jugend bekämpft wurde, musste er doch eine größere Rolle gespielt haben als die meisten Leute denken. Leider werden viele Widerstandskämpfer nicht als solche, sondern eher als Kriminelle gesehen, mit Begründungen die mehr als zweifelhaft sind.
Die Edelweißpiraten
Die Edelweißpiraten entstanden 1941/42 im Ruhrgebiet. Es steht zwar nicht definitiv fest woher der Name Edelweißpiraten kommt, aber fest steht, dass er aus den Kittelbach-Piraten entstanden ist. Dieser 1925 in Düsseldorf gegründete Wanderbund, war zunächst auf der Seite der Nationalsozialisten, aber als 1933 der Bund in die nationalsozialistischen Organisationen, wie die HJ und BDM, eingegliedert werden sollte, bestanden einige Mitglieder auf ihre Eigenständigkeit und blieben dem Bund, der mittlerweile verboten war, treu.
Schätzungsweise gab es mehrere tausend Edelweißpiraten. Es waren vor allem Jungen, aber auch Mädchen, im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Sie stammten aus dem Arbeitermilieu und wollten dem Dienst in der HJ entgehen oder einfach ihre Unabhängigkeit demonstrieren. Sie wehrten sich gegen die Unterdrückung des nationalsozialistischen Systems. Sie wollten keine militärische Ordnung und Disziplin, sondern ihre eigenen Ideen, Lieder, Kleider etc., sie wollten einfach über ihre eigene Jugend selber bestimmen. Das galt auch für die Mädchen, die nicht in die „Mutterrolle“ der perfekten nationalsozialistischen Familie gedrängt werden wollten. Auch die Tatsache, das in der Gruppe, nicht wie in der HJ, keine Geschlechtertrennung stattfand, wirke für viele Jugendliche anziehend.
Die Edelweißpiraten waren keine organisierten politischen Widerstandskämpfer, ihre Aktionen waren, bis auf Ausnahmen, nicht geplant und oft auch chaotisch. Aber immer mehr machten dann doch bei politischen Aktionen mit oder organisierten sie zum Teil auch selber (wie auch zum Bespiel Bartholomäus Schink oder Walter Kingenbeck, zu denen später noch mehr).
Die ersten politischen Aktivitäten der Edelweißpiraten bestanden darin, geflohene Zwangsarbeiter und andere Verfolgte zu verstecken. Um die Verfolgten versorgen zu können stahlen sie Lebensmittel und Geld. Später begannen sie auch Waffen zu besorgen um auch „direkt“ gegen die Nazis zu kämpfen. Sie hörten ausländische Radiosender ab und verbreiteten den Inhalt auf Flugblättern.
„Im März/April 1944 haben wir jede Nacht den englischen Sender abgehört und kriegten so immer die neusten Informationen. Und dann machten wir Flugblätter auf Schuhkartons... Die Texte waren ganz unterschiedlich: Die Amerikaner stehen an der Reichsgrenze. Macht Schluss mit dem Schisskrieg oder wir haben andere Flugblätter gemacht.
Ich entsinne mich an eines, da war Stalingrad gefallen, da steht Hitler zwischen Leichen und ist am Lachen, darunter stand: Ich fühle mich so frisch, es naht der Frühling.“ (Bericht eines Edelweißpiraten, Internetquelle 1)
Bartholomäus Schink
Bartholomäus Schink wurde 1927 in Köln geboren. Er gehörte zwar zur HJ aber traf sich mehrfach mit Jugendlichen die zu den Edelweißpiraten gehörten. 1944 geht Schink mit seinem Freund Günter Schwarz zu den Edelweißpiraten die den KZ-Häftling Hans Steinbrink verstecken. Erst stehlen sie nur Lebensmittel und andere lebenswichtige Dinge, später auch Waffen und Sprengstoff um als Partisanen bei dem „Endkampf“ dabei sein zu können. Bei einer Auseinandersetzung mit der Gestapo schießen sie auf Polizisten und NS-Führer, treffen auch Passanten.
Am 10. November 1944 wurde Bartholomäus Schink, im Alter von gerade 16 Jahren, in Köln-Ehrenfeld, mit 12 weiteren Mitgliedern der Edelweißpiraten, ohne Gerichtsverhandlung, von der Gestapo gehängt. Als Hinrichtungsgrund wurde illegaler Waffenbesitz, Raub, Zugehörigkeit einer kriminellen Gruppe und Beteiligung an der Ermordung des Ortsgruppenleiters Soentgen genannt Seine Mutter kämpft seit 1952 für die Annerkennung ihres Sohns als politisch Verfolgter. Er habe verletzte Nachbarn versorgt und verfolgte Juden versteckt. Dieses Ersuchen wurde 1957 und 58 von einem Deutschen Gericht abgewiesen, für sie war Schink kein Widerstandskämpfer. Dieses Urteil stieß auf heftige Kritik in der Bevölkerung. Es ging soweit, dass Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes 1978 eine neue Beurteilung beantragte. Die aber wiederum bestätigte das Bartholomäus kein Widerstandkämpfer war. Als die Schwester von Schink 1988 in Jerusalem, stellvertretend für ihren Bruder, in der Gedenkstätte Yad Vashem die Auszeichnung „Gerechte der Völker“ entgegen nahm, flammte die Diskussion von neuem auf. Wieder ließ Franz-Josef Antwerpes den Fall neu untersuchen aber auch Professor Hüttenberger und Bernd Rusinek entschieden 1988 das Bartholomäus Schink weder Widerstandskämpfer noch Krimineller gewesen sei, da er nur so gehandelt habe, weil ums Überleben kämpfte. Damit war der „Fall Bartholomäus Schink“ für die Behörden abgeschlossen.
Walter Klingenbeck
Walter Klingenbeck wurde am 30. März 1924 in München geboren. Er und seine Familie waren streng Katholisch. Er hörte regelmäßig mit seinem Vater die deutschsprachige Übertragung des Vatikansenders. Als im September 1939 das Hören von ausländischen Sendern verboten wurde hielt sich der Vater auch daran aber Klingenbeck entschloss sich weiterhin die Sendungen zu verfolgen. Bei der Einstellung fand er noch mehrere Sender mit „Feindpropaganda“. Nach einiger Zeit wollte Klingenbeck aktiver gegen den Nationalsozialismus angehen. Er suchte sich Verbündete wie den 16jährige Daniel von Recklinghausen, einen Arbeitskollegen und den Hochfrequenztechniker Hans Haberl, der wie Klingenbeck, auch 17 Jahre alt war. Zusammen hörten sie verbotene Radiosendungen ab. Nach der „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ vom September 1939, hieß es: „Im modernen Krieg kämpft der Gegner nicht nur mit militärischen Waffen, sondern auch mit Mitteln, die das Volk seelisch beeinflussen und zermürben sollen. Eines dieser Mittel ist der Rundfunk. Jedes Wort, das der Gegner sendet, ist selbstverständlich verlogen und dazu bestimmt, dem deutschen Volk Schaden zuzufügen“ (Internetquelle 6.) Richtig aktiv wurden Klingenbeck und seine Freude durch die, von der BBC ausgerufene, „V-Aktion“. Alle Gegner der Nationalsozialisten sollten auf belebten Plätzen etc. ein großes V, für das englische „victory“ oder wie im französischen „victoire“, also „Sieg“, malen. Auch die „Weiße Rose“ startete eine solche Aktion, aber erst anderthalb Jahre später, im Februar 1943.
Im Jahre 1941 begannen die Vorbereitungen für eine große Flugblattaktion.
Mit Fotos von gefallen Soldaten und Parolen wie „Hitler kann den Krieg nie gewinnen, er kann ihn nur verlängern.“ (Internetquelle 6.), wollten sie die Siegeszuversicht der Soldaten einschränken.
Das größte Projekt der Freunde war der Bau einer Radiostation, mit der sie deutsche, französische und italienische Sendungen ausstrahlen wollten. Sie wollten die Wahrheit über den Krieg an die Öffentlichkeit bringen. Trotz der ganzen Mühe schafften sie es nicht ihr Projekt fertigzustellen. Am 26. Januar 1942 wurde Klingenbeck von der Gestapo festgenommen. Einen Tag nach seiner Verhaftung, verhafteten sie auch Daniel von Recklinghausen und am 29. Januar dann auch Hans Haberl. Alle drei kamen in das Münchner Gefängnis Neudeck. Am 24. September 1942 wurden alle drei wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Schwarzsenders“ zum Tode verurteilt.
Nach elf Monatiger Haft, am 5. August 1943, wurden Hans Habel und Daniel von Recklinghausen zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren begnadigt. Noch am selben Tag wurde die Todesstrafe bei Walter Klingenbeck, in der Strafanstalt Stadelheim, vollstreckt. Bei seiner Hinrichtung war er 19 Jahre alt. Kurz vor seiner Hinrichtung schrieb er noch an seinen Freund Hans Haberl einen Abschiedbrief.
„Lieber Jonny!
Vorhin habe ich von deiner Begnadigung erfahren. Gratuliere! Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt. Ergo geht’s dahin. Nimm’s net tragisch. Du bist ja durch. Das ist schon viel wert. Wenn du etwas tun für mich willst, bete ein paar Vaterunser.
Lebe wohl, Walter.“ (Internetquelle 6.)
Auch Walter Klingenbeck wurde von der Justiz nicht als Widerstandskämpfer angesehen. Er gehörte keiner Partei an.
Quellen:
Bücher
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Internetadressen
1.http://www.shoahproject.org/widerstand/kids/shkids4.htm
2.http://www.shoahproject.org/widerstand/kids/shkids1.htm
3.http://www.shoahproject.org/widerstand/kids/shkids5.htm
4.http://www.kbs-koeln.de/gbg/denkmal/edelweiss/barthel.htm
5.http://home.t-online.de/home/ierinrm/gruppen.htm
6.http://homepages.muenchen.org/bm943495/florian/vortrag.htm
7.http://www.netcologne.de/~nc-esserjo2/bartholo.htm
Bildquellen:
Bücher:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Widerstand von Schülern und Jugendlichen"?
Der Text behandelt den Widerstand von Schülern und Jugendlichen gegen das nationalsozialistische Regime in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Er beleuchtet verschiedene Formen des Widerstands, wie zum Beispiel das Verstecken von Verfolgten, das Abhören ausländischer Radiosender und die Verbreitung von Flugblättern.
Wer waren die Edelweißpiraten?
Die Edelweißpiraten waren eine informelle Jugendbewegung, die ab 1941/42 im Ruhrgebiet entstand. Sie lehnten die nationalsozialistische Ideologie ab und demonstrierten ihre Unabhängigkeit durch eigene Lieder, Kleider und Aktivitäten. Sie setzten sich gegen die Unterdrückung und den militärischen Drill des NS-Systems zur Wehr.
Welche Aktionen führten die Edelweißpiraten durch?
Die Aktionen der Edelweißpiraten waren vielfältig. Sie versteckten geflohene Zwangsarbeiter und andere Verfolgte, stahlen Lebensmittel und Geld, um sie zu versorgen, besorgten Waffen und verbreiteten Informationen aus ausländischen Radiosendern auf Flugblättern.
Wer war Bartholomäus Schink und was geschah mit ihm?
Bartholomäus Schink war ein Jugendlicher, der sich den Edelweißpiraten anschloss. Er beteiligte sich an Aktionen gegen das NS-Regime, darunter das Verstecken von Verfolgten und die Beschaffung von Waffen. Im November 1944 wurde er im Alter von 16 Jahren ohne Gerichtsverhandlung von der Gestapo gehängt.
Was war das Besondere an dem Fall Bartholomäus Schink?
Der Fall Bartholomäus Schink ist besonders, weil er lange Zeit nicht als Widerstandskämpfer anerkannt wurde. Trotz der Bemühungen seiner Mutter und Schwester, seine Handlungen als politisch motivierten Widerstand darzustellen, urteilten die deutschen Gerichte, dass er lediglich ums Überleben gekämpft habe.
Wer war Walter Klingenbeck und was tat er?
Walter Klingenbeck war ein junger Mann, der mit seinen Freunden Daniel von Recklinghausen und Hans Haberl gegen das NS-Regime aktiv wurde. Sie hörten verbotene Radiosendungen ab, planten eine Flugblattaktion und versuchten, eine eigene Radiostation zu bauen, um die Wahrheit über den Krieg zu verbreiten.
Was geschah mit Walter Klingenbeck und seinen Freunden?
Walter Klingenbeck und seine Freunde wurden von der Gestapo festgenommen und wegen "landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Schwarzsenders" zum Tode verurteilt. Während Hans Haberl und Daniel von Recklinghausen zu Gefängnisstrafen begnadigt wurden, wurde Walter Klingenbeck im Alter von 19 Jahren hingerichtet.
Wurde Walter Klingenbeck als Widerstandskämpfer anerkannt?
Auch Walter Klingenbeck wurde von der Justiz nicht als Widerstandskämpfer angesehen, da er keiner Partei angehörte.
Welche Quellen werden in dem Text genannt?
Der Text verweist auf verschiedene Bücher und Internetadressen als Quellen für die Informationen. Es werden auch Bildquellen aus Büchern genannt.
- Quote paper
- Janine Bigot (Author), 2001, Widerstand von Schülern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101198