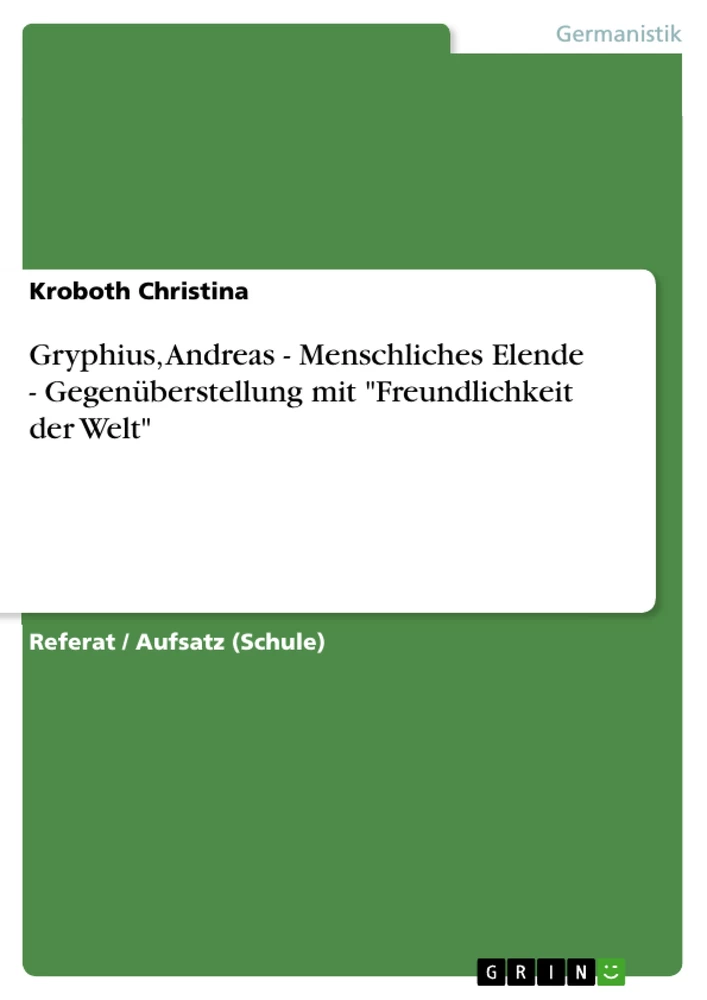Was bedeutet es wirklich, Mensch zu sein? Eine Frage, die seit Jahrhunderten Philosophen und Dichter gleichermaßen beschäftigt. Diese tiefgründige Analyse verwebt die düsteren, vom Krieg gezeichneten Verse von Andreas Gryphius' "Menschliches Elende" mit Bertolt Brechts hoffnungsvoller Hymne "Von der Freundlichkeit der Welt", um ein facettenreiches Porträt der menschlichen Existenz zu zeichnen. Gryphius, geprägt von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, malt ein Bild der Vergänglichkeit, in dem das Leben einem flüchtigen Traum gleicht, beherrscht von Angst und Leid. Seine barocke Lyrik offenbart eine Welt, in der Ruhm und Ehre im Angesicht des Todes verblassen, und der Mensch selbst nur ein "Ball des falschen Glücks" ist. Im Kontrast dazu steht Brecht, der den Menschen als Gestalter seines eigenen Schicksals sieht. Seine Verse, verwurzelt in den sozialen und wirtschaftlichen Realitäten der Zwischenkriegszeit, fordern uns auf, die Welt nicht als Schuldner, sondern als Bühne für unsere Selbstverwirklichung zu begreifen. Während Gryphius die Ohnmacht des Individuums betont, feiert Brecht die Eigenverantwortung und die Möglichkeit, trotz aller Widrigkeiten das Beste aus dem Leben zu machen. Diese Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Weltanschauungen regt zum Nachdenken über dieConditio humanaan, über die Zerbrechlichkeit des Daseins und die Kraft der Hoffnung. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob wir lediglich "Besucher" auf Erden sind oder ob wir die Fähigkeit besitzen, unser Leben aktiv zu gestalten und der Welt mit Freundlichkeit zu begegnen. Tauchen Sie ein in diese fesselnde literarische Reise, die die ewige Suche nach dem Sinn des Lebens aufzeigt, und entdecken Sie die überraschenden Parallelen und tiefgreifenden Unterschiede zwischen zwei der bedeutendsten Stimmen der deutschen Literaturgeschichte. Eine Analyse für jeden, der sich mit den großen Fragen der menschlichen Existenz auseinandersetzen möchte, von der Vergänglichkeit des Lebens bis hin zur Bedeutung von sozialer Verantwortung und individueller Freiheit.
Die Frage „Was ist der Mensch?“ ist nicht nur Thema der Barockdichtung, sondern ein grundsätzliches Thema der Literatur überhaupt. Versuche die Gedichte „Menschliches Elende“ ,von Gryphius, und „Von der Freundlichkeit der Welt“, von Brecht, einander gegenüberzustellen.
Das Gedicht „Menschliches Elende“ stammt von Andreas Gryphius, der einer der bedeutensten Lyriker und Dramatiker der Barockzeit war. Seine Jugend wurde sehr stark von den Schrecken des 30-jährigen Krieges geprägt. Die Kriegsereignisse und der Tod seines Vaters prägten ihn so sehr, dass ihm zeitlebends eine tiefe Melancholie blieb, die er in Gedichten verarbeitete.
Gryphius schreibt in seinem Sonett „Menschliches Elende“ von der Vergänglichkeit der Menschen. Er verwendet in seinem Gedicht einige Metaphern, wodurch es noch mehr Aussagekraft hat. Wie kann z. B ein Mensch, ein „Ball des falschen Glücks“ oder ein „Wohnhaus grimmer Schmertzen“ sein? Für Gryphius ist das Leben wie ein Strom, der hinwegfließt, den aber keine Macht und kein Wille aufhalten können. Es wird von Angst und Leid bestimmt und bevor man glücklich sein kann, steht der eigene Name im großen Buch der Sterblichkeit.
Bert Brecht schreibt jedoch von der „Freundlichkeit der Welt“. Er stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, von denen er sich aber sehr bald abwandte. Viele seiner Gedichte müssen aus der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Zwischenkriegszeit verstanden werden.
Während Gryphius in seinem Gedicht schreibt, dass der Mensch in seinem Leben nichts ändern kann, schreibt Brecht, dass jeder Mensch sein eigener Meister ist und dass man für sein Leben selber verantwortlich ist. Er glaubt, dass uns die Welt nichts schuldig ist und dass uns keiner hält, wenn wir gehen wollen.
Gryphius wurde stark vom 30-jährigen Krieg geprägt und das spiegelt sich in seinem Gedicht „Menschliches Elende“ wieder.
Im ersten Quartett fragt er sich, was wir Menschen doch sind? Sind wir nur ein „Irrlicht dieser Zeit“? Gryphius glaubt, dass unser Leben nur ein Schauplatz herber Angst ist und dass es so schnell verschwindet wie Schnee im Frühling oder wie eine Kerze, wenn sie brennt. Im zweiten Quartett schreibt er wieder, dass das Leben so schnell wieder vorbei ist wie ein Geschwätz oder ein „Scherzen“. Er ist also davon überzeugt, dass unser Dasein auf der Erde nur von kurzer Dauer ist und dass wir im Grunde genommen, nur „Besucher“ sind und keine „Bewohner“.
Im ersten Terzett setzt er das Leben einem guten Traum gleich, der nur allzu schnell aus der Bahn fällt. Er verwendet außerdem eine Häufung um noch mehr Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass unser Name, die Ehre und der Ruhm verschwindet, wenn wir tot sind. Gryphius glaubt, dass, wenn man Atem holt, man sofort mit der Luft entflieht und alles, was nach uns kommen wird, also alles Schlechte und Unheil, wird auch in unser Grab nachziehen.
Im letzte Satz, der gleichzeitig die Kernstelle des Gedichtes ist, schreibt er „wir vergehn wie Rauch vom starken Wind“. Für Gryphius kann das leben so schnell wieder vorbei sein, wie es angefangen hat und dass wir nichts unternehmen können um daran etwas zu ändern.
Für Brecht ist das Leben jedoch ein Geschenk Gottes, für dass wir selber verantwortlich sind. Er schreibt, dass, als wir auf die Welt kamen, uns eine Frau eine Windel gab, wir jedoch unbekannt und nicht begehrt waren, und ein Mann sich dann unserer annahm. Wir waren vielen Kindern vielleicht gleich, aber viele weinten um uns. Brecht glaubt, dass man die Menschen auf den richtigen Weg lenken soll, von da an müssen sie ihr Leben dann selbst in die Hände nehmen und das Beste daraus machen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Vergleich der Gedichte „Menschliches Elende“ und „Von der Freundlichkeit der Welt“?
Der Text vergleicht das Gedicht „Menschliches Elende“ von Andreas Gryphius und „Von der Freundlichkeit der Welt“ von Bert Brecht, um die unterschiedlichen Perspektiven auf das menschliche Dasein und die Welt darzustellen. Gryphius betont die Vergänglichkeit, das Leid und die Ohnmacht des Menschen angesichts des Schicksals, während Brecht die Eigenverantwortung, die Freundlichkeit der Welt und die Möglichkeit zur Gestaltung des Lebens hervorhebt.
Wer war Andreas Gryphius und welche Einflüsse prägten sein Werk?
Andreas Gryphius war ein bedeutender Lyriker und Dramatiker des Barock. Seine Jugend war stark von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges geprägt, was zu einer tiefen Melancholie führte, die sich in seinen Gedichten widerspiegelt. Er thematisiert oft die Vergänglichkeit des Lebens und die allgegenwärtige Angst.
Was sind die zentralen Aussagen des Gedichts „Menschliches Elende“?
In „Menschliches Elende“ beschreibt Gryphius das Leben als vergänglich, von Angst und Leid bestimmt und von kurzer Dauer. Er verwendet Metaphern, um die Ohnmacht des Menschen angesichts des Schicksals zu verdeutlichen. Das Gedicht betont die Unaufhaltsamkeit des Lebensstroms und die Gewissheit des Todes.
Wer war Bert Brecht und wie unterscheidet sich seine Perspektive von der Gryphius'?
Bert Brecht stammte aus bürgerlichen Verhältnissen, distanzierte sich aber bald davon. Seine Gedichte müssen oft im Kontext der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Zwischenkriegszeit verstanden werden. Im Gegensatz zu Gryphius betont Brecht die Eigenverantwortung des Menschen und die Möglichkeit, sein Leben aktiv zu gestalten. Er glaubt, dass die Welt dem Menschen nichts schuldet, sondern dass jeder sein eigener Meister ist.
Wie wird die Rolle des Menschen in den beiden Gedichten dargestellt?
Gryphius sieht den Menschen als Spielball des Schicksals, der wenig Einfluss auf sein Leben hat und dessen Dasein von kurzer Dauer ist. Brecht hingegen betont die Eigenverantwortung und die Fähigkeit des Menschen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Während Gryphius die Vergänglichkeit und das Leid betont, sieht Brecht die Freundlichkeit der Welt und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung.
Welche Schlussfolgerung zieht der Autor des Textes über das Leben in der heutigen Zeit?
Der Autor bedauert, dass es auch heute noch Kriege gibt, die das Glück der Menschen rauben. Er betont, dass man sich trotzdem nicht von seinem Weg abbringen lassen und versuchen sollte, das Gute im Menschen zu finden. Obwohl er anerkennt, dass das Wort "Leben" für Menschen in Kriegsgebieten eine andere Bedeutung hat, plädiert er dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben und anderen zu helfen, einen Sinn im Leben zu finden.
- Quote paper
- Kroboth Christina (Author), 2001, Gryphius, Andreas - Menschliches Elende - Gegenüberstellung mit "Freundlichkeit der Welt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101242