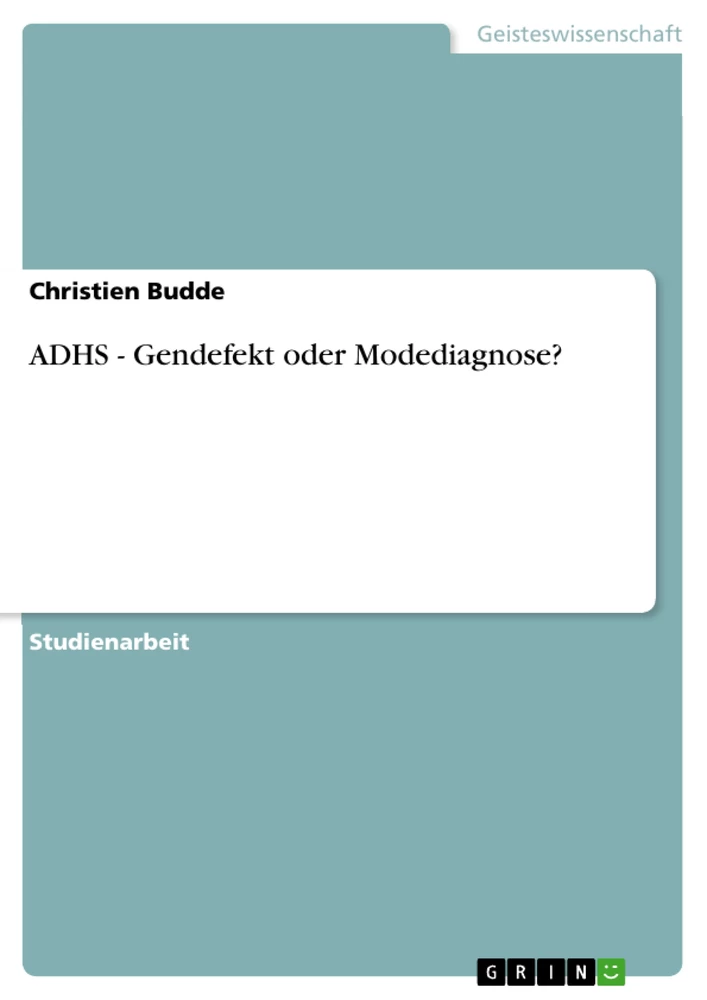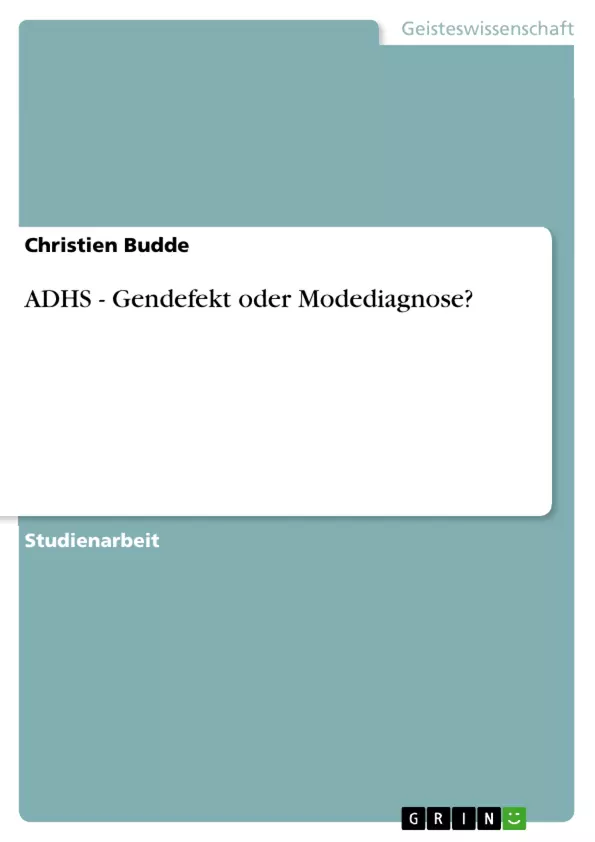Umfassende klinische Darstellung des Krankheitsbildes der Aufmerksamkeits - Defizits - Hyperaktivitätsstörung und Diskussion der Diagnose im gesellschaftlichen Kontext.
Entsprechend dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-V) herausgegeben von der American Psychological Associaton (APA) 2013 ist ADHS „Eine Entwicklungsstörung, die durch ein beeinträchtigendes Ausmaß an Unaufmerksamkeit, Desorganisation und/oder Hyperaktivität – Impulsivität definiert ist. […] Diese Symptome liegen in einem Ausmaß vor, das für das Alter oder die Entwicklungsstufe übermäßig stark ausgeprägt ist. In der Kindheit geht ADHS häufig mit anderen Störungsbildern einher, […] wie beispielsweise mit der Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten und mit der Störung des Sozialverhaltens. ADHS dauert oft bis ins Erwachsenenalter an und zieht Beeinträchtigungen im sozialen, schulischen und beruflichen Funktionsniveau nach sich.“ Die Ursache für die Störung ist in vier verschiedenen Bereichen zu finden: der Genetik, der Neurophysiologie, der Neuropsychologie und in psychosozialen Faktoren. Die Diagnostik findet über Fragebogenverfahren, Verhaltensbeobachtung, Leistungs- und Aufmerksamkeitsdiagnostik und neurologische Untersuchungen statt. Die Therapie beruht auf den verschiedenen Säulen der Medikation mit Metylphenidat, Psychoedukation und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen (Jacobs & Petermann, 2010). Es gibt sowohl Kritik am Krankheitsbild, als auch an den Diagnoseverfahren und der Therapie, wobei als alternativer Vorschlag eine entwicklungspsychologische Störung hervorgerufen durch die Gesellschaft vorgeschlagen wird. In der Diskussion können nur einige der Kritikpunkte entkräftet werden, nicht aber alle. Vermittelnd wird hier noch das integrative Erklärungsmodell nach Gerald Hüther dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung
- Definition
- Symptomatik
- Ursachen
- Diagnostik und Therapie
- Kritik am Krankheitsbild und der Medikation
- Diskussion: Gendefekt oder Modediagnose?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Krankheitsbild der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und analysiert die umstrittene Frage, ob es sich dabei um einen Gendefekt oder eine Modediagnose handelt. Dabei werden die Definition, Symptomatik, Ursachen, Diagnostik und Therapie von ADHS beleuchtet sowie die Kritik an dem Krankheitsbild und der medikamentösen Behandlung.
- Definition und Symptomatik von ADHS
- Ursachen von ADHS: Genetik, Neurophysiologie, Neuropsychologie und psychosoziale Faktoren
- Diagnostik und Therapie von ADHS
- Kritik am Krankheitsbild und der Medikation
- Das integrative Erklärungsmodell nach Gerald Hüther
Zusammenfassung der Kapitel
Die Zusammenfassung beleuchtet die Definition von ADHS gemäß DSM-V und stellt die Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität dar.
Die Einleitung führt in das Thema ADHS ein und präsentiert zwei gegensätzliche Perspektiven: die Darstellung der Krankheit als belastender Faktor im Alltag und die Kritik an der Bezeichnung von ADHS als Hirnstörung.
Das Kapitel "Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung" beleuchtet die Definition von ADHS, die Symptomatik, die Ursachen, die Diagnostik und Therapie sowie die Kritik am Krankheitsbild und der Medikation.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen sind: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Definition, Symptomatik, Ursachen, Diagnostik, Therapie, Kritik, Medikation, Gendefekt, Modediagnose, integrative Erklärungsmodell, DSM-V.
- Citar trabajo
- Master of Science Christien Budde (Autor), 2016, ADHS - Gendefekt oder Modediagnose?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012512