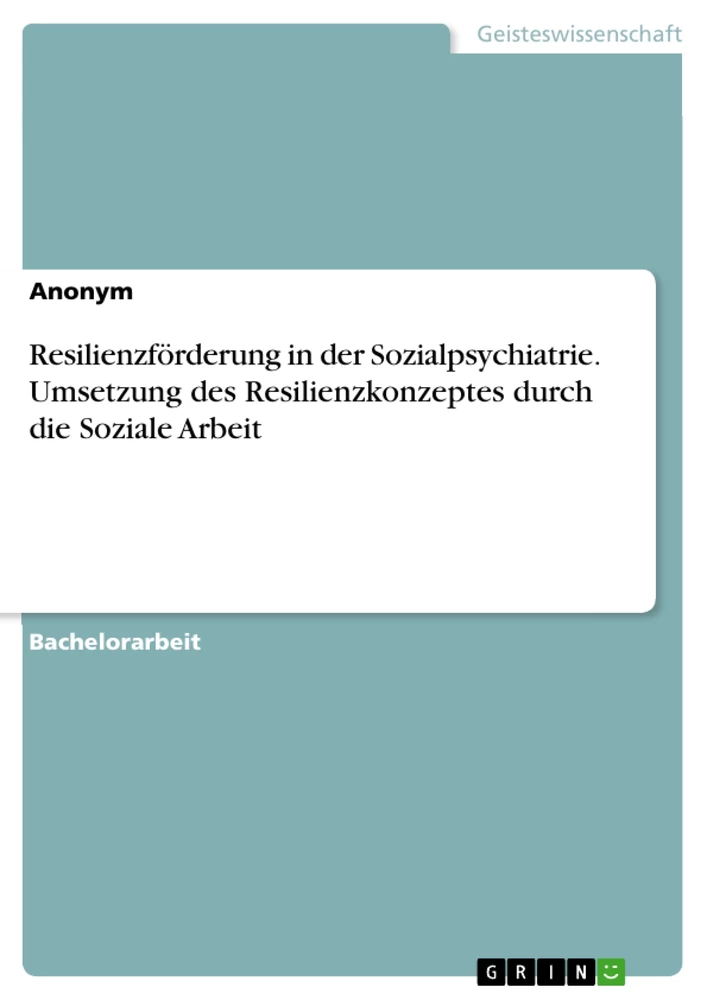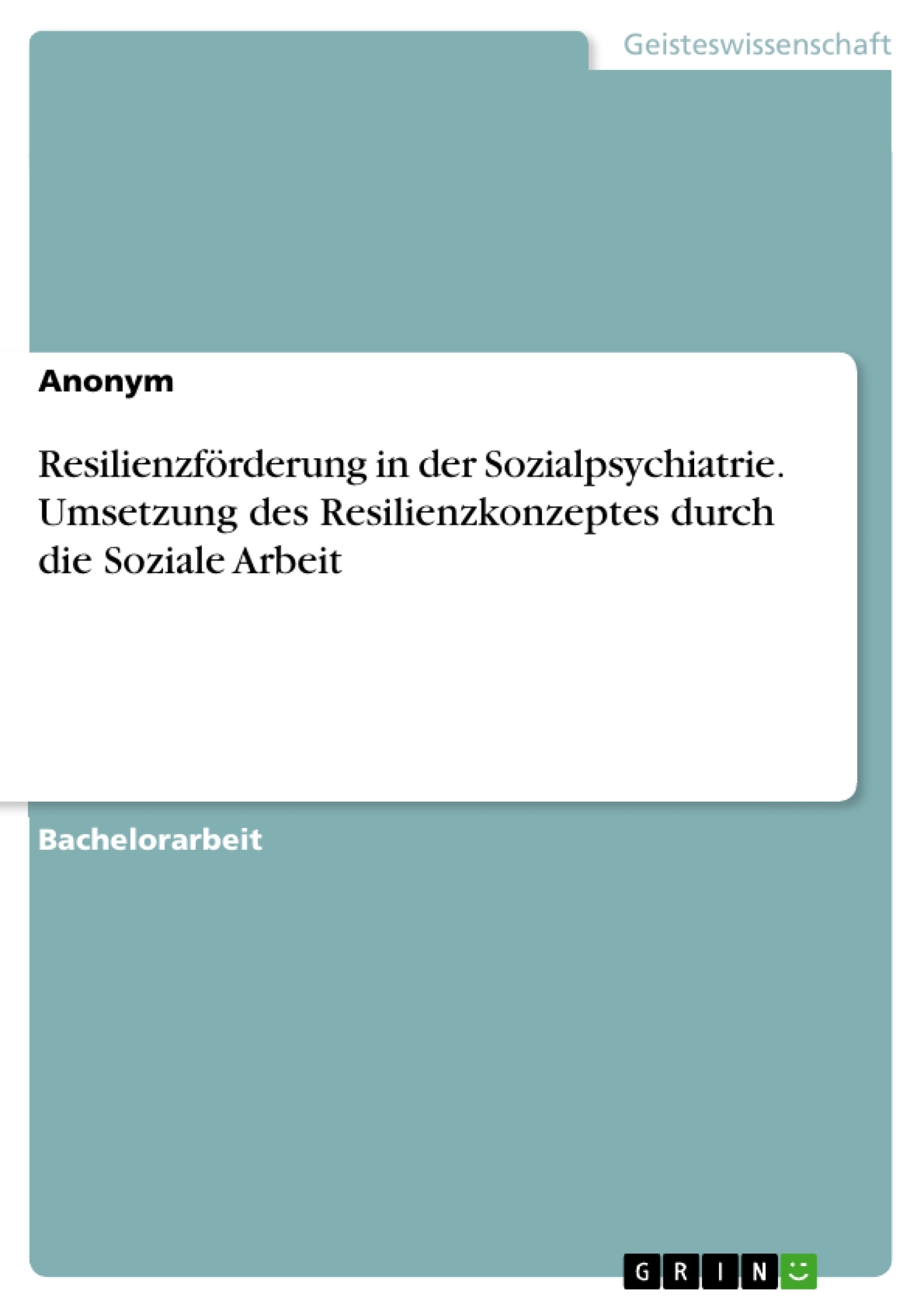Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie, der Entstehung und den Komponenten von Resilienz und der möglichen Umsetzung des Resilienzkonzeptes durch die Soziale Arbeit in der Sozialpsychiatrie. Die wichtigsten Begriffe zum Thema werden kurz bestimmt, die Erklärungsmodelle zu Resilienz erläutert und auch Kritik am Resilienzkonzept sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Resilienzförderung beleuchtet.
Zudem wird auf den historischen Hintergrund der Sozialpsychiatrie, dessen Zielgruppen und Methoden eingegangen. Des Weiteren werden verschiedene Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit dargestellt, um die Fragestellung "Was kann die Sozialpsychiatrie, mit ihren Handlungskompetenzen, zur Resilienzförderung beitragen, um eine langfristige Widerstandsfähigkeit zu erreichen?" zu beantworten.
Da durch Stress verursachte psychische Erkrankungen, durch die gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Leistungsdruck, ansteigen, wird dringend ein Konzept benötigt, um diese Anforderungen zu bewältigen. Durch die Literaturrecherche und die daraus gewonnen Ergebnisse ist das abschließende Ergebnis dieser Bachelorarbeit, dass die Sozialarbeit der Sozialpsychiatrie durch ihre verschiedenen Handlungskompetenzen die Resilienzförderung positiv beeinflussen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungstand
- Methode
- Resilienz
- Begriffsbestimmung Resilienz
- Schutz- und Risikofaktoren
- Resilienzmodelle
- Erklärungsmodelle von Resilienz
- Resilienzförderung
- Kritik am Resilienzkonzept
- Sozialpsychiatrie
- Begriffsbestimmung Sozialpsychiatrie
- Geschichte der Sozialpsychiatrie
- Zielgruppen der Sozialpsychiatrie
- Soziale Arbeit in der Sozialpsychiatrie
- Resilienzförderung bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
- Anwendung des Resilienzkonzeptes in der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch
- Resilienzförderung durch das Empowerment-Konzept
- Resilienz und Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch
- Praktische Umsetzung von Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie
- Ergebnisse
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Förderung von Resilienz in der Sozialpsychiatrie. Sie untersucht die Entstehung und die Komponenten von Resilienz und beleuchtet die Möglichkeiten der Umsetzung des Resilienzkonzeptes durch die Soziale Arbeit in der Sozialpsychiatrie. Die Arbeit analysiert die wichtigsten Begriffe zum Thema, erläutert Erklärungsmodelle zu Resilienz und thematisiert auch Kritik am Resilienzkonzept sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung.
- Bedeutung von Resilienz in der Sozialpsychiatrie
- Erklärungsmodelle und Komponenten von Resilienz
- Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie
- Anwendungsbereiche des Resilienzkonzeptes in der Sozialen Arbeit
- Zusammenhang zwischen Resilienzförderung und psychischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Hypothesen der Arbeit vorgestellt.
Das Kapitel "Forschungstand" bietet einen Überblick über die aktuelle Forschung zu Resilienz. Es werden verschiedene Studien und Erkenntnisse beleuchtet, die die Bedeutung von biologischen und umgebungsbezogenen Faktoren für die Resilienzentwicklung hervorheben.
Das Kapitel "Resilienz" definiert den Begriff "Resilienz" und erläutert die wichtigsten Risikofaktoren und Schutzfaktoren, die die Resilienzentwicklung beeinflussen. Verschiedene Resilienzmodelle werden gegenübergestellt und die Bedeutung der Resilienzförderung wird beleuchtet.
Im Kapitel "Sozialpsychiatrie" werden die Begriffsbestimmung und die Geschichte der Sozialpsychiatrie dargestellt. Die Zielgruppen der Sozialpsychiatrie werden benannt und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Handlungsfeld wird beleuchtet.
Das Kapitel "Resilienzförderung bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen" widmet sich der praktischen Anwendung des Resilienzkonzeptes in der Sozialen Arbeit. Es werden verschiedene Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit in den thematischen Zusammenhang gebracht und die praktische Umsetzung der Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie wird erörtert.
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit und stellt die gewonnenen Erkenntnisse dar.
Das Kapitel "Diskussion" interpretiert die Ergebnisse der Arbeit und diskutiert die Relevanz der Erkenntnisse für die Praxis der Sozialen Arbeit in der Sozialpsychiatrie.
Schlüsselwörter
Resilienz, Sozialpsychiatrie, Soziale Arbeit, psychische Erkrankungen, Stressbewältigung, Lebensbewältigung, Empowerment, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Präventionsmaßnahmen, Handlungskompetenzen, Widerstandsfähigkeit
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Resilienzförderung in der Sozialpsychiatrie. Umsetzung des Resilienzkonzeptes durch die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012592