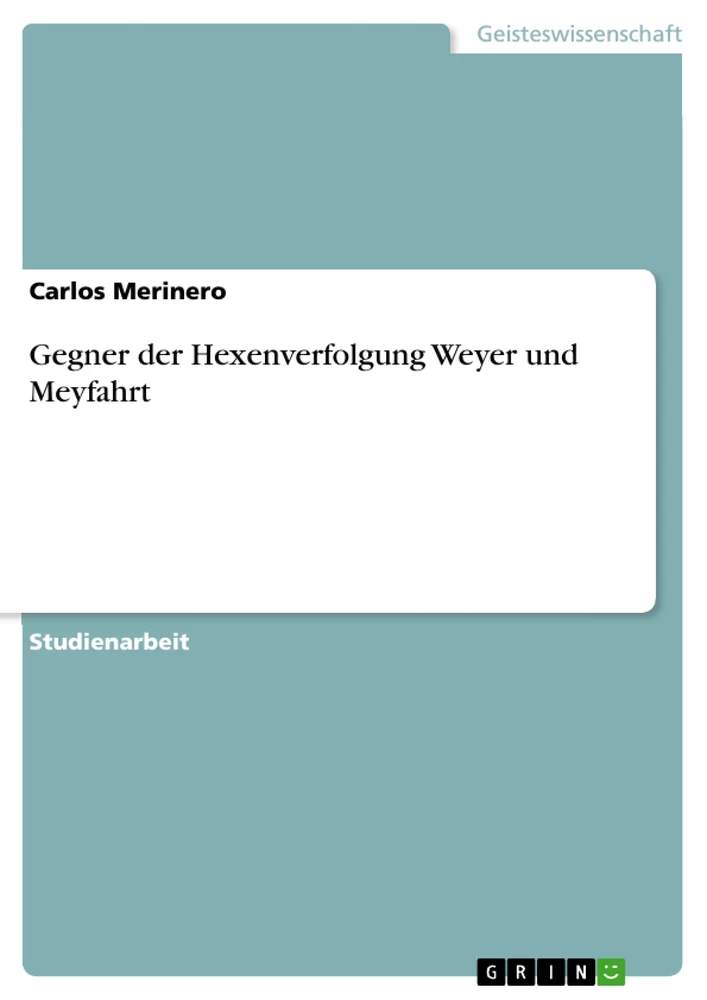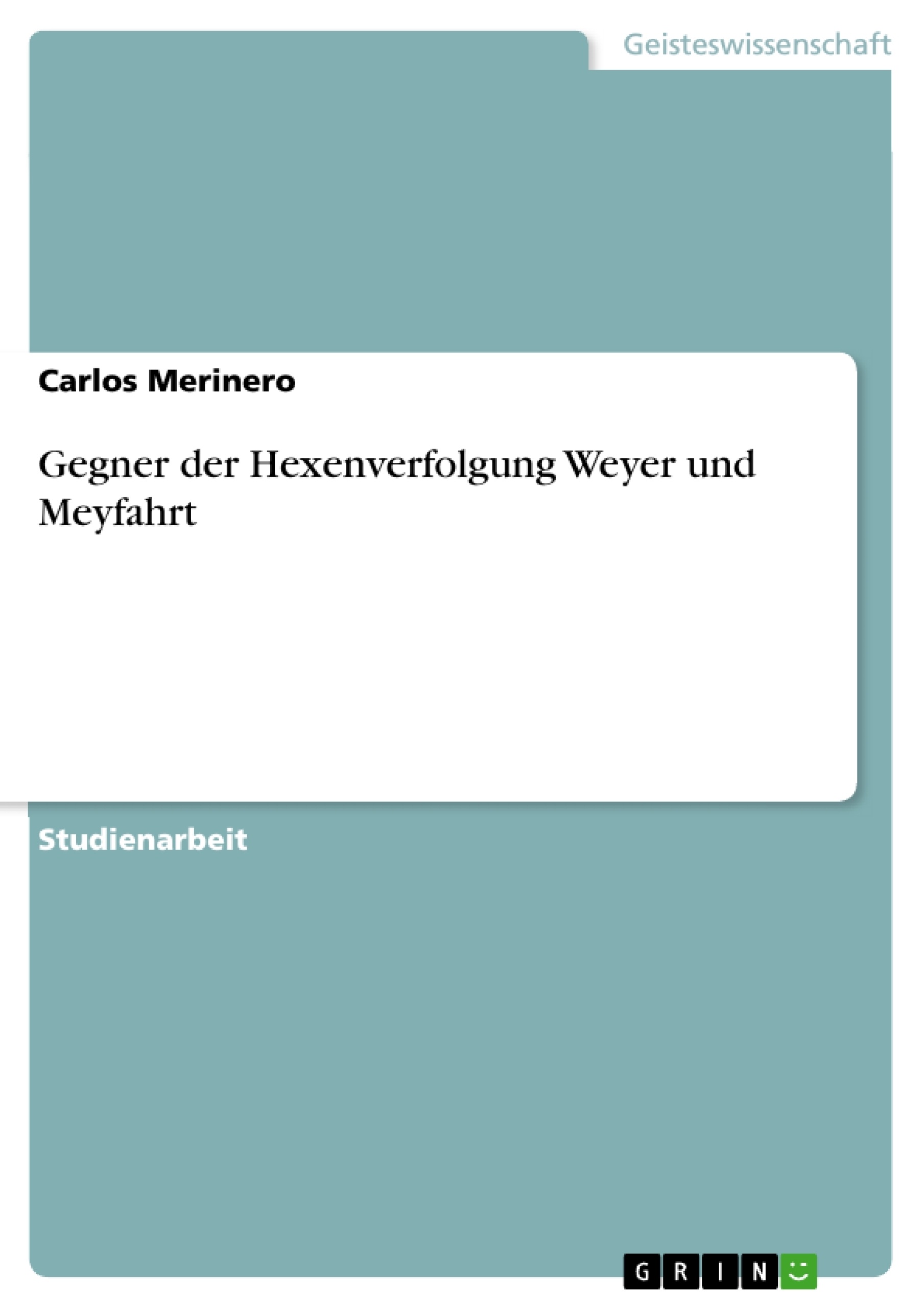Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Johann Weyer
2.1. Weyers medizinische Anschauungen
2.2. Weyers theologische Anschauungen
2.3. Weyer und die Rechtswissenschaft seiner Zeit
3. Johann Matthäus Meyfahrt
3.1. Meyfahrts Einstellung zu den Hexenprozessen
3.2. Meyfahrt droht den Obrigkeiten Höllenstrafen an
4. Schlussbetrachtung
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Thema dieser Hausarbeit sind die Gegner der Hexenverfolgung. Dafür habe ich zwei Persönlichkeiten ausgesucht. Entschieden habe ich mich Johann Weyer und Johann Matthäus Meyfahrt vorzustellen. Ich werde so verfahren, dass ich jeweils einige Sätze zum Lebenslauf sage. Anschließend komme ich auf die einzelnen Anschauungen zur Hexenverfolgung zu sprechen und werde diese differenziert aufführen, so dass ihre Argumentationsweise deutlich wird. Als erstes wird Johann Weyer beschrieben, da er ein sehr früher Gegner der Hexenverfolgung war und zusätzlich vor der Zeit Meyfahrts gelebt hatte. Weyer brachte gegen die Hexenverfolgung Argumente aus den Bereichen der Medizin, der Theologie und der Rechtswissenschaft vor.
Meyfahrts Argumentation stellte eher eine Umkehrung der Perspektive dar. Er kümmerte sich vielmehr um die Motive der Verfolger als die der Hexen. Sein großes Mitleid galt den unschuldig gefolterten Menschen. Sie wurden solange gequält bis sie ausgesagt haben, was die Folterer hören wollten. Seine Argumentation deckt sich überhaupt nicht mit der von Weyer. Er führt einen ganz anderen Aspekt an, indem er mit der gleichen Methode die Hexenverfolger angreift wie diese die Hexen angreifen.
2. Johann Weyer
Johann Weyer wurde als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns 1515 in Brave bei Nordbrabant geboren. Er besuchte die Lateinschule in Herzogenbusch und in Löwen. Er kam dann nach Bonn zu Cornelius Agrippa, der 1532 und 1533 hier als Gast des kurfürstlichen Herzogs von Wied weilte. Unter seiner Führung bereitete Weyer sich auf die Universität vor. 1534 begann er in Paris Medizin zu studieren und beendete 1537 das Studium in Orleans mit dem Doktortitel. Er kehrte nach dem Studium in seine Heimat zurück und war dort als Arzt tätig. Im Jahre 1545 begann Weyer als Stadtarzt in Arnheim zu arbeiten und 1550 wurde er Leibarzt des Herzogs Wilhelm V. von Jülich-Kleve.1 Am Hofe dieses Fürsten fand er nicht bloß geistige Anregung, sondern erwarb sich auch einen entschiedenen Einfluss auf die Regierungsangelegenheiten des Landes. Er erfreute sich der hohen Beliebtheit seines Fürsten, auch aus dem Grunde, weil dieser mit ihm in einer freieren und vernünftigeren Beurteilung des Hexenglaubens und der Hexenprozesse übereinstimmte. Weyer verdankte diese Grundsätze vornehmlich seinem Lehrer Agrippa. Dieser hatte im Jahre 1519-1520 als Syndikus in Metz gegen den Inquisitor Savini mit großem Erfolg eine angeklagte Hexe verteidigt und ihre Freisprechung durch das Metzer Domkapitel durchgesetzt, wofür dem Agrippa von seinen Freunden und anderen Hexenverfolgungsgegnern große Anerkennung gezollt wurde.2 Weyer blieb bis zum Eintreten in den Ruhestand 1578 Leibarzt des Herzogs. Er zog sich dann in sein Landgut zurück, das sich in der Nähe von Kleve befand. Während dieser Zeit sollte Weyer wegen seiner Verteidigung der Hexen wiederholt in Lebensgefahr geschwebt haben. Nur durch den Schutz seiner mächtigen Freunde war er dieser Gefahr entronnen.3 Im Jahre 1588 erkrankte er schwer und starb an den Folgen seiner Krankheit am 24.2.1588.
Der größte Verdienst Weyers liegt in der Klarheit und dem Mut, womit er systematisch die Bekämpfung der Hexenprozesse unternahm und über zwanzig Jahre lang mit allem Eifer durchführte.4
2.1. Weyers medizinische Anschauungen
Durch den vertrauten Umgang in seiner Lehrzeit bei Cornelius Agrippa in den Jahren 1532/33 lernte Weyer dessen Ansichten über den Hexen- und Dämonen- Aberglauben und seine Ablehnung des „Hexenhammers“ von Sprenger/Institoris kennen. Die Erinnerung an Agrippa und seine Lehren werden Weyer dazu gebracht haben, den Aberglauben von Menschen in den Nachbarstaaten zu bekämpfen. Während der Zeit als Weyer Leibarzt bei Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve war, schrieb er in einer Widmung an den Herzog einige Zeilen, in denen seine Haltung gegenüber der Hexenverfolgung deutlich wird5. Darin stand: „Da habe ich es denn übernommen ... an diese schwere Sache, welche unseren christlichen Glauben schändet, mit meinen geringen Dienst mich zu wagen. Nicht Hochmut treibt mich Möge man ...nur die von den Theologen Heinrich Krämer und Jakob Sprenger in jenem Buch aufgehäuften unsinnigen und oft gottlosen Albernheiten nachlesen und sie mit dem Inhalt meiner Schrift ruhigen Sinnes vergleichen. Da wird sich’s klar zeigen, daß ich eine ganz andere, ja eine entgegengesetzte Meinung aufstelle und verteidige“6. Punkt für Punkt strafte Weyer den Hexenhammer Lügen und wies ihm Ungereimtheiten nach. Ausgehend von seinen medizinischen Erfahrungen verfasste er einen leidenschaftlichen medizinisch-moralischen Angriff auf das Laster des Zorns und zwei rein medizinische Werke „die Obsevationes“ und das „Artzney-Buch“. Darin fanden sich Abhandlungen über Skorbut, Sumpffieber, Lungenentzündung, Syphilis und andere Krankheiten. Unter Medizinern erreichten diese Bände ein hohes Ansehen, weil die Darstellung der Krankheitslehre und der Behandlung sich über das erhebt, was von seinen Zeitgenossen zu lesen war.7 In seinen Werken hielt Weyer die antike Heilkunde für korrigierbar, weil im 16.Jh. völlig neue Krankheiten aufzuweisen waren. Er verehrte die antike Medizin und erkannte besonders die Leistungen von Hippokrates und Galen an. Galen galt für Weyer sogar als „Phönix aller Ärzte“. Er akzeptierte die antike Vier-Säfte-Lehre, in der fast alle Krankheiten auf Störungen des körperlichen Saftes und Spiritus zurückzuführen waren. Anhand dieser Grundlage konnte die Antike, wie auch die Renaissance-Medizin, selbst die wahnwitzigsten Illusionen und Vorstellungen erklären. Es war seit langem ärztlicher Brauch, die für Besessenheitssymptome der Hexen gehaltenen Zuckungen und Visionen als Folgen einer schweren Säftestörung zu interpretieren. Zu Beginn der frühen Neuzeit im 16.Jahrhundert stellte sich die Frage, wie man erklären und beweisen konnte , ob Krankheiten nicht auch von bösen Geistern verursacht werden konnten? Die Mediziner des 16.Jh. gaben zu, wenn auch nicht gerne, dass ihre Kenntnisse und Erklärungen nur eine begrenzte Reichweite hatten. So waren der Teufel und das Übernatürliche immer noch vorhanden, auch wenn die Ärzte zu dieser Zeit es zu verharmlosen versuchten. Jeder Arzt hatte aber zugestanden, dass die Teufelsbesessenheit möglich war, und dass der Teufel die Menschen unmittelbar angreifen konnte. Weyer meinte, dass man in unerklärlichen und eigenartigen Fällen zuerst einen Arzt rufen sollte, damit dieser die natürlichen Ursachen der Krankheit durchforschte. Häufig hatte Weyer angebliche Fälle von Besessenheit oder übernatürlichen Kräften mit dem Hinweis entkräftet, sie hätten alle eine körperliche oder natürliche Erklärung. Die merkwürdigsten Erscheinungen, sowie die Geständnisse der angeblichen Hexen, dass sie durch die Luft geflogen sind, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, geschlechtlichen Verkehr mit ihm hatten, Unwetter gestiftet haben usw., erklärte Weyer als eine Täuschung oder Geisteskrankheit, Melancholie und durch Drogen erzeugte Visionen. Jedoch konnte Weyer den Teufel grundsätzlich nicht ausschließen und er gab es des öfteren freiwillig zu, dass wahre Teufelsbesessenheit durchaus möglich war.8 An die Existenz eines Teufels in Person und an seinem für die Menschen höchst schädlichen Wirken gab es für Johann Weyer keinerlei Zweifel. Auftritte allerdings von Zauberern oder Magie treibenden Mönchen und Ärzten hielt er für blanken Humbug. Auch das gesamte Hexenwesen hielt er für Einbildung. Er war der Meinung, dass die Art der Bekenntnisse der Hexen töricht und ein abscheuliches Blendwerk darstellten. Die weiblichen Wesen allerdings, so Weyers Überzeugung, waren schwach und leichtgläubig. Der Teufel verwirrte zwar die Phantasie der Menschen, aber er hatte keine Macht über ihren Körper Kontrolle zu bekommen, da ein Körper nur in gewöhnlicher Weise seinen Platz wechseln und sich nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten aufhalten kann.9 Von vielen Seiten erhielt Weyer zustimmende Briefe. Er wurde von anderen Gegnern der Hexenverfolgung anerkannt. Mehrere Landesherren verboten die Hexenbrände in ihrem Bereich.10 Weyer verwarf in seinen Werken grundsätzlich die Idee, dass teuflische oder dämonische Angriffe und Besessenheitsfälle von menschlichen Agenten verursacht werden konnten. Seiner Ansicht nach konnte es sein, dass die Welt voller Teufel war. Er griff zwei unterschiedliche Richtungen an: Erstens erklärte er die hohe oder gelehrte Magie, die neuplatonische Wort- und Musikmagie für eine Dummheit, zweitens bezweifelte er den Glauben, dass Hexerei eine wirksame Kunst ist.
Dieser Zweifrontenangriff konnte jedoch nicht auf Basis der damaligen Medizinwissenschaft geleistet werden, denn diese konnte dazu keine Argumente bereitstellen. Es war zwar medizinisches Denken, das ihm zu seiner Skepsis und zu seinen geschickten Entdeckungen geleitet hatte, aber die Medizin seiner Zeit reichte nicht aus, um Hexerei als unmöglich zu erklären.11 Von allen Seiten erhoben sich die Gegner Weyers. Das Buch über die Blendwerke der Dämonen wurde in Antwerpen, München, Rom, in Spanien und Portugal auf den Index der kirchlich verbotenen Bücher gesetzt. In München wurde Weyer als ein Ketzer angesehen. Die Gläubigen durften seine Schriften nicht lesen.12
2.2. Weyers theologische Anschauungen
Anmerkung: Bei den folgenden Ausführungen über Weyers theologische und rechtswissenschaftliche Ansichten habe ich mich zum größten Teil an dem Aufsatz von Erik Midelfort (vgl. Literaturverzeichnis) orientiert.
„Wenn der Teufel nicht mehr in die materielle Welt eingreifen konnte, wie er es in der biblischen Zeit getan hatte, dann waren die physikalischen Wirkungen schlicht unmöglich.“13 Auf der Grundlage, dass das Zeitalter der Wunder längst vorbei war, stellte der Engländer Reginald Scot (*1538 -†1599) fest, dass die Hexerei unmöglich ist. Er wies 1584 in London seinem Gefolge in dem höchst ironischen Buch The Discoverie of Witchcraft auf die Rolle der Sozialisation für den Hexenglauben hin.14 Es war ein sehr folgenreicher Schluss, der in seinem Werk beschrieben wurde. Folgte man diesem Werk, so musste der Glaube aufgeben werden, dass die Bibel ein hinreichender Führer durch die alltägliche Wirklichkeit des 16.Jahrhunderts ist. Dieser Schluss war für Weyer und andere Gebildete seiner Zeit dogmatisch unbegründet, da es einen unchristlichen Schluss darstellte. Da Weyer ein innerlich frommer, erasmianisch gesinnter Lutheraner war15, wäre es für ihn äußerst schwierig der Stellungnahme von Reginald Scot zu folgen, dass die Bibel kein ausreichendes Bild der Welt im 16. Jahrhundert widerspiegelt. Weyer meinte, dass die Bibel, wenn sie richtig verstanden wird, alle Argumente und jede Unterstützung für die Hexenjagd zerstört. Mit seinen philologischen Kenntnissen führte er die griechischen Wörter für Zauberei, Hexerei und Magie vor, wie sie in der Bibel gebraucht wurden und stellte fest, dass die Bibel gar nichts von einem Teufelspakt wusste. Eines der wichtigsten Entwicklung der spätmittelalterlichen, kirchenrechtlichen und theologischen Neuinterpretation des Hexenbegriffes in Richtung Ketzerei und Glaubensabfall war dahin zu verstehen, dass die „Hexen“ einen mangelnden oder einen verkehrten Glauben vorzuweisen hatten. Weyer nahm diesen neuen Hexenbegriff völlig ernst, da er sah, dass das Verbrechen der Hexerei und Zauberei keine feste Begründung mehr im Wort Gottes hatte. Das bedeutete, dass Hexerei genauso wie Ketzerei bestraft werden sollte. Er meinte sogar, dass Ketzer und Hexen einen besseren Religionsunterricht benötigten, und dass ihre Glaubensabweichungen nicht der Todesstrafe würdig sind.16
2.3. Weyer und die Rechtswissenschaft seiner Zeit
Weyer kannte sich gut in der römischen Rechtswissenschaft aus, so dass angenommen werden kann, dass er irgendwann Jura studiert hatte. Er kannte nicht nur die Texte von Justinian, Gratian und Papst Gregor IX., sondern verstand es auch, moderne sachdienliche Bedeutungen aus antiken Rechtsquellen herauszuziehen. Weyer hielt die alten Hexenweiber für schwache, halluzinierende und wahnwitzige Frauen. Diesbezüglich zitierte er oft aus den justianischen Digesten und aus späteren Rechtsquellen. In ihnen wurde besondere Milde gegenüber alten, schwachen und wahnsinnigen Frauen empfohlen. Es reichte nicht aus die Hexen zu beschützen, obwohl die Passagen gut ausgewählt wurden, denn die Hexenjäger hoben genau dieselben Tatsachen und Zustände hervor. Auch für sie waren die Hexen zumeist alte, schwache, leichtgläubige und hilflose Frauen. Es waren gerade diese Eigenschaften der am gesellschaftlichen Rande stehenden Frauen, die sie zur gottloser Zauberei und zum immer hilfsbereiten Teufel getrieben hatten. Ein Mann dagegen konnte der teuflischen Versuchung widerstehen. Die rechtlichen Zitate, die zur Milde für als Hexen angeklagte Frauen tendierten, wurden von den Hexenjägern angewandt um die Verfolgung der alten Frauen zu legitimieren.17 Der entscheidende Zusammenhang zwischen der fürchterlichen Macht des Teufels und dem verdorbenen Willen der Hexe war der Pakt mit dem Teufel, eine Vorstellung, die bis auf Augustinus zurückgeht. Weyer hatte ein Argument gefunden, dass die Bibel nichts von einem solchen Pakt wusste. Rechtlich gesehen war es wichtiger zu erklären, dass kein verbindlicher Pakt zwischen dem Menschen und dem Dämonen geschlossen werden konnte, denn nur so konnte Weyer aufzeigen, dass eine Hexe nie wirklich den Teufel herbeirufen und befehlen konnte und der Teufel nichts von einer solchen Hexe verlangen konnte. Weyer bestand darauf, dass das Verhältnis der Hexe zum Teufel genau das gleiche ist, wie zwischen dem Teufel und anderen sterblichen Personen. Nach römisch-rechtlichen Verständnis vom Vertrag war es wichtig, dass gültige Verträge von bona fides abhängig waren. Dies konnte man vom Teufel nicht erwarten, es sei denn, es handelte sich um einen „Löwenvertrag“, einen Vertrag, von dem nur eine Partei gewinnen konnte und eine andere verlieren. Genau das war bei den Hexen der Fall, die sich zwar Geld und geschlechtlichen Genuss erhofften, aber immer wieder vom Teufel enttäuscht wurden.18 Ein Vertrag konnte nicht verbindlich gelten, wenn er mit einem dolus malus eingegangen wurde, was doch nur den Willen des Teufels entsprach. Pakte waren auch ungültig, wenn sie sich auf Gewalt oder Furcht stützten. Die Hexen konnten einfach nicht das wollen, was der Teufel wollte. Ihre Absichten waren notwendigerweise inkongruent und ungereimt, weil ihnen kritische Informationen fehlten und sie deshalb keinen klaren Willen ausbilden konnten. Die Ungleichheit der Vertragspartner machte eine Zusammenarbeit ungültig und unmöglich, weil dort kein Rechtsverhältnis bestehen konnte, wo es nichts Gemeinsames gab. Außerdem durfte man die Hexen deshalb nicht für schuldig halten, nur weil sie Übles gewünscht hatten. Die bloße Absicht musste straffrei bleiben. Darüber hinaus gab es Verbrechen, die nach römischen Recht gar nicht möglich waren, z. B. konnte man Land nicht stehlen. Weyer fand es lächerlich, wenn jemand bekannte, dass er Land gestohlen hatte. Wer etwas Unmögliches versuchte und beabsichtigte, könnte als wahnsinnig betrachtet werden. Seiner Auffassung nach stellten solche Gedanken und Wünsche nicht die eines gesunden Menschen dar, sondern es waren eher wahnsinnige Träume gewesen.19 Das war nicht nur eine medizinisch-empirische Feststellung, wie es seine Gegner oft verstanden hatten, sondern es war dazu auch eine rechtlich vollkommen logische und radikale Aussage, nämlich dass die Hexerei einen schwachsinnigen oder geisteskranken Versuch darstellte, das Unmögliche zu versuchen. Sein Misstrauen beruhte nicht auf Zweifeln an den körperlichen Kräften der Dämonen, die er im Prinzip anerkannte, selbst wenn seiner Meinung nach viele ihrer angeblichen Taten in Wirklichkeit die betrügerischen Erfindungen katholischer Priester oder die Einbildungen kranker Personen waren.
Viele Juristen waren schockiert über die Frechheit eines Arztes, der es gewagt hatte, seinen juristischen Kollegen zu erklären, dass ein Verbrechen, worüber sie seit Jahrhunderten diskutiert hatten, einfach absurd und unmöglich ist. Deshalb haben die meisten Juristen Weyers Behauptung, dass die Hexen notwendigerweise wahnsinnig waren, weil sie das Unmögliche versuchten, missverstanden oder verworfen, wenngleich sie die empirische Beobachtung nicht außer acht lassen konnten, wonach die Hexen tatsächlich melancholisch, krank oder wahnsinnig waren, was hieß, dass der berühmte römische Rechtssatz zutraf: Der Wahnsinnige wird nicht bestraft, weil er durch seinen Wahnsinn schon genug bestraft ist. Der dämonologische Streit um Weyers De praestigiis daemonum 20 (Ueber die Blendwerke der Dämonen) hatte zur Folge, dass deutsche Juristen sich seit dem späten 16. Jahrhundert gezwungen fühlten immer häufiger Ärzte zu den Prozessen zuzulassen, um herauszubekommen, ob ein Angeklagter bei Sinnen war oder ob er derart melancholisch war, dass man ihn gar nicht oder nur in gemilderter Form bestrafen durfte.21
3. Johann Matthäus Meyfahrt
Johann Matthäus Meyfahrt wurde am 9. November 1590 in Jena geboren. Seine Schulzeit hatte er in Gotha verbracht. Ab dem Jahr 1608 besuchte er die Universität Jena und Wittenberg. Zunächst studierte er Philosophie, wandte sich anschließend dem Studium der Theologie zu. Im Jahre 1616 erhielt er eine Anstellung als beigeordneter Gehilfe eines Beamten in der philosophischen Fakultät Jena und noch in selben Jahr wurde er als Professor an ein Gymnasium in Coburg berufen. Auf seine Schüler hatte er einen großen Einfluss, in persönlichem Verkehr mit ihnen wusste er ihr geistliches Leben zu fördern. Während seiner Zeit an dem Gymnasium schrieb Meyfahrt eine Reihe an theologischen Arbeiten und eine nicht geringe Anzahl an asketischen Werken, in denen er vor allem seine eschatologischen Gedanken als einen „gewaltigen Wächterruf an die schlafende Christenheit“ aussprach. Im Jahre 1634 gab er eine Reihe an deutschen Schriften heraus, in welchen er unter anderem die Hexenprozesse stark kritisierte und ihre Einstellung forderte. Im Jahre 1642 starb er am 26. Januar wenig über 51 Jahre alt.22
3.1. Meyfahrts Einstellung zu den Hexenprozessen
Anmerkung: Bei den folgenden Ausführungen über Meyfahrts Einstellung zu den Hexenprozessen und über die Androhung der Höllenstrafe an die Obrigkeiten habe ich mich zum größten Teil an dem Aufsatz von Hartmut Lehmann (vgl. Literaturverzeichnis) orientiert.
Meyfahrt gehörte zu den luth.-orthodoxen Theologen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Folgt man seinen Biographen, dann hielt bei ihm die hochgespannte Erwartung des in nächster Nähe stehenden Jüngsten Gerichtes nicht mehr lange an. Er sah das Ende der Welt hinausgeschoben. So hatte er großes Interesse daran, die irdischen Verhältnisse erträglich zu gestalten.23 Nach eigener Aussage kannte Meyfahrt Friedrich von Spees cautio criminalis24 gut. Wie Meyfahrt anmerkte, hatte er auch Schriften von Tanner gelesen. Seine Argumente sind aber nicht irgendwelchen Vorbildern entnommen.25 Johann Reiche, der 1703 Meyfahrts Schrift nachdruckte, sagte dazu: „Ob er nun wohl dem Auctori Cautionis Criminalis ziemlich auf dem Fuße folget/ und sein Tractat ziemlich nach demselben riechet; so ist doch nicht zu leugnen/ daß er nicht vielfältig von seiner eigenen Invention was beygefüget haben sollte“.26 Vermutlich hatte Meyfahrt seine Schriften gegen Hexenprozesse schon um 1632, gegen Ende seiner Zeit in Coburg abgeschlossen.27 Wegen der scharfen Kritik, die er an der Haltung der Obrigkeiten formuliert hatte, konnte er keine Druckerlaubnis für seine Schriften erlangen. Seine Schriften konnte er erst in Erfurt drucken, als die Stadt von den Schweden erobert wurde. Darin behauptete Meyfahrt, solange nicht sichergestellt werden konnte, dass in den Hexenprozessen nicht auch Unschuldige verurteilt wurden, gelte es, diese Prozesse einzustellen. Eher sollten die Obrigkeiten dreißig Schuldige laufen lassen, als einen Unschuldigen zu töten. Meyfahrt war entrüstet und verabscheut gegen jene, die bedenkenlos alle der Hexereiverdächtigten so lange foltern ließen, bis sie sich schuldig bekannten. Er meinte sogar, dass die Folter ein besonderes und raffiniertes Mittel des Teufels war, um neue Opfer zu gewinnen. Er hielt es für eine Pflicht der Obrigkeiten ihre Untertanen nicht solchen Situationen auszusetzen, die für ihr Seelenheil gefährlich werden konnten. Nach Meyfahrt setzten christliche Obrigkeiten sich selbst, ihre Diener und Untertanen in die äußerste Leibes- und Lebensgefahr, wenn sie mit den Hexenprozessen fortfahren. Weiterhin beluden sich Obrigkeiten mit Schuld, wenn sie es zuließen, dass aufgrund der in Hexenprozessen üblichen krassen Ungerechtigkeit Menschen an Gott verzweifelten.28
3.2. Meyfahrt droht den Obrigkeiten Höllenstrafen an
Dreh- und Angelpunkt der ganzen Argumentation Meyfahrts war seine Überzeugung, dass in Hexenprozessen Schuldige und Unschuldige nicht voneinander getrennt werden konnten, und dass deshalb in vielen Prozessen Unschuldige verurteilt wurden. Der Grund ist, dass unter Folter Unschuldige zugeben, was sie nie getan haben. Folter verleitet die Menschen zu Fehlaussagen. Also kurz: Aus Allem was unter dem Zwang der Folter ausgesagt wurde, ist „nichts Gewisses“ zu schließen. Meyfahrt warf den Fürsten vor, dass sie sich nicht darum kümmerten, was in den Gerichten vorsichging. Wenn Meyfahrt darlegte, dass die Fürsten durch Nachlässigkeit große Schuld auf sich luden, dann spielte er, ohne es direkt auszudrücken, darauf an, dass solche Schuld in der Endzeit, in der man sich nach christlichem Verständnis bereits befindet, besonders schwer wiegt, da diese Schuld kaum wieder gutzumachen ist. Wegen des zukünftigen großen Gerichtstages, so Meyfahrt, sollten Regenten und Prediger die Verantwortung, die Hexenprozesse bedeuteten, mit größerem Ernst und Selbstdiziplin auf sich nehmen. Meyfahrt war überzeugt, dass der Tag des Jüngsten Gerichtes nicht mehr fern war. Anstatt weitere Sünden auf sich zu laden, indem sie Unschuldige marterten und töteten, sollten die Obrigkeiten und das Volk sich um Gottes Gnade bemühen, d.h. sie sollten Buße tun und ein frommes Leben führen. Die Schilderung der Todesstunde und die Schilderung des Jüngsten Gerichtes verband Meyfahrt zu einer grandiosen Idee von den Strafen, die Gott den Hexenrichtern und allen an den Hexenprozessen Beteiligten zumessen wird. Die Hexenrichter sollten sich nicht der Hoffnung hingeben, dass das ewige Heil ihnen zuteil wird. Seiner Meinung nach würde Gott ihre Missetaten vielmehr in der Stunde ihres leiblichen und ewigen Todes unnachsichtig strafen. Was pflichtvergessene Obrigkeiten und grausame Hexenrichter bei Lebzeiten getan hatten, würde ihnen Gott Punkt für Punkt vorhalten.29
4. Schlussbetrachtung
Johann Weyer ging es in seiner Argumentation gegen die Hexenverfolger darum, seine ärztlichen Kenntnisse, seine religiösen Überzeugungen und seine juristischen Untersuchungen so einzusetzen, dass seine Zeitgenossen die Listigkeit, Bosheit und die tückischen Täuschungen des leidigen Teufels erkennen konnten. Es ist schwierig zu beurteilen, ob Johann Weyer erfolgreich war. Fest steht, dass die Zeit der größten Hexenverfolgungen erst nach seiner Lebenszeit gekommen ist. Sein Fachwissen in den Bereichen der damaligen Medizin, Theologie und Rechtswissenschaft hat vielmehr die Anfänge des Zweifelns an Wirklichkeit und Wirksamkeit von Zauber und Teufelspakt begründet und gefördert.30 Anders war Meyfahrts Argumentation. Sie beinhalteten keine medizinischen, naturwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftliche Aspekte, sondern theologische und schlicht sachliche. Bei seiner Argumentation handelte es sich vielmehr um eine Umkehrung der Perspektive, da sich Meyfahrt vielmehr um die Motive der Verfolger kümmerte, als um die der Hexen. Sein großes Mitleid galt den unschuldig gefolterten Menschen, die solange gequält wurden, bis sie ausgesagt und den Glauben an Gott verloren hatten. Den Folterern und den Obrigkeiten, die die Folter zulassen haben, sagte er für den Tag des Jüngsten Gerichtes ein böses Ende zu.31
5. Literaturverzeichnis
Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 21. Hgg. durch die historische
Kommission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, 1885. S. 646-647.
Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 42. Hgg. durch die historische
Kommission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, 1897. S. 266.
Behringer, Wolfgang: Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung. München, 1998.
Diefenbach, Johann: Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland. Mainz, 1886. (Nachdruck: Augsburg, 1998)
Lehmann, Hartmut: Johann Matthäus Meyfahrt warnt hexenverfolgende Obrigkeiten vor dem Jüngsten gericht. In: Vom Unfug des Hexenprozesses. Gegner der Hexenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spee. Hg. von Hartmut Lehmann u.a.. Wiesbaden, 1992.
Midelfort, Erik: Johann Weyer in medizinischer, theologischer und
rechtsgeschichtlicher Hinsicht. In: Vom Unfug des Hexen-Prozesses. Gegner der Hexenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spee. Hg. von Hartmut Lehmann u.a..Wiesbaden, 1992.
Miesen, Karl-Jürgen: Friedrich Spee. Priester, Dichter, Hexen-Anwalt. Düsseldorf, 1987.
[...]
1 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 42. Hgg. durch die historische Kommission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, 1897. S. 266.
2 Vgl. Diefenbach, Johann: Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland. Mainz, 1886. (Nachdruck: Augsburg, 1998) S. 237.
3 Die Verfasser des Artikels über Johann Weyer in der Allgemeinen Deutschen Biographie schreiben, dass die Gefahr, in der Weyer geschwebt haben soll zwar in Veröffentlichungen ihrer Zeit berichtet werden, jedoch ohne Quellenangabe.
4 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 42. S. 267, 270.
5 Vgl. Miesen, Karl-Jürgen: Friedrich Spee. Priester, Dichter, Hexen-Anwalt. Düsseldorf, 1987. S. 141-143.
6 Zitiert nach: Miesen, S. 142-143.
7 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 42. S. 267.
8 Vgl. Midelfort, Erik: Johann Weyer in medizinischer, theologischer und rechtsgeschichtlicher Hinsicht. In: Vom Unfug des Hexen-Prozesses. Gegner der Hexenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spee. Hg. von Hartmut Lehmann u.a..Wiesbaden, 1992. S. 54-56.
9 Vgl. Miesen, S.143.
10 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band 42, S. 268.
11 Vgl. Midelfort, S. 56-57.
12 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band 42, S. 268.
13 Zitiert nach: Midelfort, S.57.
14 Vgl. Behringer, Wolfgang: Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung. München, 1998. S.77.
15 Einer seiner Interpreten hat versucht ihn als einen erasmianischen Reformkatholiken zu beschreiben. Der Autor Erik Midelfort schreibt, dass Weyer auf jeden Fall evangelisch war, und dass er wahrscheinlich ein von Erasmus stark geprägter Lutheraner war. Er schreibt, dass Weyer öfters Melanchton freundlich zitiert hatte. Er hatte eine Eschatologie und eine solche Geschichtsaufassung mit einer so positiven Bewertung der Reformation gehabt, dass er selbst als Erasmianer kaum katholisch hätte bleiben können. Wenn Weyer sich klar der evangelischen Konfession angeschlossen hatte, so war er doch kein eifernder Konfessioneller. (Vgl. Midelfort, S. 58-59)
16 Vgl. Midelfort, S. 59.
17 Vgl. ebd., S. 60.
18 Vgl. ebd., S. 61.
19 Vgl. ebd., S. 62.
20 Dieses Buch veröffentlichte Weyer im Jahre 1563. Die zweite Auflage dieses Buches folgte 1564, die dritte 1566, die vierte 1568, die fünfte 1577, die sechste 1583. Jede Auflage wurde mit Ausnahme der letzten im Umfang und Inhalt vergrößert. Mit diesem Buch wollte er nicht nur Beweismaterial vorführen um die Unmenschlichkeit oder die Brutalität der Hexenprozesse zu verdeutlichen, nicht nur zeigen, dass unschuldige Personen oft so sehr in Hexenprozesse verwickelt waren. Auch wollte er in diesem Werk nachweisen, dass die Hexerei ein unmögliches Verbrechen war. (Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band 42, S. 267.)
21 Vgl. Midelfort, S. 63.
22 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Band Nr. 21. Hgg. durch die historische Kommission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, 1885. S. 646-647.
23 Zeugnis dieses neuerwachten Interesses Meyfarts an innerlicher Reform ist seine 1636 in Erfurt publizierte Schrift: „Christliche Erinnerungen an Gewaltige Regenten und Gewissenhafte Prädicanten, wie das abschewliche Laster der Hexerei mit ernst auszurotten, aber in Verfolgung desselbigen auff Cantzeln und in Gerichtsheusern sehr bescheidentlich zu handeln sey.“ (Vgl. Lehmann, S. 224.)
24 Unter der Prämisse, dass es Hexen gab, unterzog der Hexenverfolgungsgegner Friedrich von Spee (1592-1635) den Hexenprozess in der cautio criminalis einer radikalen Kritik. An mehreren Stellen des Buches vermerkte Spee, dass es noch eine äußerst wichtige Wahrheit gibt, für welche die Zeit noch nicht reif war. Da er bereits alle Argumente gegen die Hexenprozesse systematisch aufgeführt hatte, blieb zu vermuten, dass er meinte, dass es gar keine Hexen gab und alle hingerichteten Menschen unschuldig waren. Die cautio criminalis wurde anonym und unter Umgehung der Zensur 1631 veröffentlicht. Sie löste erregte Diskussionen im Jesuitenorden und in der Öffentlichkeit aus. (Vgl. Behringer, S. 81.)
25 Vgl. Lehmann, Hartmut: Johann Matthäus Meyfahrt warnt hexenverfolgende Obrigkeiten vor dem Jüngsten gericht. In: Vom Unfug des Hexenprozesses. Gegner der Hexenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spee. Hg. von Hartmut Lehmann u.a.. Wiesbaden, 1992. S. 223-224.
26 Zitiert nach: Lehmann, S. 224.
27 Ich möchte darauf hinweisen, dass die Autoren der Allgemeinen Deutschen Biographie Meyfahrts Schriften gegen Hexenprozesse ab 1634 datieren, Hartmut Lehmann in seinem Aufsatz dagegen um 1632.
28 Vgl. Lehmann, S. 226-227.
29 Vgl. Lehmann, S. 225-226.
30 Vgl. Midelfort, S. 64.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Das Thema dieser Hausarbeit sind die Gegner der Hexenverfolgung. Es werden Johann Weyer und Johann Matthäus Meyfahrt vorgestellt, wobei ihre jeweiligen Ansichten zur Hexenverfolgung differenziert betrachtet und ihre Argumentationsweisen aufgezeigt werden.
Wer war Johann Weyer und was waren seine Hauptargumente gegen die Hexenverfolgung?
Johann Weyer (1515-1588) war ein Arzt, der als einer der frühesten Gegner der Hexenverfolgung gilt. Seine Argumente stammten aus den Bereichen der Medizin, Theologie und Rechtswissenschaft. Er wies auf medizinische Ursachen für Verhaltensweisen hin, die als Hexerei interpretiert wurden, hinterfragte theologische Grundlagen der Hexenverfolgung und argumentierte anhand von Rechtsgrundsätzen gegen die Hexenprozesse.
Was waren Weyers medizinische Ansichten bezüglich der Hexenverfolgung?
Weyer argumentierte, dass viele vermeintliche Hexen an Geisteskrankheiten, Melancholie oder durch Drogen erzeugte Visionen litten. Er wies darauf hin, dass viele Bekenntnisse und Handlungen, die Hexen zugeschrieben wurden, auf Täuschungen oder natürlichen Ursachen beruhten. Er schloss die Existenz des Teufels nicht aus, aber er bezweifelte, dass Hexen tatsächlich übernatürliche Kräfte besaßen.
Welche theologischen Ansichten hatte Weyer in Bezug auf Hexerei?
Weyer war der Meinung, dass die Bibel, wenn sie richtig verstanden wird, alle Argumente und jede Unterstützung für die Hexenjagd zerstört. Mit seinen philologischen Kenntnissen führte er die griechischen Wörter für Zauberei, Hexerei und Magie vor, wie sie in der Bibel gebraucht wurden und stellte fest, dass die Bibel gar nichts von einem Teufelspakt wusste. Er hielt die Bibel für einen wichtigen Bezugspunkt. Er war der Ansicht, dass Ketzer und Hexen besseren Religionsunterricht benötigten und dass ihre Glaubensabweichungen nicht der Todesstrafe würdig sind.
Wie argumentierte Weyer aus rechtswissenschaftlicher Sicht gegen die Hexenverfolgung?
Weyer bezog sich auf römisches Recht und argumentierte, dass alte, schwache und wahnsinnige Frauen milder behandelt werden sollten. Er stellte die Gültigkeit von Pakten mit dem Teufel in Frage und argumentierte, dass Hexen nicht für unmögliche Taten oder bloße Wünsche bestraft werden sollten. Er hielt Hexerei für einen schwachsinnigen oder geisteskranken Versuch, das Unmögliche zu versuchen.
Wer war Johann Matthäus Meyfahrt und wie unterschied sich seine Argumentation von der Weyers?
Johann Matthäus Meyfahrt (1590-1642) war ein lutherisch-orthodoxer Theologe, der die Hexenprozesse kritisierte. Seine Argumentation unterschied sich von Weyers, da er sich weniger auf medizinische, naturwissenschaftliche oder rechtswissenschaftliche Aspekte konzentrierte und stattdessen theologische und ethische Argumente vorbrachte. Er kümmerte sich vielmehr um die Motive der Verfolger als die der Hexen und kritisierte die Folter und die Verurteilung Unschuldiger.
Was war Meyfahrts Einstellung zu den Hexenprozessen?
Meyfahrt forderte, die Hexenprozesse einzustellen, solange nicht sichergestellt werden konnte, dass keine Unschuldigen verurteilt wurden. Er kritisierte die Folter als ein Mittel des Teufels, um neue Opfer zu gewinnen, und sah es als Pflicht der Obrigkeiten, ihre Untertanen vor Situationen zu schützen, die ihr Seelenheil gefährdeten.
Wie drohte Meyfahrt den Obrigkeiten Höllenstrafen an?
Meyfahrt war überzeugt, dass in Hexenprozessen Schuldige und Unschuldige nicht voneinander getrennt werden konnten. Er drohte den Hexenrichtern und allen an den Hexenprozessen Beteiligten mit Strafen am Tag des Jüngsten Gerichts und warnte sie vor Gottes Gericht.
Was war das Fazit der Hausarbeit?
Johann Weyers Fachwissen begründete und förderte die Anfänge des Zweifelns an Wirklichkeit und Wirksamkeit von Zauber und Teufelspakt. Meyfahrts Argumentation beinhaltete keine medizinischen, naturwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftliche Aspekte, sondern theologische und schlicht sachliche. Er kümmerte sich um die Motive der Verfolger und um die unschuldig gefolterten Menschen und sagte für den Tag des Jüngsten Gerichtes ein böses Ende zu.
- Quote paper
- Carlos Merinero (Author), 2001, Gegner der Hexenverfolgung Weyer und Meyfahrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101287