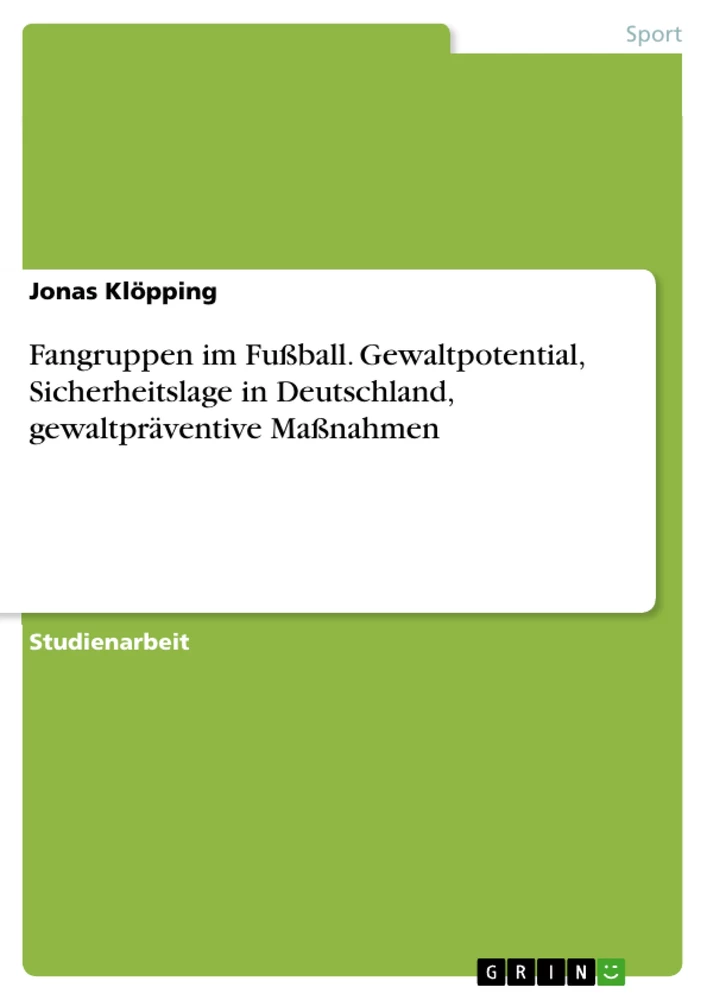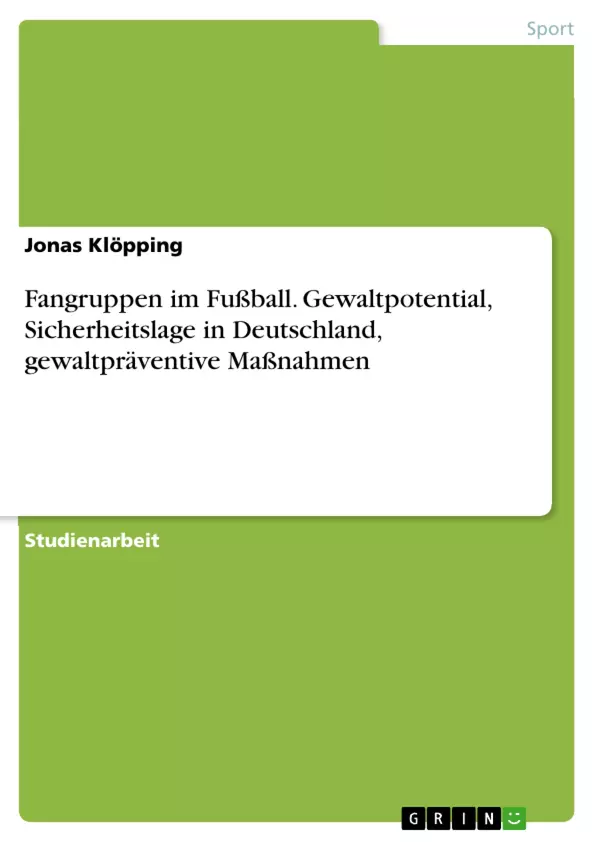In dieser Hausarbeit soll analysiert werden, welche Fans sowohl für die außergewöhnliche Stimmung zuständig sind, als auch für die Gewalt rund um den Fußball und das Stadion. Dafür ist es wichtig, dass man einen Blick auf die Zuschauer wirft und sich generell das Gewaltpotential in Deutschlands Profiligen anzuschauen. Zudem soll herausgefunden werden, welche Maßnahmen Vereine, Verbände und die Polizei unternehmen, um diese Gewalt präventiv zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kategorisierung der Fans
- Der konsumorientierte Fan
- Der fußballzentrierte Fan
- Der erlebnisorientierte Fan
- Die Ultras
- Hooligans
- Polizeiliche Bewertung der Fangruppen
- Gewaltpotential
- Sicherheitslage in Deutschland
- Gewaltpräventive Maßnahmen
- Fanprojekte
- Strategie der Polizei
- Stadionverbote
- Datei „Gewalttäter Sport“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die verschiedenen Fankategorien im deutschen Fußball und deren Beitrag zur sowohl außergewöhnlichen Stimmung als auch zur Gewalt im Stadionumfeld. Es wird das Gewaltpotential in den Profiligen untersucht und präventive Maßnahmen von Vereinen, Verbänden und Polizei beleuchtet.
- Kategorisierung der Fankultur und deren jeweiliges Gewaltpotential
- Analyse der Rolle verschiedener Fangruppen (Konsumorientierte, Fußballzentrierte, Erlebnisorientierte, Ultras, Hooligans)
- Bewertung der Fangruppen durch die Polizei und deren Kategorisierungssystem
- Gewaltpräventive Strategien und deren Effektivität
- Die Entwicklung der Ultraszene und deren Einfluss auf die Sicherheitslage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den ambivalenten Charakter der deutschen Fußballfankultur, die durch außergewöhnliche Stimmung in den Stadien, aber auch durch zunehmende Gewalt auffällt. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Fankategorien zu analysieren, deren Gewaltpotential zu untersuchen und präventive Maßnahmen zu beleuchten.
Kategorisierung der Fans: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Fankategorien: dem konsumorientierten Fan (reine Freizeitbeschäftigung), dem fußballzentrierten Fan (hohe Verbundenheit zum Verein, erhöhtes Gewaltpotential), dem erlebnisorientierten Fan (Sucht nach „spannenden“ Situationen, hohes Gewaltpotential), den Ultras (fanatische Unterstützung, oft kritisch gegenüber der Vereinsführung, organisierte Aktionen) und den Hooligans (gewaltorientiert, rückläufige Mitgliederzahlen). Die Kategorisierung dient der Einordnung des Gewaltpotentials und der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen.
Polizeiliche Bewertung der Fangruppen: Die Polizei verwendet ein dreistufiges Kategorisierungssystem (A-C) zur Einschätzung des Störerpotentials von Fangruppen. Kategorie A beschreibt friedliche Fans, Kategorie B gewaltbereite Fans und Kategorie C gewaltsuchende Fans. Die Einordnung ist jedoch nicht immer eindeutig, da die Motive der Fans komplex und variabel sind.
Gewaltpotential: Dieses Kapitel fokussiert auf das zunehmende Gewaltpotential der Ultraszene, besonders deren organisierte Aktionen mit Pyrotechnik und die Herausforderungen für die Ordnungskräfte. Das Kapitel beschreibt die Strategien der Ultras, um Kontrollen zu umgehen und Pyrotechnik einzusetzen, und die damit verbundenen Risiken für die Sicherheit im Stadion.
Schlüsselwörter
Fankultur, Fußballgewalt, Ultras, Hooligans, Gewaltprävention, Polizei, Fanprojekte, Stadionverbote, Kategorisierung, Sicherheitsmanagement, Gruppendynamik, Pyrotechnik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Analyse der Fankultur im deutschen Fußball
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die verschiedenen Fankategorien im deutschen Fußball und deren Beitrag zur Stimmung und Gewalt im Stadionumfeld. Sie untersucht das Gewaltpotential in den Profiligen und beleuchtet präventive Maßnahmen von Vereinen, Verbänden und Polizei.
Welche Fankategorien werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen konsumorientierten Fans (reine Freizeitbeschäftigung), fußballzentrierten Fans (hohe Verbundenheit zum Verein), erlebnisorientierten Fans (Sucht nach „spannenden“ Situationen), Ultras (fanatische Unterstützung, oft kritisch gegenüber der Vereinsführung) und Hooligans (gewaltorientiert).
Wie wird das Gewaltpotential der verschiedenen Fankategorien bewertet?
Das Gewaltpotential wird anhand der jeweiligen Fankategorie analysiert. Fußballzentrierte und erlebnisorientierte Fans werden als gewaltbereiter eingeschätzt als konsumorientierte Fans. Ultras und Hooligans weisen ein besonders hohes Gewaltpotential auf, wobei die Hooligans in ihrer Mitgliederzahl rückläufig sind. Die Polizei verwendet ein dreistufiges Kategorisierungssystem (A-C) zur Einschätzung des Störerpotentials von Fangruppen.
Welche Rolle spielt die Polizei bei der Bewertung und Prävention von Gewalt?
Die Polizei bewertet Fangruppen anhand eines dreistufigen Systems (A-C), wobei A friedliche, B gewaltbereite und C gewaltsuchende Fans repräsentiert. Die Polizei setzt präventive Maßnahmen wie Stadionverbote und die Datei „Gewalttäter Sport“ ein.
Welche präventiven Maßnahmen werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Fanprojekte und die Strategien der Polizei, darunter Stadionverbote und die Datei „Gewalttäter Sport“, als präventive Maßnahmen gegen Gewalt im Fußball.
Welche Bedeutung hat die Ultraszene für die Sicherheitslage?
Die Ultraszene wird als eine der Hauptursachen für das zunehmende Gewaltpotential betrachtet, besonders aufgrund ihrer organisierten Aktionen mit Pyrotechnik. Die Arbeit beschreibt die Strategien der Ultras, um Kontrollen zu umgehen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Fankultur, Fußballgewalt, Ultras, Hooligans, Gewaltprävention, Polizei, Fanprojekte, Stadionverbote, Kategorisierung, Sicherheitsmanagement, Gruppendynamik und Pyrotechnik.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, eine Kategorisierung der Fans, eine polizeiliche Bewertung der Fangruppen, eine Analyse des Gewaltpotentials, eine Betrachtung gewaltpräventiver Maßnahmen und ein Fazit. Sie beinhaltet auch ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel.
- Quote paper
- Jonas Klöpping (Author), 2019, Fangruppen im Fußball. Gewaltpotential, Sicherheitslage in Deutschland, gewaltpräventive Maßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014110