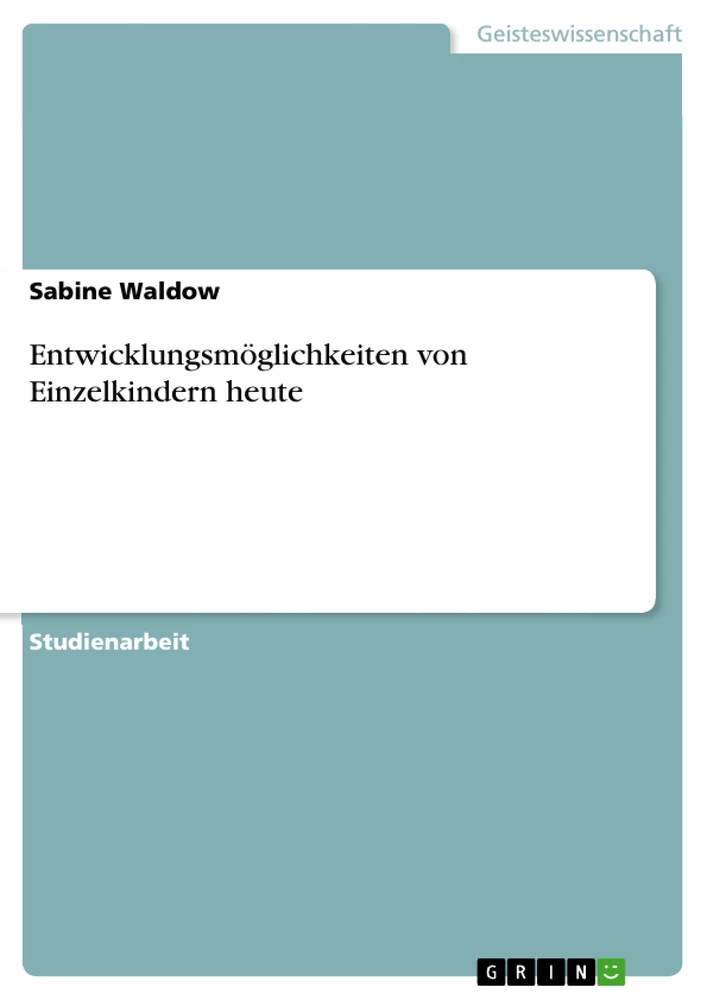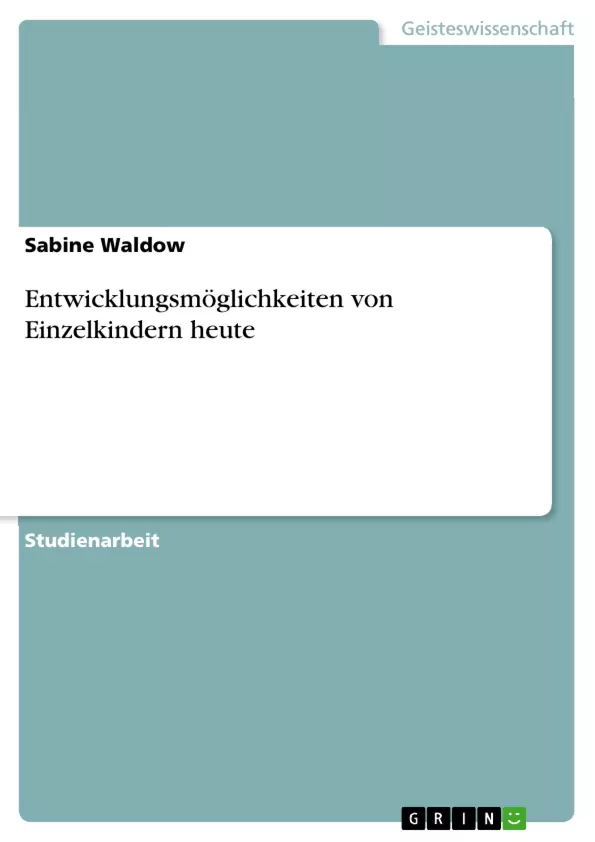Inhaltsverzeichnis
2 Einleitung
3 Spannungsfeld (Einzel)Kindheit - Lebensstil - Gesellschaft
4 Das Besondere der 3er - Konstellation
5 Vor- und Nachteile für Einzelkinder
5.1 Nachteile
5.2 Vorteile
6 Außenkontakte
7 Schluß
8 Literaturverzeichnis
2 Einleitung
“Einzelkindern werden bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben, die sich bei ihnen dadurch ausbilden, daß sie ohne Geschwister aufwachsen. Man betrachtet sie durchgängig als egoistisch, verzogen, verwöhnt, wehleidig, altklug, frühreif, rücksichtslos, unsozial, schlecht angepaßt, neurotizistisch, kontaktarm, introvertiert usw. - also insgesamt als typische Problemkinder mit Mängeln und Unzulänglichkeiten vor allem in sozial - zwischenmenschlicher Hinsicht. Nicht nur unter Laien, sondern auch unter vielen Sozialwissenschaftlern wird häufig stillschweigend vorausgesetzt, daß sich das Fehlen von Geschwistern nur oder weitgehend negativ auswirkt.”1
In der heutigen Zeit und vor allem in unserer westeuropäischen Gesellschaft nimmt die Zahl der geschwisterlos aufwachsenden Kinder ständig zu. Das hängt vor allem mit einem Wandel sowohl in den Geschlechterrollen als auch der Funktion einer Familie zusammen. Hierauf möchte ich in dieser Hausarbeit kurz eingehen, um anschließend ausführlicher darzustellen, mit welchen Lebensumständen ein Einzelkind konfrontiert ist. Ich werde herausarbeiten, was daran nachteilig für die kindliche Entwicklung sein kann, andererseits aber auch belegen, daß Einzelkinder letztlich zwar zum Teil andere, aber doch gleichwertige und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten haben wie Geschwisterkinder.
Aus den oben genannten gesellschaftlichen Veränderungen gehen allerdings sehr vielschichtige Lebensformen der Menschen hervor. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, etwa auf Kinder Alleinerziehender beziehungsweise Patchworkfamilien in verschiedensten Konstellationen einzugehen. Ich gehe in meinen Ausführungen von einem Einzelkind im Alter von 5 - 12 Jahren aus, bei dem zu erwarten ist, daß keine Geschwister mehr hinzukommen und das gemeinsam mit beiden Elternteilen aufwächst. Die Größe dieser Gruppe ist durchaus nicht zu unterschätzen, denn immerhin lebt mit 82,6% die Mehrheit der Einzelkinder in dieser Lebensform2.
3 Spannungsfeld (Einzel-)Kindheit - Lebensstil - Gesellschaft
Kindheit ist ein Lebensabschnitt des Menschen, in dessen Verlauf vielfältige und komplexe Denk- und Handlungsweisen entwickelt und erlernt werden. Darunter fallen eine Vielzahl einzelner Funktionsbereiche, die hauptsächlich die Kognition und - bei Kleinkindern - die Motorik und Sensorik betreffen. Daneben eignet sich das Kind vor allem im Alter von ca. 4 - 11 Jahren seine Umwelt an und erlernt angemessenes Rollenverhalten. Dieser Teil kindlicher Entwicklung definiert heute zumindest in den industrialisierten Teilen der Welt Kindheit klar als Lebensabschnitt, in dem der Mensch ”bestimmte Aufgaben zu bewältigen hat, aber von der Verantwortung der Erwachsenen frei bleibt.” Die umweltbezogenen Aufgaben des Kindes beziehen sich vor allem auf das Spielen, den Besuch von Kindergarten beziehungsweise Schule, die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht und den Umgang mit Gleichaltrigen. In wichtigen Entscheidungen ist es abhängig von Erwachsenen, kann ihnen diesbezüglich vertrauen, mit ihnen kooperieren und diskutieren.
Die soeben beschriebenen Entwicklungsschritte von Kindern laufen heute nicht mehr automatisch und parallel zum Alltag der Eltern ab. Wie gesagt wird Kindheit bewußt als ein spezieller Lebensabschnitt gesehen. Früher wurde von Kindern erhofft und verlangt, daß sie möglichst schnell erwachsen werden, um als Arbeitskraft sich selbst und die Familie mitzuversorgen und die Alterssicherung seiner Eltern zu gewährleisten3. Heute hat sich nicht mehr das Kind nach der Familie zu richten, sondern umgekehrt. Kinder haben demnach einen hohen Status in der Familie. Verschiedenste Faktoren führten zu dieser Veränderung. Sie betreffen neben dem einzelnen Kind auch die Funktion von Familie und den Charakter der Gesellschaft im allgemeinen.
Zunächst einmal besteht erst seit ca. 30 Jahren die Möglichkeit, von fast zu 100% sicherer Verhütung. Als Frau war man seit der Einführung der Pille nicht mehr der Willkür der Natur unterworfen, sondern besaß nun die Freiheit sich gezielt für oder gegen ein Kind zu entscheiden4. Diese neue medizinische Errungenschaft paßte sehr gut zu zwei Hauptsträngen gesellschaftlicher Veränderungen hin zur Moderne: Emanzipation der Frau und Industrialisierung.
Frauen sehen in ihrem Lebensentwurf nicht unbedingt und nicht nur Ehe, Hausfrau sein und Kinder bekommen vor. Berufstätigkeit und Selbstverwirklichung kommen als Zusatz oder Alternativen in Betracht. Neue Arbeitsmärkte ermöglichen der Frau - und in puncto Selbstverwirklichung auch dem Mann - das Ausleben dieser neuen Zielvorstellungen. Das Leben ist planbarer geworden durch entsprechende Verhütung und gleichzeitig vielschichtiger durch Industrialisierung und gesetzliche Gleichstellung von Mann und Frau. Daraus resultiert wiederum ein starker Trend zu Individualisierung. Verschiedenste Lebensformen, vom Single über die idealtypische Familie ( Vater, Mutter, Sohn, Tochter) bis hin zur durch Scheidung und Wiederheirat entstehenden Patchworkfamilie sind denkbar.
Das Leben des Einzelnen gleicht einem Baukastensystem: man kann wählen, zwischen verschiedenen Paar- und Familienkonstruktionen, Berufstätigkeit und Karriere ja oder nein, durch geregelte Arbeitszeit und Tariflöhne steht auch noch viel frei gestaltbare Freizeit zur Verfügung.
Für denjenigen, der sich für Partnerschaft und mindestens ein Kind entscheidet, hat dies in der Regel einen sehr hohen Stellenwert. Ehe und Familie sind nicht mehr aus materiellen Gründen da, sondern aus emotionalen. Herzlichkeit, Geborgenheit und gemeinsames Ertragen von Krisen gehen nicht mehr wie früher in der Großfamilie mit dem Alltag einher. Liebe und Zuwendung und gegenseitiger Halt wollen ganz bewußt erlebt werden. In der rationell orientierten Gesellschaft ist die Familie wie eine Insel geworden, mit der Funktion die jetzt vom beruflichen Alltag getrennten emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings scheint es immer noch zu den ungeschriebenen Verpflichtungen eines Paares zu gehören, zumindest mit einem Kind für Nachwuchs zu sorgen. Um nun auch beide Bereiche - Alltag und Beruf und Emotionalität wieder miteinander verbinden zu können, entscheiden sich immer mehr Paare für ein Einzelkind.
Das Einzelkind scheint die Lösung zu sein, in unserer rationellen Gesellschaft sämtliche Lebensbereiche aufrecht erhalten zu können und trotzdem eine vollständige Familie zu haben. Denn tatsächlich kostet ein einziges Kind weniger Energie und Geld als mehrere. Außerdem braucht eine Frau dann nicht so früh mit dem Kinderkriegen beginnen, um beim zweiten und dritten Kind körperliche Risiken zu vermeiden. Sie kann sich in Ruhe zunächst dem Beruf widmen, sich dort eine Stellung sichern und anschließend immer noch recht jung ein Kind bekommen.
Hiermit wäre die Erörterung wieder beim Ausgangspunkt angelangt, nämlich dem veränderten Status von Kindern in Gesellschaft und Familie. Sie geben ihren Eltern ”das wichtige Gefühl verantwortlich zu sein, zuständig zu sein, emotional notwendig zu sein und vor allem auch, sich selbst in der nächsten Generation verwirklicht und menschlich noch einmal repräsentiert zu sehen.” Kinder sind somit eine ”Methode” der Selbstverwirklichung.
Doch mit dem bewußten Streben nach Emotionalität geht an Eltern auch ein besonderer Anspruch bezüglich der Erziehung ihres Kindes einher. Das Kind soll ja schließlich in die individualisierte Gesellschaft eingepaßt werden. Und gerade weil die Gesellschaft so vielschichtig geworden ist, stellt dies für Eltern eine schwierige Aufgabe dar. Es besteht eine große Erwartung seitens der Gesellschaft an die Paare, sich das Kinderkriegen gut zu überlegen, denn das Kind soll optimal gefördert werden. Auch um diese Aufgabe bewältigen zu können, bekommen viele Paare nur ein Kind. In Deutschland ist der Anteil der Kinder, die Einzelkinder sind und aller Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben werden, ungefähr 1/5.
Im Zusammenhang mit dem ”Gebot der optimalen Förderung” sieht Kindheit heute folgendermaßen aus:
Weiterhin laufen in der Kindheit die eingangs beschriebenen Entwicklungsaufgaben ab. Sie werden von Erwachsenen jedoch viel bewußter und deutlicher beobachtet und beeinflußt als früher. Man möchte keine Chance auslassen ein entdecktes Talent seines Kindes zu unterstützen. Sich abzeichnende Schwierigkeiten in seiner Entwicklung wollen so weit wie möglich vermieden werden. Sowohl für die Talente als auch für die Probleme gibt es spezielle Einrichtungen außerhalb der Familie. Ganz im Sinne der Individualität sieht der Wochenablauf eines jeden Kindes anders aus. Der Eine besucht Fußballtraining, Pfadfinder und Logopädin, die Andere Gesangsunterricht, Krankengymnastik und Theatergruppe. Auf jeden Fall aber muß das Kind zwar nicht mehr wie früher harte körperliche Arbeit zu verrichten, dafür hat es jetzt einen Terminkalender, in dem die unterschiedlichsten Fördermaßnahmen notiert sind. Zu den allgemeinen Entwicklungsaufgaben ist also die Aufgabe hinzugekommen, sich schon als Kind so weit wie möglich fortzubilden und zu individualisieren. Als letzten Punkt soll das Kind noch die emotionalen Bedürfnisse seiner Eltern befriedigen. So ist in vielen Familien beispielsweise durchaus der Sonntag noch gleich Familientag. Damit bei diesen vielen Bestrebungen des Kindes nichts schiefgeht, bilden sich die Eltern ihrerseits ebenfalls fort. Noch nie war das Laienfachwissen in Psychologie und Pädagogik so hoch wie heute. Unendlich viele Erziehungsratgeber und entsprechende Kurse und Vorträge wollen den Eltern helfen, Erziehungsfehler zu umgehen. Hier schließt sich wieder der Kreis beim Ausgangspunkt ”optimale Förderung”5.
4 Das Besondere der 3er - Konstellation
In der Literatur finden sich zum Teil widersprüchliche Aussagen über die charakterliche Entwicklung von Einzelkindern:
“... die starke Orientierung auf Erwachsene und damit auf Erwachsensein, aber auch das Kreisen um die eigene Person, ihre Rechte und Ansprüche6.”
“Mir fällt auf, daß ein Einzelkind selten allein kommt - häufig sind Freund(e) oder Freundin(nen) dabei.7 ”
Nach Kürthy schätzen Einzelkinder sich selbst zu 85% als unabhängig und zu 99% als sehr oft aufgeschlossen ein8. Auch ihre Familie empfinden sie zu 72% als aufgeschlossen9.
Diese Widersprüche liegen vermutlich in der Unterschiedlichkeit der Forschungsansätze der jeweiligen Autoren und dem zum Verfassungsdatum herrschenden Zeitgeist. Man kann also nicht sagen, das Eine sei typisch Einzelkind, das Andere falsch erforscht. Was ist aber dann typisch Einzelkind? Auf jeden Fall weicht die Familienkonstellation von unserem Leitbild, wie eine Familie idealerweise sein sollte ab. Diese ideale Familie besteht aus Mutter, Vater, Tochter und Sohn, so daß sowohl das Verhältnis der Geschlechter ausgewogen ist, als auch das der Generationen10. Die Kinder haben die Möglichkeit sich ‚nach oben‘ an ihren Eltern zu orientieren und ‚seitlich‘ zum Geschwister. Das trifft auf eine Dreier- Konstellation aus Vater, Mutter, Kind nicht vollständig zu. Die “horizontale Orientierung” am Geschwister fällt für das Einzelkind weg und auch die Geschlechter sind nicht ausgewogen. Es existieren insgesamt nur vier Beziehungsspähren:
1. die drei als eine Einheit
2. die Vater - Kind - Sphäre
3. die Mutter - Kind - Sphäre
4. die Eltern untereinander
Die Beziehungen sind also deutlich weniger komplex als in einer größeren Familie11. Ob die jeweilige Familienkonstellation sich vorteil- oder nachteilhaft für das Kind erweist, hängt beim Einzelkind viel mehr als beim Geschwisterkind von den Eltern ab. Ihre Einflüsse wirken sich bei ihm unmittelbarer aus, da Vater und Mutter ja innerhalb der Familie als einzige das Kind beeinflussen12. Es steht in besonderem Maße im Mittelpunkt. Dadurch besitzt es auch eine sehr hohe Sprengkraft für die Elternsphäre. Die Stellung eines geplanten Einzelkindes ist auch insofern unvergleichlich, daß es oft mit hohen Erwartungen von Eltern und anderen Verwandten, wie zum Beispiel den Großeltern empfangen wird13. Es besitzt also gleichzeitig eine extrem starke und schwache Position in der Familie. Durch die Dreierkonstellation besteht immer die Möglichkeit von Koalitionen zweier Personen gegen die dritte. In dem Fall Mutter oder Vater mit Kind gegen das zweite Elternteil, besitzt das Kind sehr viel Macht. Im Falle eines Bündnisses der Eltern gegen das Kind hingegen herrscht auf dessen Seite große Ohnmacht14.
Wozu Geschwister ?:
Ausgehend von der idealtypischen Familie heißt also, keine Geschwister zu haben läßt dem Einzelkind - betrachtet man es lediglich als Mitglied seiner Familie - eine ganze Sozialisationsinstanz bzw. Bezugsperson fehlen. Geschwister bilden ein soziales System mit unterschiedlichen Rollen und wechselseitigen Beziehungen. Sie stellen auf diese Weise ein soziales Übungsfeld dar15: Mit Rivalität, Konflikten, der Notwendigkeit des Teilens umzugehen kann erlernt werden, auch gemeinsames Spielen steht auf dem Programm. Geschwisterkinder haben die Möglichkeit, Aussagen und Handlungen ihrer Eltern gemeinsam zu diskutieren und zu bewerten. Diese Reibungsverluste durch zusätzliche Orientierung an weiteren Familienmitgliedern bestehen beim Einzelkind nicht, das grundsätzliche Bedürfnis nach Orientierung will aber trotzdem gedeckt werden. Das Kind ist ganz auf die Eltern bezogen und mißt sich an ihnen16.
Im Kleinkindalter, wo Geschwister zum Beispiel als Spielgefährten auftreten, spürt das Einzelkind bewußt deren Fehlen und erlebt dies als Nachteil. Die Eltern können eben nicht immer als gute Mitspieler genügen. Vorteile ohne Geschwister werden nicht gesehen17.
Dreierfamilien sind aber wegen der fehlenden Bezugsperson Geschwister nicht unbedingt gleich als sozialer Problemfall anzusehen. Die Möglichkeit der horizontalen Orientierung muß eben durch andere Sozialisationsinstanzen außerhalb der Familie ausgeglichen werden.
Familie kann als System verstanden werden, in dem sich die Angehörigen laufend gegenseitig beeinflussen und sich gemeinsam von der Außenwelt abgrenzen. Gleichzeitig weist sie allgemeine Eigenschaften einer Gruppe auf: es findet ein ständiges Streben nach Fortschritt beziehungsweise nach dem Erreichen eines bestimmten Zieles statt. Dabei läßt sie sich leiten durch Anstöße ihrer Mitglieder selbst18. Je kleiner eine Gruppe ist, desto weniger verschiedene Meinungen, Ideen usw. sind verfügbar. Das bedeutet wiederum, daß kleine Gruppen stärker auf Impulse von außen angewiesen sind und leicht aufnahmebereit dafür19. Gleichzeitig bestehen unter den Einzelnen enge Bindungen, so daß ein Interessensabgleich durch ein hohes Maß an Vertrautheit und Offenheit und durch die recht geringe Zahl der in Einklang zu bringenden Interessen leicht fällt. Das sind gute Voraussetzungen für Harmonie in einer Einkindfamilie.
Daneben gibt es weitere, die Sozialisation des Einzelkindes begünstigende Faktoren: “Eltern haben heute einen hohen Erziehungsanspruch an sich selbst.” “Das Laienwissen um die Psyche des Kindes war noch nie so hoch wie heute20.” Folglich werden Eltern die erhöhte Notwendigkeit von Außenkontakten für ihr einziges Kind und eventuelle Schwierigkeiten kennen.
5 Vor- und Nachteile für Einzelkinder
Es wurde festgehalten, daß die Dreierkonstellation von der idealtypischen Familie abweicht. Es drängt sich in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage nach der Andersartigkeit auf, sondern auch die Frage nach Vor- und Nachteilen von Einkindfamilien:
5.1.Nachteile
1. Zwei gegen einen
“ Ich bin ein Single. Das ist eine total einsame Sache. Wenn ich mal was anstellen will, fehlt mir immer der zweite Mann. Wenn ich etwas Verrücktes gemacht habe, habe ich nie einen Bundesgenossen, der mir hilft. Man ist immer allein den Eltern ausgeliefert 21. ”
Dieses Zitat eines 13jährigen umreißt schon eine der Schwierigkeiten eines Einzelkindes in seinem täglichen Leben. Eltern sind oft der Auffassung, in ihrem erzieherischen Verhalten konsequent und vor allem geschlossen auftreten zu müssen, damit das Kind nicht beide gegeneinander ausspielt22. In der kindlichen Entwicklung ist es jedoch ganz normal, daß das Kind Wünsche äußert, welche die Erwachsenen ablehnen oder das Kind sich gewisse Fehler und Frechheiten leistet. In einer solchen Situation sieht sich das Einzelkind seinen Eltern ganz allein gegenüber. Es kann zwar versuchen, sich gegen die Eltern zu wenden, doch ist dies ohne einen Koalitions-partner, wie es Geschwister sein können, schwer zu ertragen. Durch die Übermacht der Eltern müssen Einzelkinder oft Dinge für sich behalten, schlucken. Hinzu kann kommen, daß ja auch die Eltern sich eventuell nicht immer einig sind in Erziehungsfragen. Wollen sie trotzdem geschlossen auftreten, muß ein Partner seinen Standpunkt aufgeben und dem Kind gegenüber Äußerungen machen, die nicht seinem eigentlichen Empfinden entsprechen. Für derartige Unechtheit haben Kinder allerdings ein gutes Gespür. Besonders natürlich das Einzelkind, da es ja zu Hause ständig auf die Eltern konzentriert ist. Es wird nicht auch noch von einem Geschwister in Anspruch genommen und kann übermäßig viel von den Stimmungen und partnerschaftlichem Verhalten der Eltern beobachten. Folglich wird das Kind eine unechte Aussage spüren. Diese Doppelbotschaft - etwas wird gesagt, das sich vom tatsächlichen Empfinden unterscheidet- verwirrt das Kind23.
Bei einem frontalen Erziehungsstil Eltern gegen Kind stellt sich auch die Frage, wo Kinder Raum haben, Aggressionen auszuleben. Geschwister können sich gegenseitig als Blitzableiter benutzen. Einzelkinder werden als Ersatz wohl kaum ihre Freunde heranziehen, denn zu groß erscheint ihnen die Gefahr diese zu verlieren. Die Eltern selbst müßten also bereit sein, Aggressivität ihres Kindes auszuhalten, ohne sofort mit Strafen - darunter fällt auch Liebesentzug - zu reagieren. “Eltern die auf ihre Macht pochen, werden ein solches Verhalten wohl nicht zulassen können. Eltern die [...] ihrem Kind permanent mit übergroßer Nachgiebigkeit begegnen, können Gefahr laufen, auch noch ihr letztes bißchen Selbstbehauptung ihrem Kind gegenüber zu verlieren24.” Da viele Eltern bei der Erziehung ihres ersten Kindes sehr unsicher bezüglich des richtigen Stils sind, kann sich das Einzelkind einem Wechselbad ambivalenten Elternverhaltens oder einem Extrem ausgesetzt sehen.
2. Überbehütung und Projektion
“ Ich bin ein Einzelkind. Den ganzen Tag sind die Eltern um mich rum. Sie haben ja nur mich. Sie gucken dauernd was ich mache. Auch mußich dauernd ihre Streicheleien aushalten 25. ”
Unser ein und alles - dieses an sich liebevoll gemeinte elterliche Gefühl kann für Einzelkinder durchaus als “Schuß nach hinten” losgehen. Ihre Kinder stark unter ihrem Einfluß ist sicherlich ein natürliches Bedürfnis aller Eltern. Bei Geschwistern verteilt sich die Aufmerksamkeit allerdings auf mehrere Schützlinge. Das Einzelkind muß die Überbehütung allein aushalten oder von sich weisen. “ Zu häufig lassen Erwachsene Kinder einfach nicht in Ruhe. Sie dringen in die private Sphäre ihrer Zimmer ein, drängen sich in ihre persönlichen und privaten Gedanken oder weigern sich ihnen ein Einzeldasein zuzugestehen”. Solche Grenzüberschreitungen geschehen nicht in böser Absicht, sondern aus Sorge und dem Bedürfnis alles Bestmögliche zu bieten. Kinder werden dadurch von allen eventuellen Gefahren und unangenehmen Situationen ferngehalten. Wie soll ein Kind dann aber erfahren, wo seine persönlichen Stärken und Schwächen liegen und lernen, sich selbständig auf neue, vielleicht abenteuerliche Wege zu begeben26 ? Das Kind wird durch Überbehütung “um die Erfahrungen schrittweiser Entfernung vom Elternhaus [gebracht], auch die Erfahrungen des Stolperns und des sich - wieder - aufrappelns. Allzu schnell gewöhnt es sich an helfende Arme, die es immer wieder auffangen. Die Standfestigkeit der eigenen Füße kann so nur mühsam trainiert werden27.”
Eine Steigerung von Überbehütung ist die Projektion elterlicher Wünsche auf das Kind. Manche Eltern möchten ihrem Kind genau das zugute kommen lassen, was sie selbst in ihrer Kindheit vermißten oder erwarten von ihm, zu erreichen, was sie nicht geschafft haben. Dabei wird übersehen, daß den Nachwuchs nicht zwangsläufig die gleichen Dinge glücklich machen. Auch in diesem Punkt verteilt sich die Last bei Geschwistern auf mehrere Schultern. Abwehrreaktionen werden von Eltern oft als Undankbarkeit gewertet, beziehungsweise als Versagen. Das wiederum übt einen hohen Druck auf das Kind aus, sich das nächste Mal angepaßter zu verhalten, um die geliebten Eltern, von denen es ja auch noch abhängig ist, nicht zu enttäuschen. Von den Eltern wäre vielmehr gefragt, die eigenen Vorstellungen ihres Kindes zu akzeptieren und ihm so den Weg zu einer eigenen Identität zu öffnen28.
3) Konfliktfähigkeit
“ Es gibt nicht soviel Streit. Geschwister sind nervig29. ”
Dieses Einzelkind formuliert seine Geschwisterlosigkeit als Vorteil. Gerade wenn es um das Austragen von Konflikten geht, sind Geschwister aber gute Lernpartner. Mit seinen Eltern zu streiten, macht für das Einzelkind wenig Sinn. Es wäre ein ungleicher Machtkampf. Echte Rivalitätskämpfe kann es also nicht erleben. Es kommt selten in die Situation, einen Kampf aushalten zu müssen, ohne Ausweichmöglichkeiten zu haben. Auch in Strategien der Wiederannäherung erfährt es keine Übung. Das Resultat kann fehlende Durchsetzungskraft gegenüber anderen sein. Es ist nicht gewohnt ein Ziel schrittweise zu erreichen. Anstatt dessen hat es ein ausgeprägtes das-steht-mir-zu-Gefühl und gerät in ein Dilemma, wenn dieses erschüttert wird, da es nicht gelernt hat seine Ansprüche zu verteidigen. Häufig verzichten Einzelkinder lieber auf einen Wunsch, als in die Offensive zu gehen. Das kann darauf zurückgeführt werden, daß sie nicht die Möglichkeit haben Sieg und Niederlage, Wut und Zuneigung im täglichen Wechsel zu erfahren30.
5.2 Vorteile
1) Alle Wünsche erfüllt
“ Es gibt nicht soviel Streit. Geschwister sind nervig 31. ”
Dieses Zitat wurde bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt und als Nachteil des Einzelkinddaseins interpretiert. Es läßt jedoch auch eine andere Sichtweise zu: Einzelkinder haben eindeutig “mehr Freiraum, ihre Individualität auszuleben. In Geschwisterreihen gibt es hingegen oft eine starre Rollenverteilung, die das Ausprobieren verschiedener Positionen schwer zulassen. Einzelkinder müssen nicht ständig auf Trab sein, um Machtkämpfe auszuhalten oder der Erfüllung ihrer Wünsche hinterher zu hetzen. Das Erlernen von Konfliktfähigkeit kann in ausreichendem Maße auch im Kontakt mit den Eltern, im Kindergarten und in der Schule stattfinden. Im vertrauten Familienrahmen aber wächst das Kind ohne Wettbewerb auf und lernt so, den Motiven anderer zu vertrauen. Einzelkinder genießen sehr viele Rechte, ohne sich erheblich einschränken zu müssen. Meist haben sie ein eigenes Zimmer (bei Geschwistern nicht unbedingt gewährleistet), genug Taschengeld und bekommen zu Weihnachten oder Geburtstag im großen und ganzen ihre Wünsche erfüllt. In Familien mit mehreren Kindern müssen meist Abstriche gemacht werden, da die finanziellen Kapazitäten schneller ausgeschöpft sind32. Dieser Rundumversorgung entgegen spricht die These Einzelkinder lernten nicht zu teilen. Im Gegenteil jedoch wird “ein Kind, das lange genug egoistisch, habgierig, asozial sein durfte, von selbst einmal spontane Freude am Teilen und Geben bekommen33.” Das fällt Einzelkindern besonders leicht, denn sie mußten früher nie ihre Habe gegen andere verteidigen. Es war niemand da, der die hätte streitig machen können. Das Kind teilt dann also nicht aus antrainiertem Verhalten heraus, sondern aus eigener Motivation34.
Dem Einzelkind verleiht seine einzigartige Position sehr viel Raum und Ruhe, was sich auf seine Entwicklung förderlich auswirkt.
2) Geduldige und einfühlsame Eltern
“ Ich habe keine Geschwister. Das ist ganz schön, weil ich dann nicht neidisch werden kann. Ein Einzelkind ist immer zufrieden, weil ihm alles allein gehört, sogar die Eltern 35. ”
Unter den Einzelkindern sollen die geplanten und erwünschten Kinder weitaus stärker repräsentiert sein, als in größeren Familien. Eltern, die sich ihrer Entscheidung bewußt und sicher sind, werden ihrem Kind auch entsprechend positiv begegnen. Das Kind erfährt, daß seine Eltern nur es allein lieben. Das gibt ihm das Gefühl, einzigartig und konkurrenzlos zu sein. Es bekommt dadurch viel Sicherheit, Vertrauen und Kraft. Sein natürliches Bedürfnis nach Zuwendung wird vollends gesättigt. Es kann in Zeiten seelischer Not auf dieses “Polster” zurückgreifen und vorübergehend auch gut mit einem Mangel auskommen36.
Die Eltern eines Einzelkindes haben neben mehr Liebe für ihr Kind auch mehr Geduld und Toleranz. An ihren Nerven rütteln eben nicht mehrere Kinder, die auch einmal Unsinn anstellen. Dementsprechend sind sie nicht so leicht genervt, sondern haben Energie übrig, ihrem Nachwuchs seine Fehltritte zu erklären. Das Kind erfährt, auch geliebt und akzeptiert zu sein, ohne perfekt zu funktionieren. Einzelkindeltern kommen auch mit weniger Strafen aus, ohne dabei inkonsequent zu sein. Auf nur ein Kind kann in einer Familie einfach intensiver eingegangen werden. Das Kind kann eventuelle Probleme, zum Beispiel in der Schule, mit den Eltern gemeinsam angehen, da sie sich sehr viel Zeit für es nehmen. Es wird in seinen Ängsten ernst genommen und kann durch den Schutz seiner Eltern mehr Schonraum genießen. Es kann sich vorsichtig Lebensbereichen außerhalb der Familie nähern, dabei Selbständigkeit trainieren ohne jemals den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Einzelkindeltern haben mehr Gelegenheit, ihren eigenen Wünschen nachzugehen. Beispielsweise die Berufstätigkeit der Mutter läßt sich mit nur einem Kind wesentlich einfacher organisieren. Es kann gut auch einmal woanders untergebracht, oder gar zu vielen Aktivitäten mitgenommen werden. Die Eltern profitieren ihrerseits mit mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, was sich wiederum positiv auf die Beziehung zum Kind auswirkt37.
Das Kind hat noch den weiteren Vorteil, seine Eltern in verschiedenen alltäglichen Lebenssituationen beobachten zu können. Es erfährt auf diese Weise ganz selbstverständlich viel über Strategien der Lebensbewältigung. Gleichzeitig wirkt es auf ein Kind entlastend, wenn das soziale Engagement seiner Eltern sich auf mehrere Lebensbereiche verteilt, so daß es nicht ständig unter Beobachtung der Eltern steht.
3) Integrationsfähigkeit
Ein Einzelkind sieht sich häufig hohen Erwartungen seiner Eltern ausgesetzt. Hinzu kann kommen, daß Vater und Mutter unterschiedliche Wünsche an ihr Kind haben. Das bietet dem Kind ein spezielles Lernfeld: es lernt, andere Menschen sehr genau zu beobachten und ihre Launen und Bedürfnisse zu erspüren. In der Folge kann es sich auch in kontroversen Situationen gut in andere Personen hineinversetzen und adäquat reagieren. Deshalb wird Einzelkindern eine ausgezeichnete Fähigkeit zu Kooperation und Integration zugeschrieben. Diese in der Einkindfamilie optimal und schon früh erlernbaren Qualitäten sind gerade heute in allen Lebensbereichen gefragt38.
6 Außenkontakte
Kontakte eines Kindes zu Gleichaltrigen finden in der Regel stark über Kindergarten und später die Schule statt. Weiterhin können in Vereinen, der Nachbarschaft und sonstigen organisierten Treffs Begegnungen und Bekanntschaften gemacht werden. Jede dieser Schnittstellen kann als eigene Sozialisationsinstanz betrachtet und erörtert werden. Ausgehend von der Feststellung, daß Einzelkinder insgesamt in erhöhtem Maß auf Kontakte außerhalb der Familie angewiesen sind, lassen sich die verschiedenen Bereiche hier aber auch allgemein als Außenkontakte zusammenfassen. “Erwachsene können für ihre Kinder gute Spielgefährten sein. [...]ein Spiel zwischen den Eltern und ihrem Kind wird immer anders aussehen, als ein Spiel von zwei oder mehreren Kindern miteinander. Eltern sind keine Kinder mehr. Sie sind Erwachsene, die eine Vielzahl von Regeln, Zielen und Normen in ihrem Hinterkopf haben, die sie auch beim Spielen nicht wegwischen können. Erwachsene mögen nach wie vor phantasievoll sein, doch sieht ihre Phantasie anders aus als die von Kindern.” ”Von KindergärtnerInnen, LehrerInnen, Freunden der Eltern [...] kann das Kind abschauen wie sich Erwachsene verhalten...” “Es kann von ihnen nicht lernen wie Kinder sich untereinander verhalten. Ein Kind kann sich fairerweise auch nicht mit Erwachsenen vergleichen39.” Folglich brauchen Kinder zur Erweiterung ihrer sozialen Kompetenz ”offenbar nicht nur Erwachsene [...] sondern auch gleichaltrige Kinder als Interaktionspartner, die nicht den Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung haben wie Erwachsene.” “Während das Verhältnis zu den Erwachsenen vor allem durch konformes Verhalten, zugestandene Belohnungen und Verständnis seitens der Erwachsenen ausgestaltet wird, geht es unter Kindern um gemeinsames Spiel, um Teilen und gegenseitige Unterstützung, Verständnis40 ” und Kräftemessen. Es messen sich hier Personen mit relativ gleichen Voraussetzungen. “Aus einem solchen fairen Vergleich heraus, können sie ihre eigene Kräfte entfalten und mit ihnen wachsen. [...] Hier können sie ihre Schwächen und Stärken erfahren...41 ”. “Vertikale und horizontale Orientierung sollten also in einem Gleichgewicht stehen. [...] Horizontale Orientierung dient dem Erwerb von sozialer Routine, dem Erleben von Kooperation und Konfliktstrategien zur Bewährung von Alters- und Geschlechterrollen42.”
Aus in anderen Kapiteln genannten Gründen ist all dies für das Einzelkind doppelt wichtig. Es muß die fehlende Geschwistersphäre, in der unter anderem soziale Kompetenzen geübt werden, durch noch intensivere Kontakte mit Gleichaltrigen ersetzen. Hierbei sind vor allem auch die Eltern gefragt. “Eine zu starke Einbeziehung in die Elternsphäre macht die Außenwelt für das Kind zu einem gefährlichen Gefilde, wo es sich nur Wunden holen kann43.” Eltern müssen ihrem Kind so früh wie möglich anbieten, über den Tellerrand der Familie hinauszusehen. Kinder haben auch von sich aus ein natürliches Bedürfnis nach Kontakt mit anderen Kindern. Ein gutes Beispiel dafür ist häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beobachten, wenn zwei Mütter mit ihrem Kinderwagen sich zufällig im gleichen Bus befinden. Die Kleinkinder beäugen sich meist ganz von allein, lächeln sich an und kommen einander so näher.
Einzelkindeltern sollten keine Gelegenheit auslassen ihren Nachwuchs dahingehend zu fördern. Dies wird erleichert durch die Möglichkeiten via Telefon, e-mail, Auto etc. sich auch kurzfristig mit Freunden zu verabreden. Der Kindergartenbesuch ist dabei ein zentraler Punkt, doch auch vorher sollten schon Begegnungen zum Beispiel in der Nachbarschaft, Krabbelgruppen etc. gemacht werden. Ein Einzelkind, das zum Schuleintritt kaum auf den Umgang mit anderen Kindern vorbereitet ist, wird dort erhebliche Probleme im Sozialverhalten haben und vielleicht tatsächlich zum Stereotyp eines Einzelkindes heranwachsen. Ob ein Einzelkind Außenkontakte hat und wenn ja welcher Art ist also eine zentrale Frage in seiner Entwicklung. Für Einzelkinder besteht sowohl durch ihre Angewiesenheit auf Kontakte als auch durch die hohe Durchlässigkeit einer Dreierfamilie eine besondere Chance und gleichzeitig Gefahr : Sie suchen stark nach Identifikationsfiguren. Sind die Eltern gut in der Lage dies sowohl zuzulassen als auch zu überblicken und zu lenken, wird das Kind sich in positiver Umgebung sozialisieren. Finden die Eltern in dieser Aufgabe keine Ausgewogenheit, ist es auch möglich, daß ihr Kind negativen Einflüßen schlecht standhalten kann. Als Einzelkind ist es sowohl positiv als auch negativ in besonderem Maß zu beeinflussen. “Entscheidend ist, welchen Bezugsgruppen [es] sich angeschlossen und wie es die Anregungen, die es von dort erhielt, verarbeitet hat.” Ein positives Verhältnis zu den Eltern hilft negative Einflüsse zu kompensieren. Ist jedoch auch dieses belastet, ist das Kind gefährdet44.
Fakten über die Außenkontakte von Einzelkindern zeigen aber, daß sie in der Häufigkeit bzw. der Intensität anderen Kindern hinter anderen Kindern nicht zurückstehen. Sie haben nicht weniger Freunde als andere und sind unter ihresgleichen durchaus beliebt. Beim Spielen zeigen sie sich kooperativ45. Die Beziehungen zu Gleichaltrigen gestalten sich häufig sehr intensiv. Einzelkinder haben insgesamt zu weniger verschiedenen Personen als Geschwisterkinder Kontakt, dafür aber häufiger, das heißt intensiver46. Sie suchen nach stabile Beziehungen und wählen dabei gründlich aus. Die Außenkontakte werden meist nach gezielten Gesichtspunkten wie z.B. “gleiche Wellenlänge” gewählt47. Das alles weist auf eine mindestens durchschnittliche soziale Aktivität von Einzelkindern hin.
7 Schluß
Aus der Literatur ging hervor, daß Einzelkinder ein hochaktuelles Thema soziologischer, psychologischer und pädagogischer Forschung sind. Die Wissenschaft steht den Entwicklungen des Wertewandels der Gesellschaft und der Verlagerung von Geschlechterrollen und Familienfunktion und der daraus resultierenden Zunahme von Einzelkindern noch unsicher gegenüber. Daher auch die zum Teil widersprüchlichen Aussagen zum Charakter von Einzelkindern. Oft stellt die Literatur auch relativ engstirnig entweder die Chancen oder die Gefahren für Einzelkinder dar. Das sind Extreme, die in der Realität zwar vorkommen, aber in ihrer Reinform sicher nicht die durchschnittliche Lebenslage von Einzelkindern repräsentieren.
Übereinstimmung war vor allem in folgenden Punkten zu erkennen:
- Die Zunahme ist im Zusammenhang mit der heutigen Individualisierung und Rationalisierung in der Gesellschaft zu sehen.
- Einzelkinder leben in einer Familienform, in der einfach andere Sozialisations- bedingungen vorherrschen als beispielsweise in der idealtypischen Familie.
- Die Erziehung eines Einzelkindes birgt gewisse Fehlerquellen, aber auch Chancen für das Kind.
- Die fehlende Sozialisationsinstanz “Geschwistersphäre” muß und kann durch Außenkontakte ausgeglichen werden.
Inwieweit ein Einzelkind nun stärker von den beschriebenen Vor- oder Nachteilen profitiert, kann nicht pauschal gesagt werden. Das hängt von dem jeweiligen Erziehungsstil und Bindungsverhalten der Eltern ab. Folglich sind auch die kurz beschriebenen Vorurteile gegen Einzelkinder so nicht haltbar. Sie stützen sich nur auf die Gefahren. Letztlich fällt den Eltern die Aufgabe zu, den Mittelweg zwischen Nähe und Distanz zu ihrem Kind zu finden und sinnvoll mit gesellschaftlichen Gegebenheiten zu verknüpfen. So ebnen sie dem Nachwuchs den Weg in ein selbständiges (individuelles!) Leben. Stimmig und positiv wäre also ein Erziehungskonzept wie Kürthy es beschreibt: “Wer ein Kind binden will, der muß es laufen lassen. Bindung ist dann eben keine Abhängigkeit, sondern eine Beziehung, die Sicherheit vermittelt. Das Kind [...] fühlt sich durch eine solche Bindung nicht eingeengt, hat es nicht nötig, den Kampf aufzunehmen, sondern fühlt sich sicher, akzeptiert und frei zugleich48.” Ein solcher Erziehungsstil wird Eltern dadurch erleichtert, daß sie ja ihre Energie nicht einzig und allein auf ihr Kind lenken, sondern heute in der Regel auf weitere Lebensbereiche. Von daher ist es unwahrscheinlich, daß ein Einzelkind zum alleinigen Lebensinhalt der Eltern wird, das heißt die Gefahr einer starren Bindung ist kaum vorhanden. “In den meisten Fällen ist die Beziehung eines Einzelkindes weder durch eine sehr starke Kontrolle, noch durch extreme Toleranz gekennzeichnet, sondern liegt irgendwo dazwischen49.”
Im Durchschnitt läßt sich also die These, Einzelkinder hätten andere aber denen von Geschwisterkindern gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten bestätigen!
8 Literaturverzeichnis
Beck, Ulrich und Beck-Gernsheim, Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe, Frankfurt, 1990
Beer, Ulrich: Die Einzelkind - Gesellschaft, Auf dem Weg zum kollektiven Egoismus?, München, 1994
Dörpinghaus, Eva: Das Einzelkind und die Besonderheiten bei seiner Erziehung, München, 1992
Kasten, Hartmut: Einzelkinder, Aufwachsen ohne Geschwister, Heidelberg, 1995
Kürthy, Thomas: Einzelkinder, Chancen und Gefahren im Vergleich mit Geschwisterkindern, München 1988
Krappmann, Lothar: Sozialisation in der Gruppe der Gleichaltrigen S. 355 - 375 in: Hurrelmann, Klaus und Ulich, Dieter (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung, 5.Auflage, Weinheim 1998
Kreppner, Kurt: Sozialisation in der Familie S.321 - 334 in: Hurrelmann, Klaus und Ulich, Dieter (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung, 5.Auflage, Weinheim 1998
Oerter, Rolf: Kindheit S.249 - 309 in: Oerter, Rolf und Montada, Leo (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, 4.Auflage, 1998 Weinheim
Rollin, Marion: Typisch Einzelkind, Das Ende eines Vorurteils, Hamburg 1990
Rossberg, Ewa: Einzelkinder, Hamburg 1981
[...]
1 Kasten, 1995, S.11f.
2 vgl. Kasten, 1995, S.24
3 vgl. Oerter, 1998, S.249F.
4 vgl. Dörpinghaus, 1992, S.11f.
5 vgl. Beck / Beck-Gernsheim, 1990, S. 135ff.
6 Beer, 1994, S.113
7 Rossberg, 1981, S.49
8 vgl.Kürthy, 1988, S.66
9 vgl. Kürthy, 1988, S.60
10 vgl. Kürthy, 1988, S.13
11 vgl. Kürthy, 1988, S.20
12 vgl. Kürthy, 1988, S.9
13 vgl. Beer, 1994, S.19ff.
14 vgl. Kürthy, 1988, S.39
15 vgl. Beer, 1994, S.28
16 vgl. Beer, 1994, S.26
17 vgl. Kürthy, 1988, S.15
18 vgl. Kreppner, 1998, S.323
19 vgl. Kürthy, 1988, S.20
20 Rossberg, 1981, S.85
21 Kasten, 1995, S.2
22 Dörpinghaus, 1992, S.93
23 ebd.
24 Dörpinghaus, 1992, S.100f.
25 Kasten, 1995, S.2
26 Dörpinghaus, 1992, S.109f.
27 Rollin, 1990, S.201
28 vgl. Dörpinghaus, 1992, S.105f.
29 Kasten, 1995, S.5
30 vgl. Rollin, 1990, S.221ff.
31 Kasten, 1995, S.4
32 vgl. Rollin, 1990, S.57f.
33 Rollin, 1990, S. 86f.
34 vgl. Rollin, 1990, S.38
35 Kaste, 1995, S.3
36 vgl. Rollin, 1990, S.79f u.97
37 vgl. Rollin, 1990, S.84ff.
38 vgl. Rollin, 1990, S.199f
39 Dörpinghaus, 1992, S.56ff.
40 Krappmann, 1998, S.355f.
41 Dörpinghaus, 1992, S.58
42 Kürthy, 1988, S.22
43 Kürthy, 1988, S.21
44 vgl. Kürthy, 1988, S.22ff.
45 vgl. Rossberg, 1981, S.87
46 vgl. Kasten, 1995, S.85
47 vgl. Rossberg, 1981, S.87
48 Kürthy, 1988, S.22
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht die Vor- und Nachteile des Aufwachsens als Einzelkind in der modernen westeuropäischen Gesellschaft, wobei gesellschaftliche Veränderungen, Lebensstile und die Entwicklung des Kindes berücksichtigt werden. Es analysiert, inwieweit Einzelkinder andere Entwicklungsmöglichkeiten haben als Kinder mit Geschwistern.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussen die Zunahme von Einzelkindern?
Die Emanzipation der Frau, die Industrialisierung, die sichere Verhütung und ein Wandel in den Geschlechterrollen und der Funktion der Familie tragen zur steigenden Zahl von Einzelkindern bei. Das Leben ist planbarer und vielschichtiger geworden, was zu einem Trend zur Individualisierung führt.
Welche Vor- und Nachteile werden für Einzelkinder diskutiert?
Zu den Nachteilen gehören die mögliche Übermacht der Eltern ("zwei gegen einen"), Überbehütung, Projektion elterlicher Wünsche, und Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Konfliktfähigkeit. Vorteile sind unter anderem die Erfüllung von Wünschen, geduldige und einfühlsame Eltern und die Förderung der Integrationsfähigkeit.
Welche Rolle spielen Außenkontakte für Einzelkinder?
Außenkontakte, insbesondere zu Gleichaltrigen (Kindergarten, Schule, Vereine), sind für Einzelkinder besonders wichtig, um die fehlende Geschwistersphäre auszugleichen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Die Eltern spielen eine wichtige Rolle dabei, diese Kontakte zu fördern.
Wie beeinflusst die Dreierkonstellation (Eltern und Einzelkind) die kindliche Entwicklung?
Die Dreierkonstellation ist weniger komplex als größere Familien. Die Einflüsse der Eltern wirken sich direkter aus, und das Kind steht im Mittelpunkt. Es besteht die Gefahr von Koalitionen (zwei gegen eins), was dem Kind entweder viel Macht oder große Ohnmacht verleihen kann. Die fehlende horizontale Orientierung (Geschwister) muss durch andere Sozialisationsinstanzen ausgeglichen werden.
Welche Erziehungsstile werden im Zusammenhang mit Einzelkindern erwähnt?
Das Dokument erwähnt die Gefahr von einem frontalen Erziehungsstil (Eltern gegen Kind), Überbehütung und Projektion. Es wird ein Erziehungsstil befürwortet, der Sicherheit vermittelt, aber dem Kind gleichzeitig Freiheit und Akzeptanz ermöglicht, damit es sich nicht eingeengt fühlt.
Was bedeutet "optimale Förderung" im Kontext der Kindheit heute?
"Optimale Förderung" bezieht sich auf das bewusste Beobachten und Beeinflussen der Entwicklung des Kindes durch Erwachsene. Talente sollen gefördert und Schwierigkeiten vermieden werden. Es gibt spezielle Einrichtungen außerhalb der Familie, um diese Förderung zu unterstützen. Der Wochenablauf des Kindes ist oft mit verschiedenen Fördermaßnahmen gefüllt.
Wie wird die These bewertet, dass Einzelkinder egoistisch und unsozial sind?
Das Dokument argumentiert, dass diese Vorurteile nicht haltbar sind. Einzelkinder können durchaus lernen, zu teilen und soziale Kompetenzen zu entwickeln, insbesondere wenn die Eltern sie in ihren Außenkontakten fördern und einen ausgewogenen Erziehungsstil pflegen.
Welche Rolle spielt die veränderte Familienfunktion in der heutigen Gesellschaft?
Die Familie ist in der heutigen Gesellschaft stärker auf emotionale Bedürfnisse ausgerichtet, im Gegensatz zu früher, als materielle Gründe im Vordergrund standen. Eltern streben bewusst nach Herzlichkeit, Geborgenheit und Halt. Die Familie wird als eine Art Insel in der rational orientierten Gesellschaft betrachtet, mit der Funktion, emotionale Bedürfnisse zu befriedigen.
Inwiefern haben Eltern heutzutage einen höheren Erziehungsanspruch an sich selbst?
Eltern haben heutzutage einen höheren Erziehungsanspruch, da das "Laienwissen" um die Psyche des Kindes so hoch ist, wie nie zuvor. Sie lesen Erziehungsratgeber, besuchen Kurse und Vorträge, um Erziehungsfehler zu vermeiden. Die Gesellschaft erwartet von Paaren, dass sie sich das Kinderkriegen gut überlegen und das Kind optimal fördern.
- Quote paper
- Sabine Waldow (Author), 2000, Entwicklungsmöglichkeiten von Einzelkindern heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101448