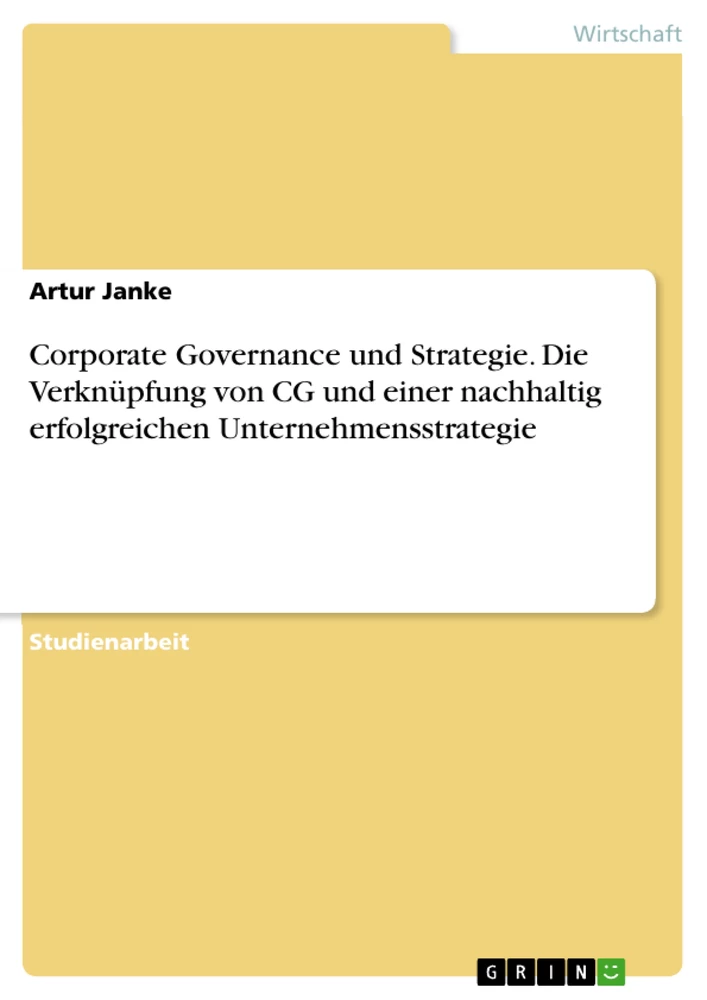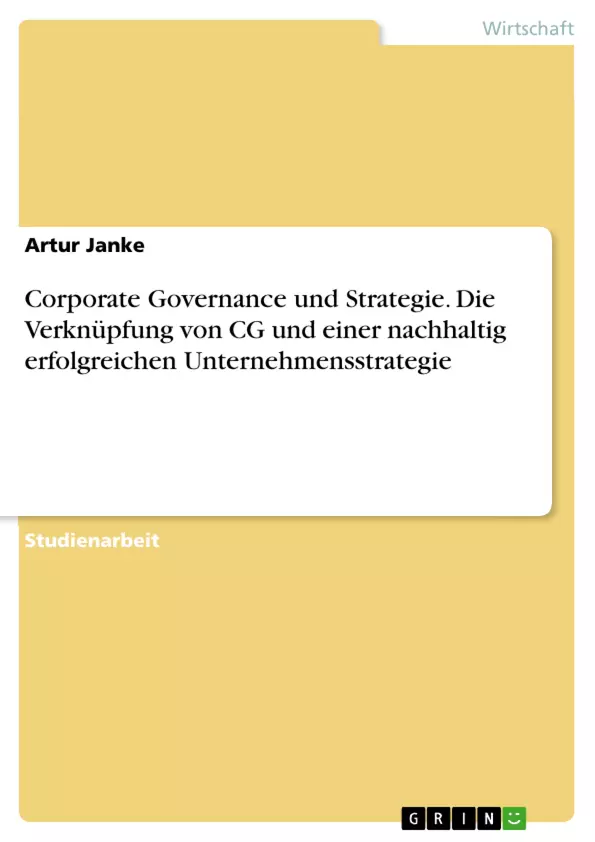Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung von Corporate Governance zu erklären. Dabei soll auch der allgemeine Zusammenhang zwischen CG und der Unternehmensstrategie sowie auch der Relevanz für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensstrategie aufgezeigt werden.
Dazu wird im zweiten Kapitel zunächst auf die Definition von Corporate Governance eingegangen und anschließend die enge und weite Auslegung des Begriffes erläutert. Für das bessere Verständnis wird noch die Abgrenzung zu den fälschlicherweise oft als Synonym verwendeten Begriffen Management und Corporate Social Responsibility dargestellt. Das dritte Kapitel umfasst die theoretischen Ansätze. Der Ansatz der Neuen Institutionsökonomik, der Stewardship-Ansatz, der Stakeholder-Ansatz sowie der Ressourcenbasierte Ansatz werden dabei beschrieben. Die Verknüpfung von CG und der nachhaltig erfolgreichen Unternehmensstrategie wird anhand eines Negativbeispiels im vierten Kapitel demonstriert. Das fünfte Kapitel rundet diese Arbeit mit einer kritischen Auseinandersetzung innerhalb der Zusammenfassung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Definition und Abgrenzung
- Definition Corporate Governance
- Enge / weite Auslegung des Begriffes Corporate Governance
- Enge Auslegung des Begriffes Corporate Governance
- Weite Auslegung des Begriffes Corporate Governance
- Abgrenzung von Begriffen die synonym zu Corporate Governance verwendet werden
- Abgrenzung vom Management
- Abgrenzung von Corporate Social Responsibility
- Theoretische Ansätze
- Ansatz der Neuen Institutionsökonomik
- Stewardship-Ansatz
- Stakeholder-Ansatz
- Ressourcenbasierter Ansatz
- Corporate Governance und nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung
- Deutscher Corporate Governance Kodex
- Negativbeispiel am Fall Thyssen-Krupp
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Corporate Governance (CG) und dessen Bedeutung für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung. Sie analysiert die verschiedenen Definitionen und Abgrenzungen des Begriffs, beleuchtet zentrale theoretische Ansätze und zeigt die Relevanz von CG anhand des Deutschen Corporate Governance Kodex. Darüber hinaus wird anhand eines Negativbeispiels (Thyssen-Krupp) die Bedeutung von guter Corporate Governance für die Unternehmensstabilität verdeutlicht.
- Definition und Abgrenzung von Corporate Governance
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Corporate Governance
- Die Rolle von Corporate Governance für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung
- Der Deutsche Corporate Governance Kodex als Instrument zur Förderung guter Unternehmensführung
- Die Bedeutung von Corporate Governance im Kontext von Unternehmensskandalen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Corporate Governance ein und stellt die Problemstellung der Arbeit dar. Es werden die unterschiedlichen Definitionen und Abgrenzungen des Begriffs erläutert und die Notwendigkeit von CG in der heutigen Zeit aufgezeigt.
- Definition und Abgrenzung: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Definitionen von Corporate Governance. Dabei werden die enge und die weite Auslegung des Begriffs betrachtet und Abgrenzungen zu anderen verwandten Begriffen wie Management und Corporate Social Responsibility (CSR) vorgenommen.
- Theoretische Ansätze: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, die das Konzept der Corporate Governance erklären. Dazu gehören die Neue Institutionenökonomik, der Stewardship-Ansatz, der Stakeholder-Ansatz und der Ressourcenbasierte Ansatz.
- Corporate Governance und nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Corporate Governance für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung. Der Deutsche Corporate Governance Kodex wird als Instrument zur Förderung guter Unternehmensführung vorgestellt. Zudem wird anhand eines Negativbeispiels (Thyssen-Krupp) die Bedeutung von CG für die Unternehmenstabilität verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Corporate Governance, Unternehmensführung, Unternehmensstrategie, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholder, Prinzipal-Agent-Theorie, Neue Institutionenökonomik, Deutscher Corporate Governance Kodex, Unternehmensethik, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Governance (CG)?
Corporate Governance bezeichnet den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen zum Wohl aller Stakeholder.
Was ist der Deutsche Corporate Governance Kodex?
Ein Regelwerk, das Standards für gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung festlegt und Transparenz für Investoren schafft.
Wie grenzt sich CG von Corporate Social Responsibility (CSR) ab?
CG fokussiert auf die internen Strukturen der Leitung und Kontrolle, während CSR die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und Mitmenschen betont.
Welche theoretischen Ansätze erklären Corporate Governance?
Wichtige Ansätze sind die Neue Institutionenökonomik (Prinzipal-Agent-Theorie), der Stewardship-Ansatz, der Stakeholder-Ansatz und der Ressourcenbasierte Ansatz.
Was passiert bei mangelhafter Corporate Governance?
Mangelhafte CG kann zu Instabilität und Skandalen führen, wie das Negativbeispiel Thyssen-Krupp in der Arbeit verdeutlicht.
- Quote paper
- M.Sc. Artur Janke (Author), 2017, Corporate Governance und Strategie. Die Verknüpfung von CG und einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensstrategie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014602