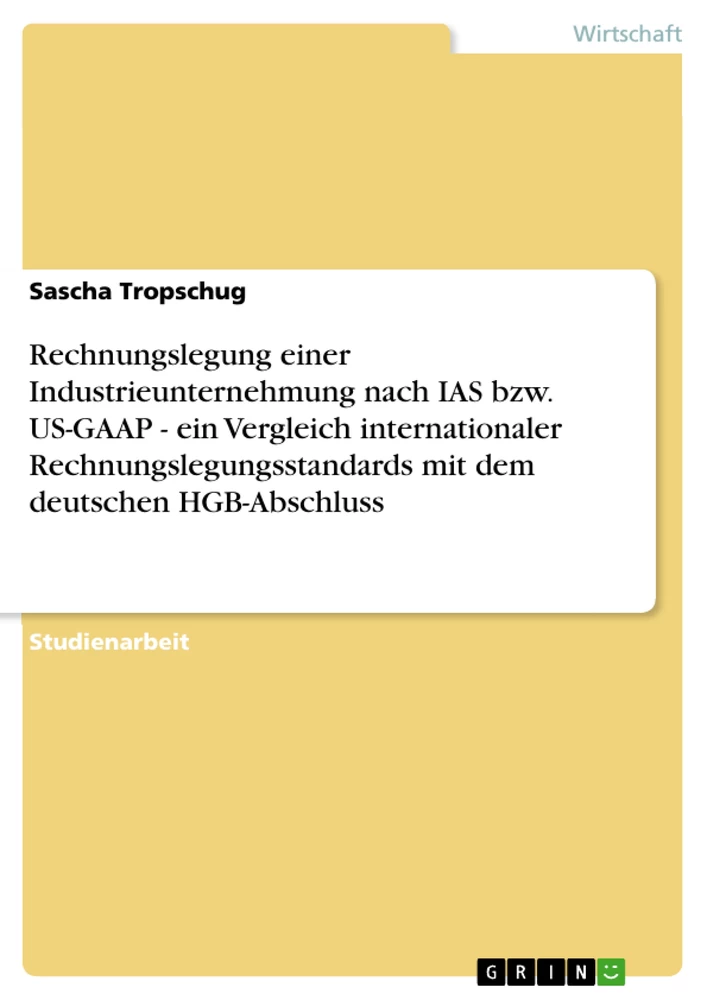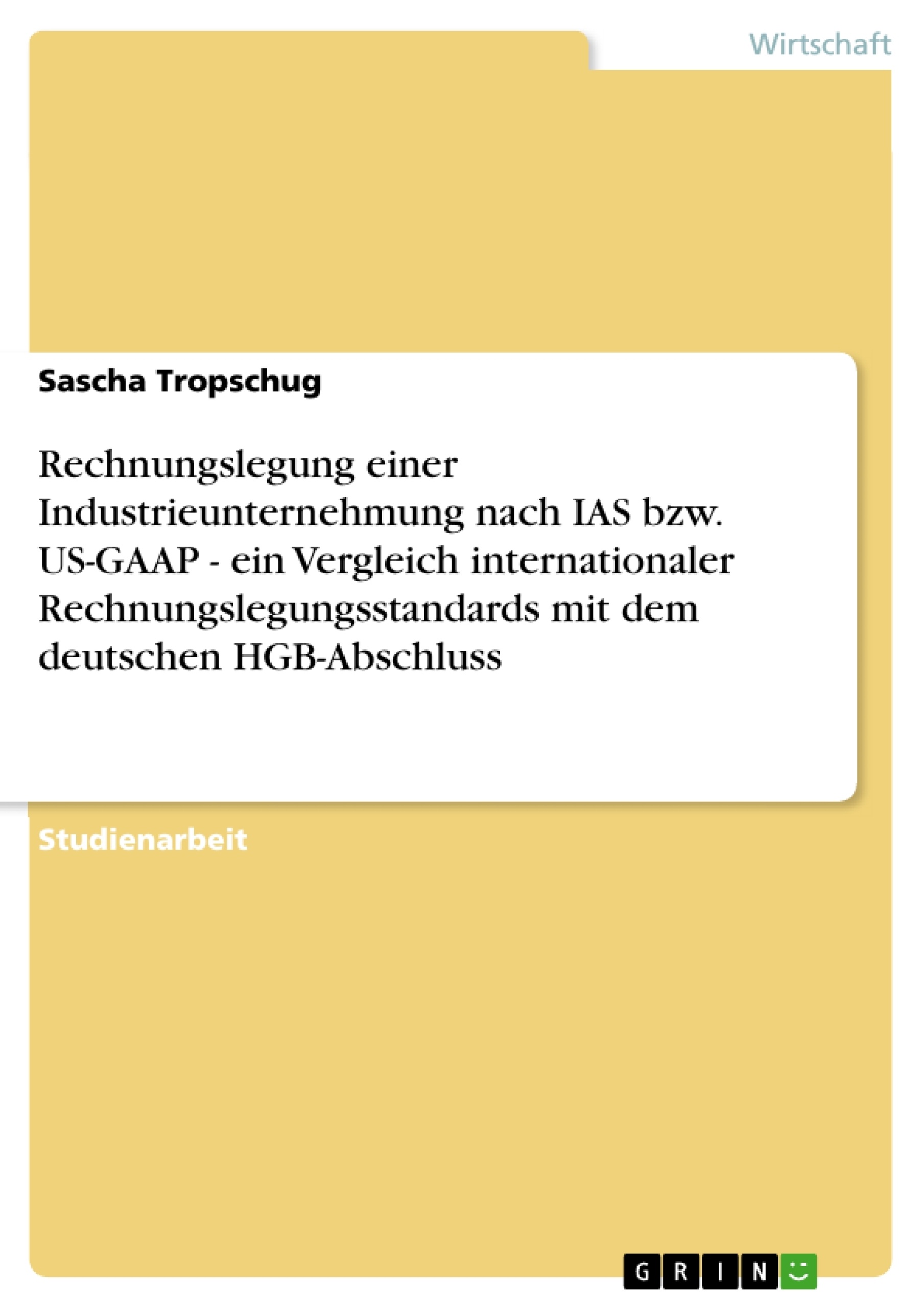Gliederung:
A. GRUNDLEGENDE RECHNUNGSLEGUNGSSYSTEME - FUNKTIONSORIENTIERTE UNTERSCHEIDUNG DER RECHNUNGSLEGUNG
B. VERGLEICHSASPEKTE DER RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS
I. Adressaten, Ausrichtung und Rechtquellen der Rechnungslegung
1. Adressatengruppen und deren Ansprüche an die Bilanzierung
2. Ausrichtung und Rechtquellen der Rechnungslegungsstandards
2.1 Stakeholderansatz und GoB nach HGB
2.2 Funktionsabgrenzung und Rahmenkonzept der IAS
2.3 Funktionsabgrenzung und Rahmenwerk der US-GAAP
II. Umfang der Rechnungslegung
1. Elemente des Jahresabschlusses nach HGB
2. Umfang des IAS-Jahresabschlusses und Zweck der zusätzlichen Elemente
3. Besonderheiten der Elemente des Jahresabschlusses nach US-GAAP
III. Abgrenzungs- und Bewertungsvorschriften der Rechnungslegung
1. Bilanzansatzvorschriften der Rechnungslegungsstandards
1.1 Ansatzvorschriften nach HGB
1.2 Ansatzvorschriften nach IAS
1.3 Ansatzvorschriften nach US-GAAP
2. Ausgewählte Ausgangswerte der Bilanzierung
2.1 Ausgangswerte nach HGB
2.2 Ausgangswerte nach IAS
2.3 Ausgangswerte nach US-GAAP
3. Wertkorrekturen des Vermögens bei der Bilanzierung
3.1 Korrekturwerte nach HGB
3.2 Korrekturwerte nach IAS
3.3 Korrekturwerte nach US-GAAP
IV. Ausgestaltung der Bilanzpolitik
1. Definition und Ziele
2. Bewertungs- und Ansatzwahlrechte nach HGB
3. Ausgewählte Wahlmöglichkeiten nach IAS
4. Ausgewählte Wahlmöglichkeiten nach US-GAAP
C. AUSWIRKUNGEN INTERNATIONALER RECHNUNGSLEGUNG AUF DIE VERGLEICHBARKEIT MIT HGB-ABSCHLÜSSEN
A. Grundlegende Rechnungslegungssysteme - Funktionsorientierte Unterscheidung der Rechnungslegung
Für die Ausgestaltung des Rechnungslegungssystems in einem Land ist dessen politi- sche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung prägend. Danach haben sich unter den verschiedenen nationalen Systemen zwei grundlegende Formen herausgebildet: die kontinentaleuropäische und die angloamerikanische Rechnungslegung. Zur ersten wird die deutsche Rechnungslegung nach dem HGB, zur letzteren die Rechnungsle- gung nach den Generally Accepted Ac counting Principles der USA (US-GAAP) ge- rechnet.1
Die zunehmende Globalisierung der Unternehmen und der Kapitalmärkte sowie die Schaffung von übernationalen Wirtschaftsräumen vergrößerte das Bedürfnis nach ei- ner internationalen Harmonisierung der Rechnungslegungsvorschriften.2
Das International Accounting Standards Committee, ein freiwilliger, privatrechtlicher Zusammenschluss von Berufsverbänden aus über 80 Ländern, hat mit den Inter- national Accounting Standards (IAS) den Versuch unternommen, eine weltweite Har- monisierung herbeizuführen.3
Der Rechnungslegung können die Informations-, die Ausschüttungsbemessungs- und die Steuerbemessungsfunktion als wesentliche Aufgaben zugewiesen werden.4
Eine besondere Bedeutung hat die Informationsfunktion. Sie soll dem Bilanzleser in die Lage versetzen, sich einen Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla- ge zu verschaffen.
Bei der Ausschüttungsbemessung wird insbesondere unterschieden, ob eher den Interessen der Gläubiger oder denen der Unternehmenseigner Vorrang eingeräumt wird. Der jeweilige Rechnungslegungsstandard bestimmt dabei, ob die Gewinnermittlung vorsichtig vorgenommen wird, ob und unter welchen Umständen es zu Ausschüttungssperren kommen kann und ob die Bildung stiller Reserven zulässig ist.
Letztlich kann die Rechnungslegung auch als Basis für die Ermittlung der Steuerlast herangezogen werden.5
Betrachtet man die Informationsfunktion näher, so ist relevant, für welche Adressaten die Informationen bestimmt sind, wie groß der Offenlegungsumfang ist, wie Abgren- zung sowie Bewertung einzelne Positionen in der Rechnungslegung erfolgt und we l- cher Spielraum bei der Gestaltung der Offenlegung besteht (Bilanzpolitik).6
Die folgenden Ausführungen we rden im wesentlichen die Aspekte der Informations- funktion beleuchten, auf die Ausschüttungsbemessungs- und Steuerbemessungsfunkti- on wird nur am Rand eingegangen.
B. Vergleichsaspekte der Rechnungslegungsstandards
I. Adressaten, Ausrichtung und Rechtquellen der Rechnungslegung
1. Adressatengruppen und deren Ansprüche an die Bilanzierung
Jahresabschlüsse sind ein Informationsinstrument, welches das Ziel verfolgen, den Empfänger nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen.7 Als potenzielle Infor- mationsempfänger kommen alle Person, Gruppen und Institutionen in Frage, die auf die Erreichung der Ziele des Unternehmens einwirken können bzw. deren eigene Ziel- erreichung durch das Unternehmen beeinflusst wird. Man unterscheidet interne Inte- ressengruppen wie das Management und die Mitarbeiter sowie externe Interessen- gruppen wie Gläubiger, Lieferanten, Kunden, Fiskus, Staat, Gewerkschaften und Ver- bände. Diese Personenkreise werden auch als Stakeholder bezeichnet, da sie mehr oder weniger am Unternehmen beteiligt sind.8
Die Stakeholder haben i.d.R. unterschiedliche Ziele und Ansprüche an die Bilanzierung. Gläubiger, Lieferanten und Fiskus wollen sich eine Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verschaffen, die Eigentümer (Shareholder) sind eher an einem hohem Gewinnausweis sowie an einer Vermögensmehrung interessiert.9
2. Ausrichtung und Rechtquellen der Rechnungslegungsstandards
2.1 Stakeholderansatz und GoB nach HGB
Dass der handelsrechtliche Jahresabschluss in Deutschland in erster Linie das Informa- tionsbedürfnis der Stakeholder befriedigen soll, wurde juristisch in den §§ 243, 264 Abs. II HGB verankert. Danach muss der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ord- nungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt sowie klar und übersichtlich sein. Von Kapitalgesellschaften wird ferner verlangt, dass unter Beachtung der GoB ein den tat- sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags- lage vermittelt wird.10
Unter den GoB versteht man allgemein anerkannte Regeln über die Führung von Handelsbüchern (Dokumentation) sowie die Erstellung des Jahresabschlusses (Rechenschaftslegung). Die GoB sind vom Standpunkt der Rechtswissenschaft gesehen ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in Einzelfällen eine Interpretation durch die Rechtssprechung notwendig macht, gleichzeitig aber eine Weiterentwicklung der GoB durch Praxis und Rechtsprechung ermöglicht.11
2.2 Funktionsabgrenzung und Rahmenkonzept der IAS
Vergleichbar mit dem deutschen Bilanzierungsrecht gibt es auch für die IAS allgemei- ne Regeln über die Führung von Handelsbüchern sowie die Erstellung des Jahresab- schlusses, die in einem Rahmenkonzept (Framework for the Preperation and Presenta- tion of Finacial Statements) den IAS vorangestellt sind. Obwohl das Prinzip des „true and fair view“ nicht ausdrücklich von den IAS verlangt wird, nimmt es eine überge- ordnete Stellung ein. Seine Umsetzung, die Darstellung eines den tatsächlichen Ve r- hältnissen entsprechendem Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, wird zwangsläufig durch die Formulierung des Rahmenkonzeptes sowie der einzelnen IAS erreicht.12
Nach dem Rahmenkonzept (F 9) gehören zu den Adressaten der Jahresabschlüsse alle Stakeholder. Bei der Befriedigung von Informationsbedürfnissen gehen aber die Be- dürfnisse der Shareholder vor, da deren Interessen auch denen der meisten anderen Adressaten entsprechen (F 10). An dieser Vorschrift wird die Ausrichtung der IAS an den Interessen der Shareholder deutlich.
In Deutschland erfolgt die Anerkennung eines nach den IAS erstelltem Jahresabschluss nur auf Ebene der Konzernrechnungslegung (§ 292a Abs. II HGB). Aus diesem Grund haben die IAS keine Auswirkung auf die Steuerbemessung oder die Gewinnausschüttung.
2.3 Funktionsabgrenzung und Rahmenwerk der US-GAAP
Auch bei den US-GAAP handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Er setzt sich aus einer Vielzahl genereller Prinzipien, einzelfallbezogenen Standards und üblichen Vorgehensweisen zusammen. Die Entwicklung und Auslegung der US- GAAP erfolgt durch Zusammenarbeit der amerikanischen Börsenaufsichtbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) und des Financial Accounting Standards Board (FASB).13
Die grundlegenden Prinzipien der US-amerikanischen Rechnungslegung sind in einem Rahmenwerk, dem Conceptual Framework, zusammengefasst.14 Dieses beinhaltet die sechs Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC). Nach dem SFAC 1 we n- den sich die US-GAAP denjenigen Interessenten zu, die ihren Informationsanspruch nicht auf Basis ihrer Machtposition in privaten Verträgen individuell durchsetzen kön- nen. Damit sind im wesentlichen die Aktionäre gemeint. Ihnen sollen Informationen bereitgestellt werden, die erforderlich sind, um die künftigen Zahlungen vom Unter- nehmen an die Investoren nach Umfang, zeitlicher Struktur und Risiken abschätzen zu können.15 Die US-GAAP sind daher wie die IAS an den Interessen der Shareholder ausgerichtet.
Auch nach den US-GAAP soll eine Darstellung der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Die Generalnorm des „true and fair view“ ist im wesentlichen deckungsgleich mit der Vorschrift des § 264 Abs. II HGB.16
Die US-GAAP sind Regelungen für den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Sie haben nur geringe Bedeutung für die Steuerbemessung amerikanischer Unternehmen.17 Hinzu kommt, dass in Deutschland die Anerkennung eines nach den US-GAAP erstelltem Jahresabschluss nur auf Ebene der Konzernrechnungslegung (§ 292a Abs. II HGB) erfolgt. Aus diesem Grund haben die US-GAAP ebenfalls keine Auswirkung auf die Steuerbemessung oder die Gewinnausschüttung deutscher Unternehmen.
II. Umfang der Rechnungslegung
1. Elemente des Jahresabschlusses nach HGB
Die deutsche Rechnungslegung sieht je nach Rechtsform und Größe des Unternehmens unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Elemente des Jahresabschlusses, der Detailliertheit von Bilanz- und GuV-Schemata und der Angaben eines gegebenenfalls zu erstellenden Anhangs vor. Zunächst unterscheidet das HGB zwischen Kapitalgesellschaften und sonstigen Kaufleuten. Bei den Kapitalgesellschaften wird weiter in kleine, mittlgroße und große Kapitalgesellschaften untergliedert.18
Alle Kaufleute, die keine Kapitalgesellschaften sind, haben gem. § 242 HGB einen Jahresabschluss zu erstellen, der aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) besteht. Hinsichtlich Reihenfolge und Bezeichnung der Positionen, der Gliederungstiefe sowie hinsichtlich der Darstellung (Staffelform, Kontoform) werden vom Gesetz keine Regelungen getroffen.19
Grundsätzlich haben kleine, mittelgroße und große Kapitalgesellschaften die gleichen Vorschriften zum Jahresabschluss zu beachten.20 Dieser besteht aus Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht (§ 264 Abs. I). Die Größenklassen werden von § 267 HGB abgegrenzt, der eine Differenzierung nach Bilanzsumme, Umsatzerlöse und durchschnittliche Mitarbeiteranzahl vorsieht.
Für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften sind bestimmte Vereinfachungen vorgesehen. Kleine Kapitalgesellschaften müssen nur eine verkürzte Bilanz sowie GuV aufstellen, brauchen bestimmte Angaben im Anhang nicht zu machen und müs- sen keinen Lagebericht erstellen (§§ 264 Abs. I S. 1, 266 Abs. I S. 3, 276, 288 HGB).21 Für mittelgroße Kapitalgesellschaften sind Erleichterungen in GuV und Anhang vorgesehen (§§ 276, 288 HGB).
Große Kapitalgesellschaften haben die strengsten Anforderungen an die Rechnungslegung zu erfüllen. Dies wird an den vorgeschriebenen Gliederungsschemata für Bilanz sowie GuV und an den umfangreichen Angabepflichten im Anhang deutlich.22
2. Umfang des IAS-Jahresabschlusses und Zweck der zusätzlichen Elemente
Der IAS-Jahresabschluss besteht unabhängig von Rechtsform und Größenklasse aus Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung und einem Anhang (Notes).23
Bestimmte Gliederungsvorschriften für die Bilanz und die GuV sind in den IAS nicht zwingend vorgesehen. Nach IAS 1 sind lediglich mindestens anzugebende Posten auf- geführt. Dem Bilanzierenden ist es freigestellt, ob er die Konten- oder Staffelform verwendet.24
Im Gegensatz zu den Vorschriften des HGB ist die Kapitalflussrechnung zwi ngender Bestandteil des Jahresabschlusses.25 Über sie werden Informationen über die Bewegungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente eines Unternehmens bereitgestellt. In der Kapitalflussrechnung erfolgt eine Aufspaltung der Cash-Flows nach der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Investitions- und Finanztätigkeit. Dadurch erhalten die Adressaten des Rechnungsabschlusses Informationen zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, liquide Mittel zu erwirtschaften sowie zur Abschätzung des Liquiditätsbedarfs des Unternehmens (IAS 7).
In der Eigenkapitalveränderungsrechnung wird das Jahresergebnis, die mit dem Eigen- kapital verrechneten Beträge sowie die Auswirkungen eines Wechsels der Bilanzie- rungs- und Bewertungsmethoden dargestellt. Die Veränderung der Position des Eigen- kapitals durch Transaktionen mit den Eigenkapitalgebern, die Entwicklung der Ge- winnrücklage sowie der anderen Eigenkapitalbestandteile kann auch im Anhang erfol- gen.26
Im Anhang sind die bei der Erstellung des Abschlusses herangezogenen Bewertungs- grundlagen und die spezifischen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beschrei- ben (IAS 1.97). Eine Besonderheit gegenüber den Angaben nach HGB ist die Seg- mentberichterstattung. Sie verfolgt das Ziel einer Darstellung von Informationen über die unterschiedlichen Arten von Produkten und Dienstleistungen, die ein Unternehmen produziert und anbietet sowie eine Darstellung der unterschiedlichen geographischen Regionen, in denen es Geschäfte tätigt. Die Angaben sollen den Adressaten helfen, die Ertragslage des Unternehmens besser zu verstehen, Risiken und Erträge des Unter- nehmens besser einzuschätzen und das gesamte Unternehmen sachgerechter beurteilen zu können (IAS 14).
3. Besonderheiten der Elemente des Jahresabschlusses nach US-GAAP
Die Bestandteile des Jahresabschlusses nach US-GAAP sind die GuV, die Bilanz, die Eigenkapitalverwendungsrechnung, die Kapitalflussrechnung, der Anhang, der Lagebericht und die Segmentberichterstattung.27
Die GuV nimmt eine maßgebliche Stellung ein. Sie soll derzeitigen und künftigen Ka- pitalgebern die momentane Ertragslage des Unternehmens darlegen. Auf ihrer Basis sollen zukünftige Cash-Flows bzw. Zahlungsüberschüsse prognostiziert werden. Sie hat damit insoweit eine Indikatorfunktion für den Erfolg des Unternehmens.28 Es ver- wundert daher nicht, dass die Angabe des Gewinns pro Aktie Pflichtangabe der GuV ist.29
Die Bilanz hat in der US-amerikanischen Rechnungslegung eine geringere Bedeutung als die GuV. Sie soll nicht primär dazu dienen, Vermögen und Schulden gegenüberzu- stellen, sondern sie soll Informationen bezüglich der Liquidität, der Finanzstruktur und dem finanziellen Potenzial bereitstellen.30 Die US-GAAP sehen nur eine Mindest- gliederung vor. Dem Bilanzierenden ist es freigestellt, ob er die Konten oder Staffelform verwendet.31
Verglichen wird die Eigenkapitalveränderungsrechnung oft mit der deutschen Gewinnverwendungsrechnung nach § 158 AktG.32 In ihr werden sämtliche Eigenkapitalpositionen der Vorperiode in die Positionen des aktuellen Abschlusses überführt.33
Der Lagebericht enthält unter anderem Erläuterungen und Rechtfertigungen über die Tätigung bestimmter Geschäfte. Er ist daher nicht mit dem deutschen Lagebericht ve r- gleichbar, in dem die Geschäftssituation und die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesellschaft darzulegen ist.34
Im Anhang werden Erklärungen sachlicher und wirtschaftlicher Hintergründe einzel- ner Positionen des Jahresabschlusses und die Darstellung der wichtigsten angewandten Rechnungslegungsverfahren dargestellt. Häufig kommen noch freiwillige Angaben, wie inflationsbereinigte Daten hinzu. Eine verbindliche Zusatzinformation ist die Seg- mentberichtserstattung, welche die Geschäftstätigkeit in Unternehmenssparten auf- teilt.35
III. Abgrenzungs- und Bewertungsvorschriften der Rechnungslegung
1. Bilanzansatzvorschriften der Rechnungslegungsstandards
1.1 Ansatzvorschriften nach HGB
Nach § 246 HGB besteht im Jahresabschluss Ansatzpflicht für sämtliche Vermögen, Schulden und Rechnungsabgrenzungen, Aufwendungen und Erträge. Da die Begriffe Vermögen und Schulden nicht definiert sind, müssen sie von den GoB abgeleitet we r- den.
Als Vermögensgegenstände gelten alle wirtschaftlichen Werte, die selbständig be- wertbar und veräußerbar sind.36 Während der wirtschaftliche Wert auf den zukünftigen Nutzen für das Unternehmen abzielt, fordert das Merkmal der selbständigen Bewert- barkeit das Vorliegen eines geeigneten Wertmaßstabes, wie Anschaffungs- oder Her- stellungskosten.37
Schulden definiert man allgemein als bestehende oder hinreichend sicher erwartete Belastung des Vermögens, die auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsve r- pflichtung beruhen und selbständig bewertbar sind.38
Neben der Pflicht zur Bilanzierung gibt es im Gesetz auch ausdrückliche Bilanzierungsverbote (§ 248 HGB). So darf ein Kaufmann Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und der Eigenkapitalbeschaffung nicht aktivieren, da durch sie weder Vermögensgegenstände noch Aktivposten entstehen.39
Unter die Gründungskosten fallen Kosten, die zur Herbeiführung der rechtlichen Exis- tenz des Unternehmens anfallen, wie Beratungsgebühren, Notariatskosten, Genehmi- gungsgebühren, Gründungsprüfungskosten usw. Kosten der Eigenkapitalbeschaffung sind beispielsweise Emissionskosten, Kosten der Börseneinführung sowie alle Kosten der Kapitalerhöhung.40
Die Bilanzierung nicht entgeltlich erworbener immaterieller Gegenstände des Anlagevermögens ist ausgeschlossen, weil sie unsichere Güter darstellen, deren Vorhandensein als Vermögensvorteil und deren Wert ohne einen entgeltlichen Erwerb nur schwierig oder überhaupt nicht nachzuweisen ist.41
Um eine periodengerechte Aufwandsverrechnung zu ermöglichen, ist der Ansatz be- stimmter Aufwendungen in der Bilanz zulässig (sogenannte Bilanzierungshilfe). Das Gesetz bestimmt hier ausdrücklich die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung des Geschäftsbetriebs (§ 269 HGB) sowie die aktiven latenten Steuern (§ 274 Abs. II HGB). Ansatzfähig im Sinne des Gesetzes sind Anlaufkosten, wie Auf- wendungen für den Auf- bzw. Ausbau der Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebsorga- nisation sowie Beschaffungskosten für Arbeitskräfte, Marktstudien oder Einführungs- werbung.42
Als Bilanzierungshilfen können darüber hinaus auch die Bilanzierungswahlrechte für den entgeltlichen erworbenen Firmenwert (§ 255 Abs. IV HGB) und bestimmte Auf- wandsrückstellungen (§ 249 Abs. I Nr. 1 S. 3 und Abs. II HGB) angesehen werden.43
1.2 Ansatzvorschriften nach IAS
Die Begriffe Vermögenswerte (asset) und Schulden (liability) werden hier vom Rahmenkonzept definiert.
Assets sind Ressourcen, über die das Unternehmen in Folge vergangener Ereignisse verfügen kann und aus denen es in Zukunft wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen erwartet (F 49a). Der Begriff des „asset“ geht somit über den des Vermögensgegenstandes nach HGB hinaus, da es nicht auf die Einzelveräußerbarkeit ankommt, sondern auf die Möglichkeit der zukünftigen Nutzenerzielung.44 Ferner wird für die Bilanzierungsfähigkeit gefordert, dass der zu erzielende Nutzen wahrscheinlich ist und sich die Kosten des „asset“ oder sein Wert verlässlich ermitteln lassen (F 83, F 89). Wahrscheinlichkeit liegt vor, wenn deren Wert größer ist, als der der Gegenwahrscheinlichkeit.45 Sind die Ansatzkriterien erfüllt, besteht eine Ansatzpflicht (F 82). Zu den Vermögenswerten gehören u.a. die Vorräte und die Sachanlagen (IAS 2, 16).
Schulden werden als gegenwärtige Verpflichtungen definiert, die aufgrund von Ereig- nissen in der Vergangenheit entstanden sind und deren Erfüllung voraussichtlich den Abfluss von Ressourcen zur Folge haben wird, die einen wirtschaftlichen Nutzen für das Unternehmen beinhalten (F 49b). Die Erfüllung der Verpflichtung kann dabei mit- tels Zahlungen, aber auch beispielsweise durch den Transfer von Vermögenswerten oder anderen Leistungen erfolgen (F 62). Ansatzpflicht für Schulden besteht jedoch nur, wenn der Abfluss von Ressourcen wahrscheinlich ist und sich ihr Wert verlässlich ermitteln lässt (F 83, F 91).
Ein immaterieller Vermögenswert ist definitionsgemäß ein identifizierbarer, nicht mo- netärer Vermögenswert ohne physische Substanz, der für die Herstellung von Er- zeugnissen oder Erbringung von Dienstleistungen, die Vermietung an Dritte oder Zwecke der eigenen Verwaltung genutzt wird (IAS 38.7). Ist nur eines der Definitionskriterien nicht erfüllt, d.h. liegt Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht über die Ressource oder der künftige wirtschaftliche Nutzen nicht vor, sind die Kosten für den Erwerb oder die Herstellung als Aufwand zu erfassen (IAS 38.9). Entspricht dagegen ein Vermögenswert der Definition und ist es wahrscheinlich, dass dem Unternehmen künftig wirtschaftliche Werte zufließen und sich die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bemessen lassen, besteht Aktivierungspflicht (IAS 38.19).
Obwohl die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes nicht ausdrücklich genannt sind, ermöglicht die Definition der immateriellen Vermögenswerte eine Aktivierung.46
Selbst geschaffene Markennamen, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten und ähnliche Rechte und Werte werden demgegenüber explizit als nicht aktivierungsfähig genannt (IAS 38.51).
Ebenso darf der selbst geschaffene Geschäfts- oder Firmenwert nicht aktiviert werden (IAS 38.36).
1.3 Ansatzvorschriften nach US-GAAP
Die Begriffe Vermögen und Schulden werden durch die SFAC nur unzureichend defi- niert.47
Unumstritten als Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind körperliche Gegenstände, Zahlungsmittel, Zahlungsansprüche, Beteiligungsrechte und entgeltlich erworbene Rechte von Dritten, wie etwa Anzahlungen auf bestellte Anlagen.48
Merkmal der zu bilanzierenden Schulden ist das Bestehen einer rechtlichen oder wirt- schaftlichen Verpflichtung gegenüber anderen Personen. Sie verpflichten zum Trans- fer von Vermögen, von Nutzungsrechten an Vermögen oder zur Erbringung von Dienstleistungen.49
Wie im HGB geregelt besteht auch nach den US-GAAP eine Ansatzpflicht für entgelt- lich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände, wie beispielsweise Patente, Li- zenzen, Urheberrechte usw. Im Gegensatz zum deutschen Recht besteht aber eine Ak- tivierungspflicht für den entgeltlich erworbenen Firmenwert (Goodwill).50 Auch kön- nen selbsterstellte immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens aktiviert werden, wenn sie ausreichend von anderen Vermögensgegenständen abgrenzbar und einzeln veräußerbar sind.51
Wie im deutschen Recht dürfen Kosten für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert werden. Hinsichtlich der Gründungskosten weichen die Regelungen der USGAAP ab. Diese Kosten werden nicht als Aufwand betrachtet und können aktiviert werden.52 Ebenso können Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung, z.B. Druck-, Registrierungs- und Platzierungskosten von Wertpapieren, angesetzt we rden.53
2. Ausgewählte Ausgangswerte der Bilanzierung
2.1 Ausgangswerte nach HGB
Vermögensgegenstände sind zunächst mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Schulden mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen (§ 253 HGB).
Die Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um eine fremdbezogenen Gegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Anschaffungsnebenkosten, während die Anschaffungspreisminderungen von den Anschaffungskosten abzusetzen sind (§ 255 HGB). Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören insbesondere Zölle, Frachten, Rollgelder, Provisionen und Steuern.54 Anschaffungspreisminderungen sind beispielswe ise Subventionen, Rabatte, Boni und Skonti.55 Fremdkapitalzinsen dürfen nicht als Anschaffungskosten angesetzt werden, da der Anschaffungsvorgang nur ei- nen punktuellen Zeitraum erfasst.56 Auch nachträgliche Aufwendungen können zu den Anschaffungskosten gerechnet werden, wenn sie in einem Zusammenhang mit dem ursprünglichem Erwerb stehen, da sie sonst einen Herstellungsaufwand darstellen.57
Die Herstellungskosten sind für vom Unternehmen hergestellte und nicht bis zum Bi- lanzstichtag veräußerte Gegenstände der Wertmaßstab. Als Aufwendungen für die Herstellung dürfen keine kalkulatorischen sondern nur aufwandsgleiche Kosten einbezogen werden.58 Aktivierungspflichtig sind die Material-, Personal- und Sondereinzelkosten der Fertigung. Ferner dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemein- und Fertigungsgemeinkosten sowie produktionsbedingte Abschreibungen eingerechnet werden. Während ein Ansatz von Verwaltungskosten und Kosten für soziale Aufwendungen möglich ist, besteht ein Verbot für den Ansatz der Vertriebskosten (§ 255 Abs. II). Fremdkapitalzinsen dürfen nur aktiviert werden, soweit sie in den Zeitraum der Herstellung fallen (§ 255 Abs. III HGB).
2.2 Ausgangswerte nach IAS
Wie nach deutschem Bilanzrecht setzen sich die Anschaffungskosten aus dem Kaufpreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten abzüglich der Anschaffungspreisminderung zusammen.59
Nach den IAS gehören zu den Herstellungskosten alle Aufwendungen des Herstel- lungsvorgangs sowie sonstige Kosten, die dafür angefallen sind, die Vermögenswerte in ihren gegenwärtigen Zustand zu versetzen bzw. sie an ihren gegenwärtigen Ort zu transportieren (IAS 2.7). Im Gegensatz zu den deutschen Bilanzierungsvorschriften müssen neben den Fertigungs- und Materialeinzelkosten auch die jeweiligen Gemein- kosten hinzugerechnet werden (IAS 2.10). Ein Aktivierungsverbot besteht für alle Kosten, die nicht dazu führten, die Vermögenswerte an ihren derzeitigen Ort und in ih- ren derzeitigen Zustand zu versetzen (IAS 2.13). Ausdrücklich ausgenommen sind La- gerkosten, Verwaltungskosten, die unter die oben genannte Bedingung fallen, sowie die Vertriebskosten (IAS 2.14).
Prinzipiell dürfen für Vermögenswerte keine Fremdkapitalzinsen angesetzt werden, sondern diese sind als Aufwand in der GuV zu erfassen (IAS 23.7). Ausgenommen sind die sogenannten qualifizierten Vermögenswerte, dass sind solche für die ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um diese in ihren beabsichtigten gebrauchs- oder verkehrsfähigen Zustand zu versetzen (IAS 23.11).
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zu den Rückzahlungsbeträgen zu passivieren, wobei die IAS keine ausdrücklichen Regelungen vorsehen, ob der Rückzahlungsbetrag zu historischen Kosten, zu Marktpreisen oder zum Barwert ermittelt werden soll.60
2.3 Ausgangswerte nach US-GAAP
Wie nach deutschem Bilanzrecht setzen sich die Anschaffungskosten aus dem Kaufpreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten abzüglich der Anschaffungspreisminderung zusammen.61
Als Herstellungskosten werden nach US-GAAP die angemessenen Voll-Aufwendung- en der Herstellung ohne die Kosten der allgemeinen Verwaltung und des Vertriebs angesetzt. Aktivierungspflichtig sind insbesondere neben den Fertigungs- und Materialeinzelkosten auch die jeweiligen Gemeinkosten. Da im Rahmen des amerikanischen Steuerrechtes in die Herstellungskosten auch die Lagerkosten sowie Einkaufs- und Vertriebskosten eingerechnet werden dürfen, wird die Meinung vertreten, dass diese auch im handelsrechtlichen Abschluss einbezogen werden können.62
Wie auch die IAS kennen die US-GAAP die sogenannten qualifizierten Vermögenswerte, also solche bei denen ein längerer Zeitraum erforderlich ist, um diese in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Bei diesen Vermögenswerten besteht eine Aktivierungspflicht für die angefallenen Zinsen.63
Im Rahmen der Bewertung von Verbindlichkeiten dominiert der Barwert der künftigen Zahlung.64 Nur kurzfristige Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilan- ziert, da der Unterschiedsbetrag zum Barwert sonst unwesentlich wäre. Langfristige Verbindlichkeiten werden mit Hilfe eines angemessenen Zinssatzes abgezinst.65 Die Abweichung zum Rückzahlungsbetrag wird bei langfristigen zinstragenden Verbind- lichkeiten auf Unterkonten erfasst, so dass die Schuld selbst mit dem Rückzahlungsbe- trag kontiert wird.66
3. Wertkorrekturen des Vermögens bei der Bilanzierung
3.1 Korrekturwerte nach HGB
Neben Ausgangswerten gibt es noch bestimmte Korrekturwerte, wobei für Kapital- gesellschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils ein bestimmter Wert vorge- schrieben ist. Für Personengesellschaften und Einzelkaufleute bilden diese Korrektur- werte nur Obergrenzen, die nicht überschritten, jedoch gem. § 253 Abs. IV HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unterschritten werden dürfen.67
Für Vermögensgegenstände gilt das Niederstwertprinzip, d.h. gegebenenfalls sind Wertminderungen durch Verminderung der Buchwerte zu berücksichtigen. Dabei müssen die Abschreibungen beim Umlaufvermögens zwingend, beim Anlagevermö- gen dagegen nur bei dauernder Wertminderung vorgenommen werden.68
Der Korrekturwert für das Anlagevermögens ist der „beizulegende Wert“ (§ 253 Abs. II S. 3 HGB). Maßstab des beizulegenden Wertes können die Wiederbeschaffungs- oder die Reproduktionskosten sein.69 Auch Umlaufsvermögensgegenstände, für die kein Börsen- oder Marktpreis ermittelt werden kann, müssen zu diesem Wert angesetzt werden, wenn dieser unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegt (§ 253 Abs. III S. 2 HGB).
Der Korrekturwert für das Umlaufvermögen ist der Börsen- oder Marktpreis (§ 253 Abs. III S. 1 HGB). Der Börsenpreis ist der an der Börse amtlich festgestellte oder im Freiverkehr ermittelte Preis. Der Marktpreis ist der Preis, der für Vorräte oder Waren einer bestimmten Gattung von durchschnittlicher Art und Güte zu einen bestimmten Zeitpunkt im Durchschnitt gezahlt wird.70
Der nach dem Niederstwertprinzip ermittelte niedrigere Stichtagswert, kann beim Umlaufvermögen durch den „Zukunftswert“ unterschritten werden. Diese Abschreibungen können nach vernünftiger Beurteilung vorgenommen werden, um Wertminderungen, die nach dem Stichtag eintreten, vorwegzunehmen.71
Auf den „für die steuerliche Anerkennung notwendigen Wert“ wird abgeschrieben, wenn Vermögensgegenstände auf einen niedrigeren Wert abgeschrieben werden sollen, der nur auf steuerrechtlichen Abschreibungen beruht. Dies wird notwendig, da Abschreibungen in der Steuerbilanz grundsätzlich einen Wertansatz in der Handelsbilanz voraussetzen.72
3.2 Korrekturwerte nach IAS
Neben den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten kommen in den IAS eine Reihe weiterer Wertbegriffe bzw. Korrekturwerte zur Anwendung.73 Die IAS besitzen aber keine geschlossene Bewertungskonzeption. Welche Werte bei den jeweiligen Bilanzpositionen angesetzt we rden dürfen, muss den einzelnen IAS entnommen werden.74
Der beizulegende Zeitwert (fair value) ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswe rt zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte (IAS 16.6).
Wenn die zu bewertenden Positionen auf Märkten gehandelt werden, wird häufig der Marktwert (market value) zur Bestimmung des beizulegenden Wertes herangezogen.75
Der Nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung und der geschätzten notwendigen Verkaufskosten (IAS 2.4).
Vorräte sind mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert zu bewerten (IAS 2.6).
Im Jahr der Anschaffung sind Sachanlagen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (IAS 16.14). In den Folgejahren sind sie zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der kumulierten AfA auszuweisen (IAS 16.28).
Alternativ wird die Methode der Neubewertung des Sachanlagevermögens zugelassen. Hierzu ist in regelmäßigen Abständen der beizulegende Zeitwert des Sachanlagegegenstandes zu bestimmen. Dieser Wert wird in den Folgejahren um planmäßige Abschreibungen gemindert, bis eine erneute Neubewertung stattfindet.76
3.3 Korrekturwerte nach US-GAAP
Nach US-GAAP gilt für das Vorratsvermögen ein strenges Niederstwertprinzip (lower of cost or market). Dabei wird aber nur auf den niedrigeren Vergleichswert am Stich- tag abgestellt. Abschreibungen wegen Wertschwankungen in der Zukunft, wie nach deutschem Recht möglich, werden nicht berücksichtigt. Der niedrigere Vergleichswe rt (market) wird dabei aus einer Kombination von drei alternativen Werten zum Aus- gangswert (cost) ermittelt. Der Marktwert ergibt sich aus den Wiederbeschaffungs- und Wiederherstellungskosten, die aber nicht höher als der Wert bei verlustfreier Be- wertung im Sinne des erwarteten Verkaufserlöses abzüglich der noch zu erwartenden Aufwendungen der Fertigstellung und des Verkaufs und nicht niedriger als der Wert bei verlustfreier Bewertung abzüglich eines angemessenen Gewinns seien darf.77
Außerplanmäßige Abschreibungen bei Sachanlagen sind vorzunehmen, wenn be- stimmte Indikatoren dafür sprechen. Als mögliche Indikatoren kommen in Frage: ein deutliches Absinken des Marktwertes, eine deutliche Änderung bei der Anlage oder der Möglichkeit ihrer Nutzung, ein deutliches Anwachsen der Herstellungskosten einer Anlage über das ursprünglich angenommene Maß hinaus usw. Eine Abschreibung wird notwendig, wenn der geschätzte Restwert der Maschine kleiner als deren Buch- wert ist.78
IV. Ausgestaltung der Bilanzpolitik
1. Defini tion und Ziele
Die Bilanzpolitik umfasst man alle legalen, zielgerichteten Maßnahmen zur Einflussnahme auf Form, Inhalt und Berichterstattung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Unter legal und zielgerichtet versteht man in diesem Zusammenhang, dass der Jahresabschluss innerhalb der durch die Rechtordnung gezogenen Grenzen und im Einklang mit den Unternehmenszielen erstellt wird.79
Zweckmäßigerweise lassen sich die Ziele der Bilanzpolitik in finanzpolitisch und pub- lizitätspolitisch motiviert gliedern. Unter den finanzpolitischen Zielen fasst man die Kapitalerhaltung und -mehrung, die Verstetigung der Gewinn- und Dividendenent- wicklung, Steueroptimierung und die Pflege der Kreditwürdigkeit. Bilanzpolitische Maßnahmen können aber auch publizitätspolitisch motiviert sein, da sie über eine kommunikationspolitische Komponente verfügen und somit direkt oder indirekt auf die finanzielle Situation des Unternehmens Einfluss haben.80
Während sich die formelle Bilanzpolitik mit der Form und Darstellung der Vermö- gens-, Finanz- und Ertragslage beschäftigt, ist die materielle Bilanzpolitik im wesentli- chen auf die Einflussnahme auf das handelsrechtliche Ergebnis ausgerichtet. Inwi eweit ein Unternehmen mit Hilfe von Ermessensspielräumen und Wahlrechten Einfluss auf den Jahresabschluss nehmen kann, ist vom jeweiligen Rechnungslegungsstandard ab- hängig.81
2. Bewertungs- und Ansatzwahlrechte nach HGB
Die Ausnutzung von Bewertungs- und Ansatzwahlrechten spielt in der Bilanzpolitik eine wichtige Rolle, da die Einwirkung auf den Erfolgsausweis im Jahresabschluss eine stille Rücklagenpolitik ermöglicht.82
Die Ausnutzung von Aktivierungswahlrechten und der damit verbundene Vermögensausweis führt bei sonst unveränderter Bilanzierung zu einem höheren Gewinn. Beispiele für Wahlrechte sind: Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftbetriebes, Aufwendungen für den Erwerb eines derivativen Firmen- und Geschäftswertes, Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (§ 6 Abs. II EstG), abzuführende Zölle, Umsatzsteuer, Disagio durch die Bildung eines Rechnungsabgrenzungsposten und latente Steuern.83
Soll ein verringerter Gewinn ausgewiesen werden, ist auf einen Bilanzansatz bei Akti- vierungswahlrechten zu verzichten und es müssen Passivierungswahlrechte ausgeübt werden.84 Zu den Passivierungswahlrechten gehören die Einstellung des Sonderposten mit Rücklagenanteil, die Rückstellung für unterlassene Reparaturen und Aufwands- rückstellungen.85
Auch die Bewertungswahlrechte können gewinnvermindernd oder -erhöhend wi rken. Im Falle des verminderten Gewinnausweises müssen die Abbewertungswahlrechte bis zur zulässigen Wertuntergrenze genutzt werden.86 Zu den Bewertungswahlrechten ge- hören u.a.: die Wahl der Abschreibungsmethode (z.B. linear oder degressiv), außer- planmäßige Abschreibung bei nicht dauernder Wertminderung (bei Kapitalgesellschaf- ten nur für Finanzanlagen), steuerrechtliche Sonderabschreibungen sowie der Umfang der Herstellungskosten.87
3. Ausgewählte Wahlmöglichkeiten nach IAS
Nach den IAS ist zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten zu unterscheiden. Während Forschungskosten nicht angesetzt werden dürfen, ist ein Ansatz von Ent- wicklungskosten möglich, wenn sie die in den IAS 38.45 genannten Kriterien kumula- tiv erfüllen. Da die Begriffe Forschungs- und Entwicklungskosten nicht eindeutig ab- gegrenzt werden, ergibt sich für den Bilanzierenden quasi ein Ansatzwahlrecht. Durch Verwendung unbestimmter Begriffe in den Kriterien, wie „technische Realisierbar- keit“ oder „Existenz eines Marktes“ kommt es zu einer Verstärkung des Wahlrech- tes.88
Einen weiteren bilanzpolitischen Spielraum bietet die Methode der Neubewe rtung bei Sachanlagen. Durch die Höherbewertung von Sachanlagen wird kein Ausschüttungspotenzial geschaffen, da diese mit einer Einstellung einer Rücklage ve rbunden ist. Es bietet sich für die Unternehmen jedoch die Möglichkeit, die Eigenkapital- oder Ve r- mögensstruktur zu beeinflussen.89
4. Ausgewählte Wahlmöglichkeiten nach US-GAAP
Eine Besonderheit der amerikanischen Rechnungslegung ist, dass selbsterstellte imma- terielle Gegenstände des Anlagevermögens aktiviert werden können, wenn sie ausrei- chend von anderen Vermögensgegenständen abgrenzbar und einzeln veräußerbar sind.90
Forschungs- und Entwicklungskosten sind nach US-GAAP nicht ansetzbar, da ihre Bewertung subjektiv wäre.91 Selbst für Vermögensgegenstände, die ausschließlich der Forschung und Entwicklung dienen und sich nicht für andere Forschungsarbeiten eignen, besteht Ansatzverbot.92
Wenn eine Tochtergesellschaft einen solchen Vermögensgegenstand erwirbt, müssen im Einzelabschluss der Tochtergesellschaft die Ausgaben in die GuV eingehen. Be- steht aber für die Muttergesellschaft die Möglichkeit, die Investition an anderer Stelle zu nutzen, kann der Vermögensgegenstand in der Konzernbilanz aktiviert werden.93
C. Auswirkungen internationaler Rechnungslegung auf die Vergleichbarkeit mit HGB-Abschlüssen
Die Zahl deutscher Unternehmen, die nach IAS oder US-GAAP bilanzieren, wird zukünftig steigen. Dies erhöht zwar die internationale Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse, andererseits sind die IAS- bzw. US-GAAP-Jahresabschlüsse nicht ohne we i- teres mit den HGB-Abschlüssen zu vergleichen.94
Aufgrund unterschiedlicher Ansatzvorschriften würde die Erstellung des Jahresab- schlusses nach HGB-Vorschriften oder nach IAS-Vorschriften zu einem unterschiedli- chen Bild der wirtschaftlichen Lage führen. So ist die nach IAS zulässige Aktivierung von Entwicklungsausgaben mit einem höherem Jahresergebnis verbunden, während nach deutscher Rechnungslegung diese Aufwendungen in die GuV eingegangen wä- ren. Der unterschiedliche Ausweis von Bilanzpositionen führt gleichzeitig zu einer Veränderung von Bilanzkennzahlen, wie der Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad oder die Eigenkapitalrentabilität. Um dennoch einen Vergleich beider Rechnungsle- gungssysteme zu ermöglichen, könnte die Bilanzanalyse versuchen, die Bilanzpositio- nen, die nach IAS bzw. HGB anders bilanziert werden, durch Korrekturbuchungen an- zunähern.95
Literaturverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Hachenburg, 19.02.2001
[...]
1 Vgl. Glaum, Martin/Mandler, Udo: Rechnungslegung auf globalen Kapitalmärkten, Wiesbaden 1996, S. 25-28
2 Vgl. Born, Karl: Rechnungslegung international, Stuttgart 1997, S. 23-24
3 Vgl. Schierenbeck, Hennar: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 14. Auflage, München/Wien 1999, S. 509
4 Vgl. Coenenberg, Adolf: Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse, 17. Auflage, Landsberg/Lech 2000, S. 36- 39
5 Vgl. Glaum, M./Mandler, U., 1996
6 Vgl. Glaum, M./Mandler, U., 1996
7 Vgl. Leffson, Ulrich: Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, 5. Auflage, Düsseldorf 1980, S. 164
8 Vgl. Weber, Antje: Shareholder- und Stakeholderansatz in der deutschen Bilanzierungspraxis, in: Blomeyer/Peemöller (Hrsg.), Internationale Rechnungslegung und Prüfung, Berlin 2000, S. 101-105
9 Vgl. Weber, A., 2000
10 Vgl. Weber, A., 2000
11 Vgl. Coenenberg, A., 2000
12 Vgl. Schierenbeck, H. , 1999
13 Vgl. Coenenberg, A., 2000
14 Vgl. Coenenberg, A., 2000
15 Vgl. Schildbach, Thomas: US-GAAP, München 2000, S. 40
16 Vgl. Coenenberg, A., 2000
17 Vgl. Schildbach, T., 2000
18 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
19 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
20 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
21 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
22 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
23 Vgl. Budde, Wolfgang Dieter/Förschle, Gerhart/u.a.: Beck´scher Bilanz-Kommentar Handels- und Steuerrecht, 4. Auflage, München 1999, § 264; Rz. 98
24 Vgl. Selchert, Friedrich W.: Internationale Rechnungslegung: der Jahresabschluß nach HGB, IAS und US GAAP, 2. Auflage, München 1999, S. 48
25 Vgl. Beck´scher Bilanz-Kommentar, 1999
26 Vgl. Beck´scher Bilanz-Kommentar, 1999
27 Vgl. Küting, Karlheinz/Weber, Claus-Peter: Internationale Bilanzierung, Herne/Berlin 1994, S. 67
28 Vgl. Eichmann, S., 2000
29 Vgl. Küting, K./Weber, C.-P., 1994
30 Vgl. Eichmann, Stephan: Strukturelle Unterschiede zwischen deutschem und US-amerikanischem Bilanzrecht, in: Blomeyer, Wolfgang/Peemöller, Volker H. (Hrsg.), Internationale Rechnungslegung und Prüfung, Berlin 2000, S. 398-401
31 Vgl. Küting, K./Weber, C.-P., 1994
32 Vgl. Haller, Axel: Grundlagen des externen Rechnungswesens in den USA, 4. Auflage, Stuttgart 1994, S. 286
33 Vgl. Eichmann, S., 2000
34 Vgl. Küting, K./Weber, C.-P., 1994
35 Vgl. Küting, K./Weber, C.-P., 1994
36 Vgl. Winnefeld, Robert: Bilanzhandbuch, 2. Auflage, München 2000, Kap. D, Rz. 415
37 Vgl. Coenenberg, A., 2000
38 Vgl. Coenenberg, A., 2000
39 Vgl. Beck´scher Bilanz-Kommentar, 1999
40 Vgl. Beck´scher Bilanz-Kommentar, 1999
41 Vgl. Beck´scher Bilanz-Kommentar, 1999
42 Vgl. Coenenberg, A., 2000
43 Vgl. Coenenberg, A., 2000
44 Vgl. Coenenberg, A., 2000
45 Vgl. Winnefeld, R., 2000
46 Vgl. Winnefeld, R., 2000
47 Vgl. Schildbach, T., 2000
48 Vgl. Schildbach, T., 2000
49 Vgl. Schildbach, T., 2000
50 Vgl. Schildbach, T., 2000
51 Vgl. Schildbach, T., 2000
52 Vgl. Born, K., 1997
53 Vgl. Schildbach, T., 2000
54 Vgl. Winnefeld, R., 2000
55 Vgl. Coenenberg, A., 2000
56 Vgl. Coenenberg, A., 2000
57 Vgl. Winnefeld, R., 2000
58 Vgl. Coenenberg, A., 2000
59 Vgl. Coenenberg, A., 2000
60 Vgl. Coenenberg, A., 2000
61 Vgl. Schildbach, T., 2000
62 Vgl. Schildbach, T., 2000
63 Vgl. Schildbach, T., 2000
64 Vgl. Schildbach, T., 2000
65 Vgl. Küting, K./Weber, C.-P., 1994
66 Vgl. Schildbach, T., 2000
67 Vgl. Coenenberg, A., 2000
68 Vgl. Coenenberg, A., 2000
69 Vgl. Coenenberg, A., 2000
70 Vgl. Winnefeld, R., 2000
71 Vgl. Winnefeld, R., 2000
72 Vgl. Coenenberg, A., 2000
73 Vgl. Coenenberg, A., 2000
74 Vgl. Winnefeld, R., 2000
75 Vgl. Coenenberg, A., 2000
76 Vgl. Wöhe, Günter/Döring, Ulrich: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 20. Auflage, München 2000, S. 1021
77 Vgl. Schildbach, T., 2000
78 Vgl. Schildbach, T., 2000
79 Vgl. Winnefeld, R., 2000
80 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
81 Vgl. Winnefeld, R., 2000
82 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
83 Vgl. Winnefeld, R., 2000
84 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
85 Vgl. Winnefeld, R., 2000
86 Vgl. Schierenbeck, H., 1999
87 Vgl. Winnefeld, R., 2000
88 Vgl. Engel-Ciric, Dejan: Bilanzmanagement im Rahmen internationaler Rechnungslegung in: Datenverarbeitung, Steuern, Wirtschaft, Recht, Jg. 29, H. 11, 2000, S. 294-295
89 Vgl. Engel-Ciric, D., 2000
90 Vgl. Schildbach, T., 2000
91 Vgl. Engel-Ciric, D., 2000
92 Vgl. Schildbach, T., 2000
93 Vgl. Engel-Ciric, D., 2000
94 Vgl. Baetge, Jörg/Beermann, Thomas: Vergleichende Bilanzanalyse von Abschlüssen nach IAS/US-GAAP und HGB in: Betriebs-Berater, 55. Jg., H. 41, 2000, S. 2092-2094
Häufig gestellte Fragen
Was sind die grundlegenden Rechnungslegungssysteme, die in diesem Dokument behandelt werden?
Das Dokument behandelt die kontinentaleuropäische (deutsche Rechnungslegung nach HGB) und die angloamerikanische Rechnungslegung (US-GAAP). Es geht auch auf die International Accounting Standards (IAS) ein, die eine internationale Harmonisierung der Rechnungslegungsvorschriften anstreben.
Welche Funktionen werden der Rechnungslegung zugewiesen?
Die wesentlichen Aufgaben der Rechnungslegung sind die Informationsfunktion, die Ausschüttungsbemessungsfunktion und die Steuerbemessungsfunktion.
Wer sind die Adressaten der Rechnungslegung?
Zu den Adressaten der Rechnungslegung gehören interne Interessengruppen wie Management und Mitarbeiter sowie externe Interessengruppen wie Gläubiger, Lieferanten, Kunden, Fiskus, Staat, Gewerkschaften und Verbände (Stakeholder).
Was ist der Stakeholderansatz und wie wird er im HGB berücksichtigt?
Der Stakeholderansatz berücksichtigt die Informationsbedürfnisse verschiedener Interessengruppen. Im HGB wird dies in den §§ 243, 264 Abs. II HGB verankert, die Klarheit, Übersichtlichkeit und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage fordern.
Wie ist das Rahmenkonzept der IAS im Vergleich zum HGB?
Das Rahmenkonzept der IAS ist vergleichbar mit den GoB im HGB. Es gibt allgemeine Regeln über die Führung von Handelsbüchern und die Erstellung des Jahresabschlusses. Die IAS sind jedoch stärker an den Interessen der Shareholder ausgerichtet.
Wie sind die US-GAAP im Hinblick auf die Adressaten ausgerichtet?
Die US-GAAP sind wie die IAS an den Interessen der Shareholder ausgerichtet. Sie sollen Informationen bereitstellen, die erforderlich sind, um die künftigen Zahlungen vom Unternehmen an die Investoren abschätzen zu können.
Welche Elemente umfasst der Jahresabschluss nach HGB?
Der Jahresabschluss nach HGB besteht je nach Rechtsform und Größe des Unternehmens aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Anhang und Lagebericht. Kleine Kapitalgesellschaften haben Vereinfachungen.
Welche Elemente umfasst der IAS-Jahresabschluss?
Der IAS-Jahresabschluss besteht aus Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung und einem Anhang (Notes).
Welche Elemente umfasst der Jahresabschluss nach US-GAAP?
Die Bestandteile des Jahresabschlusses nach US-GAAP sind die GuV, die Bilanz, die Eigenkapitalverwendungsrechnung, die Kapitalflussrechnung, der Anhang, der Lagebericht und die Segmentberichterstattung.
Was sind die Bilanzansatzvorschriften nach HGB?
Nach § 246 HGB besteht im Jahresabschluss Ansatzpflicht für sämtliche Vermögen, Schulden und Rechnungsabgrenzungen, Aufwendungen und Erträge. Es gibt auch Bilanzierungsverbote (§ 248 HGB) für bestimmte Aufwendungen.
Wie werden Vermögenswerte und Schulden nach IAS definiert?
Assets sind Ressourcen, über die das Unternehmen verfügen kann und aus denen es in Zukunft wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen erwartet. Schulden sind gegenwärtige Verpflichtungen, die aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit entstanden sind und deren Erfüllung voraussichtlich den Abfluss von Ressourcen zur Folge haben wird.
Wie werden Vermögen und Schulden nach US-GAAP definiert?
Die Begriffe Vermögen und Schulden werden durch die SFAC nur unzureichend definiert. Es wird auf körperliche Gegenstände, Zahlungsmittel, Zahlungsansprüche, Beteiligungsrechte und entgeltlich erworbene Rechte verwiesen.
Wie werden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach HGB ermittelt?
Die Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen fremdbezogenen Gegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die Herstellungskosten sind für vom Unternehmen hergestellte Gegenstände der Wertmaßstab.
Wie werden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach IAS ermittelt?
Wie nach deutschem Bilanzrecht setzen sich die Anschaffungskosten aus dem Kaufpreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten abzüglich der Anschaffungspreisminderung zusammen. Zu den Herstellungskosten gehören alle Aufwendungen des Herstellungsvorgangs sowie sonstige Kosten, die dafür angefallen sind, die Vermögenswerte in ihren gegenwärtigen Zustand zu versetzen.
Wie werden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach US-GAAP ermittelt?
Wie nach deutschem Bilanzrecht setzen sich die Anschaffungskosten aus dem Kaufpreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten abzüglich der Anschaffungspreisminderung zusammen. Als Herstellungskosten werden die angemessenen Voll-Aufwendungen der Herstellung ohne die Kosten der allgemeinen Verwaltung und des Vertriebs angesetzt.
Wie erfolgt die Wertkorrektur des Vermögens nach HGB?
Für Vermögensgegenstände gilt das Niederstwertprinzip. Wertminderungen müssen beim Umlaufvermögen zwingend, beim Anlagevermögen nur bei dauernder Wertminderung vorgenommen werden.
Wie erfolgt die Wertkorrektur des Vermögens nach IAS?
Vorräte sind mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert zu bewerten. Für Sachanlagen wird die Methode der Neubewertung zugelassen.
Wie erfolgt die Wertkorrektur des Vermögens nach US-GAAP?
Nach US-GAAP gilt für das Vorratsvermögen ein strenges Niederstwertprinzip (lower of cost or market). Außerplanmäßige Abschreibungen bei Sachanlagen sind vorzunehmen, wenn bestimmte Indikatoren dafür sprechen.
Was ist Bilanzpolitik und welche Ziele verfolgt sie?
Die Bilanzpolitik umfasst alle legalen, zielgerichteten Maßnahmen zur Einflussnahme auf Form, Inhalt und Berichterstattung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Die Ziele sind finanzpolitischer (Kapitalerhaltung, Steueroptimierung) und publizitätspolitischer Natur.
Welche Bewertungs- und Ansatzwahlrechte gibt es nach HGB?
Es gibt Aktivierungswahlrechte (Aufwendungen für Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes), Passivierungswahlrechte (Sonderposten mit Rücklagenanteil) und Bewertungswahlrechte (Wahl der Abschreibungsmethode).
Welche Wahlmöglichkeiten gibt es nach IAS?
Nach den IAS ergibt sich durch die Unterscheidung zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten ein Ansatzwahlrecht. Auch die Methode der Neubewertung bei Sachanlagen bietet bilanzpolitischen Spielraum.
Welche Wahlmöglichkeiten gibt es nach US-GAAP?
Eine Besonderheit der amerikanischen Rechnungslegung ist, dass selbsterstellte immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens aktiviert werden können, wenn sie ausreichend von anderen Vermögensgegenständen abgrenzbar und einzeln veräußerbar sind.
Welche Auswirkungen hat die internationale Rechnungslegung auf die Vergleichbarkeit mit HGB-Abschlüssen?
Aufgrund unterschiedlicher Ansatzvorschriften kann die Erstellung des Jahresabschlusses nach HGB-Vorschriften oder nach IAS/US-GAAP zu einem unterschiedlichen Bild der wirtschaftlichen Lage führen. Die Bilanzanalyse kann versuchen, die Bilanzpositionen durch Korrekturbuchungen anzunähern.
- Citation du texte
- Sascha Tropschug (Auteur), 2001, Rechnungslegung einer Industrieunternehmung nach IAS bzw. US-GAAP - ein Vergleich internationaler Rechnungslegungsstandards mit dem deutschen HGB-Abschluss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101520