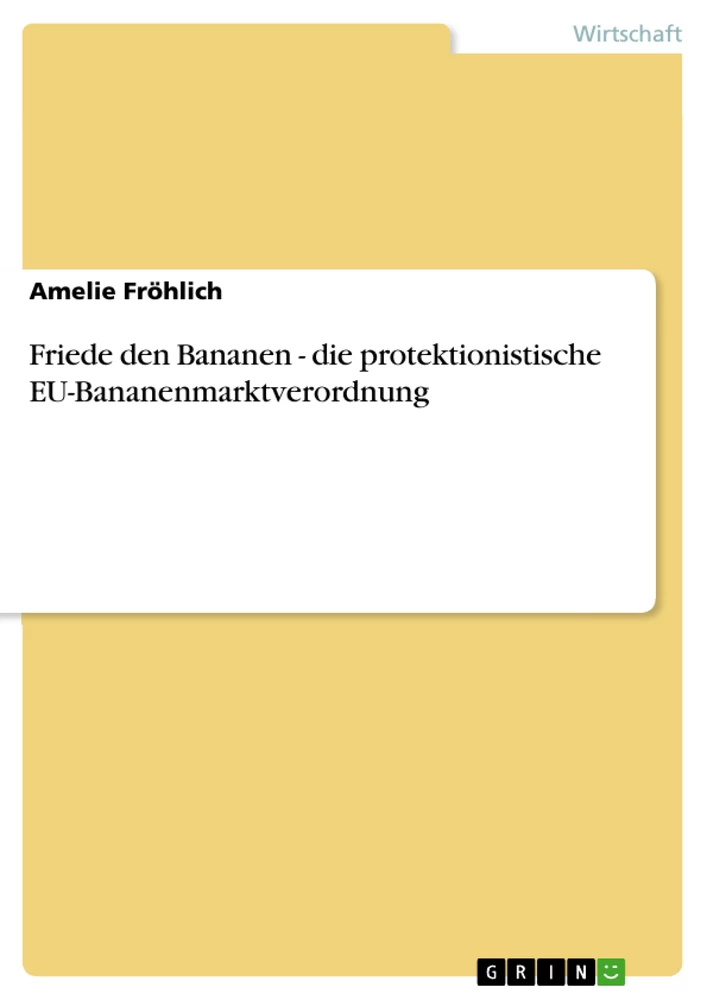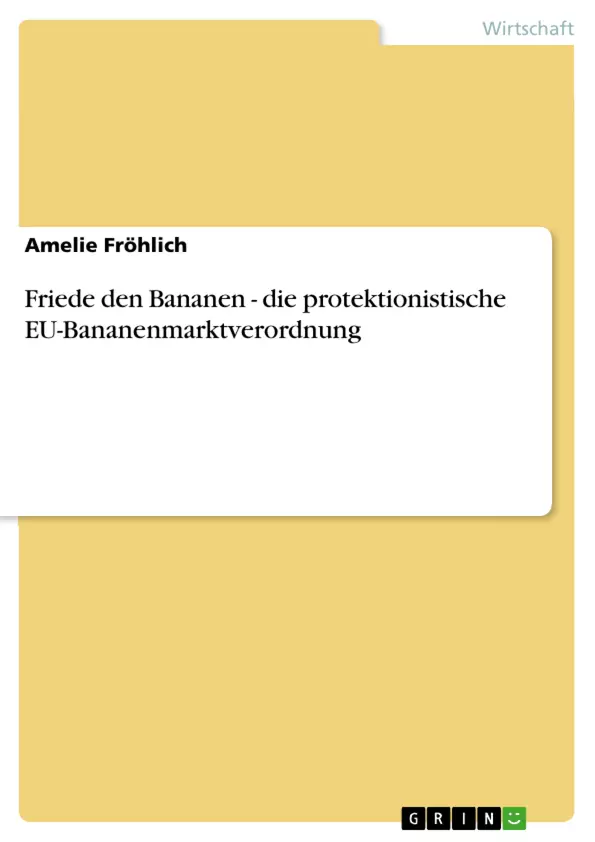Stellen Sie sich vor, ein handfester Wirtschaftskrieg, ausgetragen auf dem globalen Markt, dessen Schauplatz nicht Ölfelder oder Hightech-Zentren sind, sondern der unscheinbare Obststand um die Ecke. Im Fokus: die Banane. Dieses Buch enthüllt die verblüffende Geschichte des Bananenstreits zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, einem Konflikt, der nicht nur die internationale Handelspolitik, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen weltweit beeinflusste. Tauchen Sie ein in die komplexen Verordnungen, politischen Intrigen und wirtschaftlichen Interessen, die diesen Streit über Jahre hinweg befeuerten. Verfolgen Sie die Ursprünge der EU-Bananenmarktordnung (VO 404/93) und ihre Auswirkungen auf Bananenproduzenten in Afrika, der Karibik und Lateinamerika. Erfahren Sie, wie die USA, angetrieben von mächtigen Bananenkonzernen, mit Sanktionen drohten und diese schließlich auch verhängten, um ihre Interessen durchzusetzen. Analysieren Sie die Reaktionen Deutschlands und anderer betroffener Nationen, die vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht um ihr Recht kämpften. Entdecken Sie die verschiedenen Anpassungen und Nachbesserungen der Bananenmarktverordnung, die schließlich zu einer aktuellen Lösung führten, die jedoch weiterhin umstritten ist. Untersuchen Sie die wirtschaftlichen Folgen dieses Streits, der nicht nur zu Preissteigerungen für Verbraucher führte, sondern auch ganze Unternehmen in den Ruin trieb. Dieses Buch bietet eine fundierte und leicht verständliche Analyse eines globalen Konflikts, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Handel, Politik und Wirtschaft aufzeigt und die Frage aufwirft, wer am Ende wirklich die bittere Pille schlucken muss. Es ist eine faszinierende Lektüre für alle, die sich für internationale Beziehungen, Agrarpolitik und die globalen Auswirkungen unseres Konsumverhaltens interessieren. Erhalten Sie einen einzigartigen Einblick in die Mechanismen des Welthandels und die Macht der Lobbygruppen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Eine erschreckende und aufschlussreiche Geschichte, die zeigt, wie ein vermeintlich harmloses Produkt zum Zankapfel globaler Machtinteressen werden kann. Die Banane – mehr als nur eine Frucht, ein Symbol für die komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ursprung des Streits
2.1 Inhalt der ursprünglichen Regelung (VO 404/93)
3. Reaktionen auf die EU-Bananenmarktverordnung
3.1 Reaktionen aus der Bundesrepublik Deutschland
3.2 Reaktionen aus dem nicht-europäischen Ausland
4. Änderung der Verordnung
5. US-Sanktionen
6. Erneute Nachbesserungen der Bananenmarktverordnung
7. Aktuelle Lösung
8. Wirtschaftliche Auswirkungen
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
„Friede den Bananen“ - so lautete die Überschrift eines Artikels der Süddeutschen Zeitung vom 12. April 2001. Der jahrelange Streit um die Bananenmarktordnung der Europäischen Union (EU) gehört möglicherweise schon bald der Vergangenheit an.
2. Ursprung des Streits
Die Banane ist die wichtigste Exportfrucht der Welt. Und Deutschland mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 14 kg eine „Bananenrepublik“. Mehr als 11 Millionen Tonnen werden jährlich weltweit exportiert. Davon wird gut ein Zehntel in Deutschland verspeist. Seit dem 01. Juli 1993 gilt die EU-Bananenmarktordnung (VO 404/93), die die Einfuhr der Früchte in den europäischen Binnenmarkt über Einfuhrmengen und Zölle reguliert. Seit diesem Zeitpunkt tobt der Bananenstreit zwischen der Europäischen Union und den USA. Hintergrund des Streits sind die Zollvergünstigungen, die die EU-Staaten der Dritten Welt für ihre Bananenexporte nach Europa gewähren.
2.1 Inhalt der ursprünglichen Regelung (VO 404/93)
Die Verordnung stellt eine gemeinsame Marktordnung für Bananen her, wodurch das in Art. 38:1 Europäische Gemeinschaftsverordnung (EGV) auf den Agrarbereich erstreckte Ziel der Vollendung des gemeinsamen Marktes auf dem Bananensektor verwirklicht werden soll. Der heftig umstrittene und inzwischen in verschiedenen Verfahren überprüfte Teil der Verordnung ist Titel IV, in dem die Regelungen des Handels mit Drittstaaten enthalten sind. Titel IV sieht für die Bananeneinfuhr eine Kontingentierung und einen abgestuften Zollsatz vor. Dabei wird zwischen verschiedenen Gruppen von Bananen unterschieden: Die sogenannten traditionellen AKP-Bananen aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik sind solche, die aus vom Lomé IV - Abkommen umfaßten Staaten traditionell in EG-Länder importiert werden. Diesen steht ein zollfreies Kontingent von 857.000 t pro Jahr zu. Weiterhin gibt es die nichttraditionellen AKP-Bananen, die aus AKP-Staaten stammen, die bisher nicht die EG beliefern und deshalb nicht im Anhang zur Bananen-VO erfaßt sind. Drittlandsbananen, sog. Dollarbananen, kommen aus anderen als den EG- oder AKP-Staaten. Für die letzten beiden Gruppen sieht die VO ein Kontingent von 2,2 Millionen t vor, innerhalb dessen ein Zoll von 75 Ecu/t erhoben wird. Außerhalb dieses Kontingents wird ein Zollsatz von 722 Ecu/t (nichttraditionelle AKP-Bananen) bzw. 822 Ecu/t (Drittlandsbananen) erhoben, was einem Wertzoll von 140 % bzw. 180 % entspricht. Die jeweiligen Zollkontingente werden auf die Importeure im Wege von Einfuhrlizenzen aufgeteilt.
Die USA sehen darin eine Benachteiligung für die Exporteure der Bananen aus dem so genannten Dollarraum, die von US-Firmen wie Chiquita vorwiegend in Lateinamerika angebaut werden. Allein in Deutschland hätten Importeure nur noch weniger als 50 % der zuvor eingeführten Mengen an Drittlandsbananen einführen können.
3. Reaktionen auf die EU-Bananenmarktverordnung
3.1 Reaktionen aus der Bundesrepublik Deutschland
Da die Preise für Drittlandsbananen nun weit über den Preisen der anderen Bananen liegen, haben Deutsche Importeure vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Importbeschränkungen geklagt - ohne Erfolg. Da sich die Kläger in ihren Grundrechten Eigentumsrecht, freie Berufsausübung und Gleichbehandlung beeinträchtigt fühlten, beschlossen sie, das Bundesverfassungsgericht (BVG) anzurufen. Am 07. Juni 2000 wurde die Klage vom BVG als unzulässig zurückgewiesen. Die Verfassungsrichter begründen ihre Entscheidung damit, daß ein Mindeststandard an inhaltlichem Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene gewährleistet ist. Berufen hat sich das BVG dabei auf den Solange-II- Beschluß von 1986. Das heißt, das BVG tritt nur dann auf den Plan, wenn dieser Mindeststandard unterschritten wird. Da dies nach Ansicht des BVG bei der europäischen Bananenmarktordnung nicht der Fall ist, liegt keine Verletzung des Grundrechtschutzes vor.
3.2 Reaktionen aus dem nicht-europäischen Ausland
Bereits 1993 forderten die zentralamerikanischen Staaten Kolumbien, Guatemala, Venezuela und Costa Rica ein Schlichtungsverfahren im Rahmen des Gatt 471. Diese Drittstaaten i.S.d. Bananen-VO importierten traditionell Bananen in die EG und fühlten sich von den neuen Lizenzregelungen geschädigt. Am 18.01.1994 wurde die Bananen-VO als unvereinbar mit GATT 47, speziell mit dem in Art. I enthaltenen „Meistbegünstigungsprinzip“, nach dem alle Vorteile, die ein Vertragspartner für ein Erzeugnis gewährt, auf jedes gleichartige Erzeugnis ausgedehnt werden müssen, das aus den Gebieten irgendwelcher anderer Vertragsstaaten stammt, erklärt. Die Vorteilsgewährung durch ein großes zollfreies Kontingent allein gegenüber AKP-Staaten verstieß gegen dieses Prinzip.
Die EU nutzte aber ihre unter GATT 47 bestehende Möglichkeit, das Verfahren zu blockieren, indem sie den Konsens zur Annahme der Entscheidung verweigerte. Außer den lateinamerikanischen Ländern, in denen der überwiegende Teil der sog. Dollarbananen erzeugt wird, zeigen auch die USA ein erhebliches Interesse daran, gegen die Bananen-VO vorzugehen. Dies wird darauf zurückgeführt, daß die nordamerikanischen Bananenkonzerne, allen voran „Chiquita Brands“, großen Einfluß auf die US-Handelspolitik ausüben können. Nachdem die USA 1995 zunächst vergeblich versuchten, durch die Androhung von Sanktionen eine Änderung der Verordnung zu erzwingen, leiteten sie gemeinsam mit Ecuador, Guatemala, Honduras und Mexiko am 06.05.1996 ein Schlichtungsverfahren nach den Regeln des GATT 94 ein. Der Ergebnisbericht vom 29.04.1997 stellt zusammenfassend fest: Die im Rahmenabkommen vorgesehene Verteilung von länderspezifischen Exportquoten ist GATT-widrig, solange sie nicht für alle am Bananenexport interessierten Länder geöffnet wird. Eine Blockademöglichkeit der EU besteht nach den neuen Regelungen nicht mehr, dafür aber die Möglichkeit, eine Überprüfung der Entscheidung vor dem Standing Appellate Body (SAB = Revisionsinstanz für den Vertragsverletzer, hier EU; beschäftigt sich nur mit Rechtsfragen, nicht mehr mit dem Tatbestand). Die Entscheidung des SAB wird am 25.09.1997 rechtsgültig und bestätigt den ursprünglichen Ergebnisbericht in allen Punkten. Damit ist die EU im Bananenstreit in allen Punkten unterlegen. Eine Frist zur Anpassung der Bananenmarktordnung wurde bis zum 01.01.1999 festgesetzt. Die USA drängte darauf, daß das bestehende Kontingentsystem ganz abgeschafft und durch ein Zollsystem ersetzt werden sollte.
4. Änderung der Verordnung
Zur Umsetzung der SAB-Entscheidung beschloß die EU am 30.10.1998 eine Änderung der Verordnung, die am 01.01.1999 in Kraft getreten ist. Die wichtigsten Neuregelungen sind folgende: Das bisherige Drittlandskontingent wird aufrechterhalten; es wird ein zusätzliches Zollkontingent von 353.000 t für Drittlandsbananen zum gleichen Zollsatz (75 Ecu/t) errichtet. Für die AKP-Staaten bleibt ein Kontingent von 857.000 t ohne Aufteilung auf die einzelnen Länder. Außerhalb der Kontingente gilt ein Zoll von 737 Ecu/t für Drittstaaten bzw. von 537 Ecu/t für AKP-Länder.
Von Anfang an war umstritten, inwieweit die Änderungen der Bananen-VO die vom SAB- Bericht verlangten Voraussetzungen erfüllen. Die USA und die lateinamerikanischen Staaten werfen der EU-Kommission nach wie vor GATT-Widrigkeit der Bestimmungen vor.
5. US-Sanktionen
Schon vor Erlaß der geänderten Verordnung haben die USA klargestellt, daß sie sich bei einer Nichterfüllung der GATT-Regeln nicht auf Kompensationsverhandlungen einlassen würden. Tatsächlich setzten die USA nach dem Erlaß schon am 03.03.1999 Sanktionen im Gegenwert von $ 550 Mio. gegen die EU in Kraft. Am 09.04.1999 veröffentlichte die USA eine Liste mit europäischen Produkten - vom schottischen Wollpullover über die deutsche Kaffeemaschine bis zum italienischen Peccorino-Käse - aus 13 Mitgliedstaaten, die von den Vergeltungsmaßnahmen betroffen sein sollten, und zwar mit einem Wertzoll von 100 %. Die EU war der Ansicht, daß diese Maßnahme dazu diente, die Importe der betreffenden Güter komplett zu stoppen. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) schätzte die Umsatzverlustze durch die künstliche Verdoppelung der Preise deutscher Produkte in USGeschäften auf 140 Mio. Mark.
Das Schiedsgericht der WTO bestätigte am 06.06.1999 die Meinung der EU bezüglich der Unverhältnismäßigkeit der Sanktionen. Eine Aussetzung von Konzessionen durch die USA sei nur im Wert von $ 191,4 Mio. (statt $ 550 Mio.) zulässig. Ebenfalls bestätigte der Report, daß die EU den traditionellen AKP-Staaten duty-free Importe nach dem Lomé-Abkommen einräumen darf, jedoch die Quotenregelung lateinamerikanische Exporteure unrechtmäßig benachteilige.
6. Erneute Nachbesserungen der Bananenmarktverordnung
Nach weiterem hin und her einigten sich die EU-Agrarminister am 19.12.2000 darauf, spätestens bis Anfang 2006 die bisherigen Importquoten durch eine reine Zollregelung mit einem Zollsatz für alle Bananeneinfuhren, zu ersetzen. Die Mengenbeschränkungen sollen fallengelassen werden. Bis dahin soll vom 01. 04. 2001 an das so genannte „Windhundverfahren“ zum Einsatz kommen. Nach dieser Übergangslösung erhalten diejenigen Bananenimporteure, die zuerst wegen einer Einfuhrlizenz nachfragen, nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ den Zuschlag. Die Minister einigten sich mit großer Mehrheit, nur Großbritannien stimmte gegen den Vorschlag.
Mit der Entscheidung folgte der Ministerrat einem Vorschlag der EU-Kommission. Alle Importeure haben mit dem neuen modifizierten Kontingentsystem nach den Angaben die gleichen Chancen. Das „Windhundverfahren“ soll nun auf alle Kontingente angewandt werden.
Jedoch waren die USA mit dieser Lösung nicht einverstanden. Im Gegenteil: Washington will seine Strafzölle gegen die EU sogar noch verschärfen, in dem durch ein Karussell-Verfahren unterschiedliche Branchen angegriffen werden sollen. Unter diesem Druck regelt die Europäische Union ihre Bananenmarktverordnung wieder neu. Das teilten die für den Handel und für die Landwirtschaft zuständigen EU-Kommissare, Franz Fischler und Pascal Lamy, am 11.04.2001 in Brüssel mit.
7. Aktuelle Lösung
Bis 2006 sollen nun die Lizenzen auf Grundlage der Einfuhren in dem Zeitraum von 1994 bis 1996, der sogenannten „Historischen Referenzperiode“, vergeben werden. Der für das Jahr 2006 geplante Zollsatz für alle Bananeneinfuhren bleibt bestehen. Dieser neuen Vereinbarung müssen noch die europäischen Länder und das EU-Parlament zustimmen. Lamy und Fischler haben aber bereits geäußert, das Abkommen mit den „wärmsten“ Empfehlungen weiterzugeben. Die US-Handelssanktionen gegen die EU könnten daher im Juli beendet werden, wenn das neue Importsystem in Kraft tritt. Aus der Branche wurde der Brüsseler Durchbruch begrüßt.
8. Wirtschaftliche Auswirkungen
Die Beilegung des Handelsstreits mit den USA um die Bananenimporte nach Europa wird kaum Auswirkungen auf die Preise haben. Zumindest könne aber eine Preisberuhigung erwartet werden, sagte Horst Möhlenbrock vom größten deutschen Importeur Atlanta AG in Bremen. Preise von vier Mark das Kilo dürften wohl der Vergangenheit angehören. Allerdings sei auch sicher, daß die 99 Pfennig je Kilo aus der Zeit vor dem Bananenstreit Geschichte bleiben. Auch der Geschäftsführer des Deutschen Fruchthandelsverbandes, Ulrich Boysen, rechnet nicht mit Auswirkungen. Der Verbraucher werde von der neuen Regelung kaum profitieren. Die Bananen würden weder billiger noch teurer. Für Möhlenbock ist mit einer gewissen Mengenerhöhung bei den Dollar-Bananen zu rechnen. Die Einfuhren seien jetzt berechenbarer für die Importeure. Das sei angesichts der schnellen Verderblichkeit von Bananen für Händler und Verbraucher von Vorteil.
Eines ist jedoch sicher: für viele Betriebe hatte dieser Streit schmerzliche wirtschaftliche Auswirkungen. Der bekannte US-Händler „Chiquita“ gab den Konflikt als einen Grund seiner Zahlungsunfähigkeit im Januar 2001 an.
Quellenverzeichnis
- www.erikamann.com/eu-us/bananasge.html
- www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world
- www.politik-digital.de
- www.n-tv.de
- www.n24.de
- www.hausarbeiten.de
- http://europa.eu.int/cj/de/cp/cp98/cp9813de.htm
- http://bundesverfassungsgericht.de
- http://szonnet.diz-muenchen.de
- Süddeutsche Zeitung
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Streit um die EU-Bananenmarktordnung?
Der Streit dreht sich um die EU-Bananenmarktordnung (VO 404/93), die die Einfuhr von Bananen in den europäischen Binnenmarkt regelt. Die USA und lateinamerikanische Länder sehen darin eine Benachteiligung ihrer Bananenexporteure, da die EU Zollvergünstigungen für Bananen aus AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik) gewährt.
Was ist die EU-Bananenmarktordnung (VO 404/93)?
Die VO 404/93 ist eine Verordnung, die eine gemeinsame Marktordnung für Bananen schafft. Sie regelt die Einfuhr von Bananen in die EU durch Kontingente und Zölle, wobei zwischen Bananen aus AKP-Staaten und sogenannten Dollarbananen aus anderen Ländern unterschieden wird.
Welche Länder sind von dem Bananenstreit betroffen?
Betroffen sind vor allem die Europäische Union, die USA, lateinamerikanische Länder (insbesondere solche, in denen Dollarbananen angebaut werden) und AKP-Staaten.
Warum haben die USA Sanktionen gegen die EU verhängt?
Die USA verhängten Sanktionen gegen die EU, weil sie der Meinung waren, dass die EU-Bananenmarktordnung gegen GATT-Regeln verstößt und ihre Bananenexporteure benachteiligt.
Wie wurde versucht, den Bananenstreit zu lösen?
Es gab verschiedene Schlichtungsverfahren im Rahmen von GATT und der WTO. Die EU hat die Bananenmarktordnung mehrfach angepasst, um den Forderungen der USA und der lateinamerikanischen Länder entgegenzukommen.
Was ist das "Windhundverfahren"?
Das "Windhundverfahren" ist eine Übergangslösung, bei der Bananenimporteure, die zuerst eine Einfuhrlizenz beantragen, nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst" den Zuschlag erhalten.
Was ist die aktuelle Lösung im Bananenstreit?
Bis 2006 sollen die Lizenzen auf Grundlage der Einfuhren in dem Zeitraum von 1994 bis 1996, der sogenannten „Historischen Referenzperiode“, vergeben werden. Der für das Jahr 2006 geplante Zollsatz für alle Bananeneinfuhren bleibt bestehen. Die US-Handelssanktionen gegen die EU könnten beendet werden, wenn das neue Importsystem in Kraft tritt.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Bananenstreit?
Der Bananenstreit hatte wirtschaftliche Auswirkungen auf Importeure und Exporteure, insbesondere in den betroffenen Ländern. Es wird jedoch erwartet, dass die Beilegung des Streits kaum Auswirkungen auf die Bananenpreise für Verbraucher haben wird.
Was sind "Dollarbananen"?
"Dollarbananen" sind Bananen, die aus anderen als den EG- oder AKP-Staaten stammen. Diese werden häufig von US-amerikanischen Firmen wie Chiquita in Lateinamerika angebaut.
Was bedeutet das "Meistbegünstigungsprinzip" im Zusammenhang mit dem Bananenstreit?
Das Meistbegünstigungsprinzip, enthalten in Artikel I des GATT, besagt, dass alle Vorteile, die ein Vertragspartner für ein Erzeugnis gewährt, auf jedes gleichartige Erzeugnis ausgedehnt werden müssen, das aus den Gebieten irgendwelcher anderer Vertragsstaaten stammt. Die EU-Bananenmarktordnung wurde kritisiert, weil sie durch ein großes zollfreies Kontingent allein gegenüber AKP-Staaten gegen dieses Prinzip verstieß.
- Quote paper
- Amelie Fröhlich (Author), 2001, Friede den Bananen - die protektionistische EU-Bananenmarktverordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101714