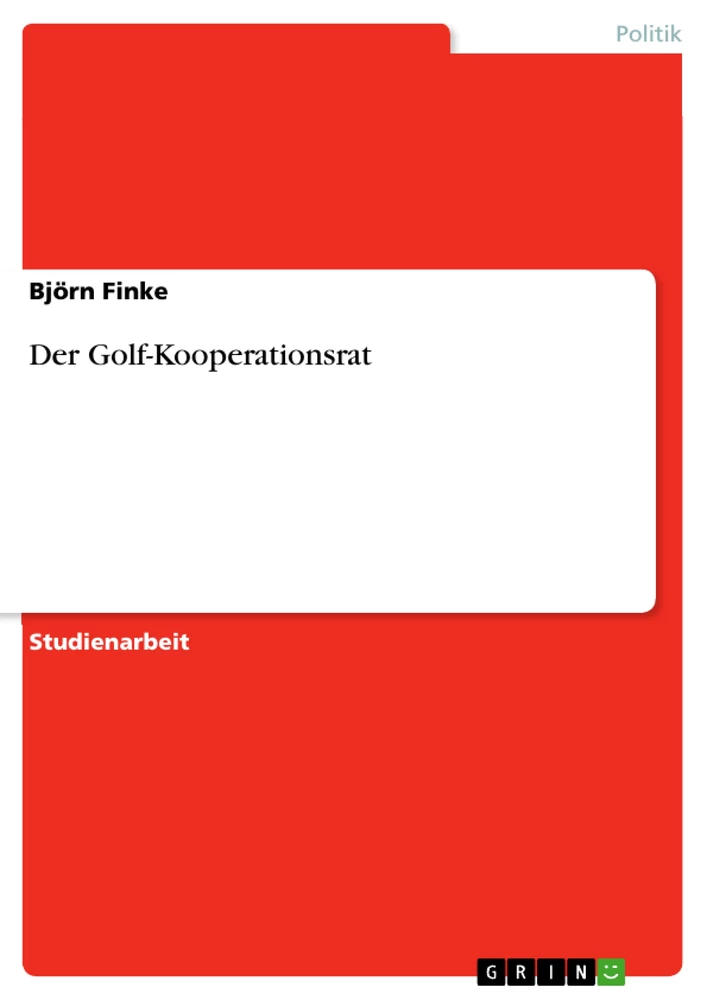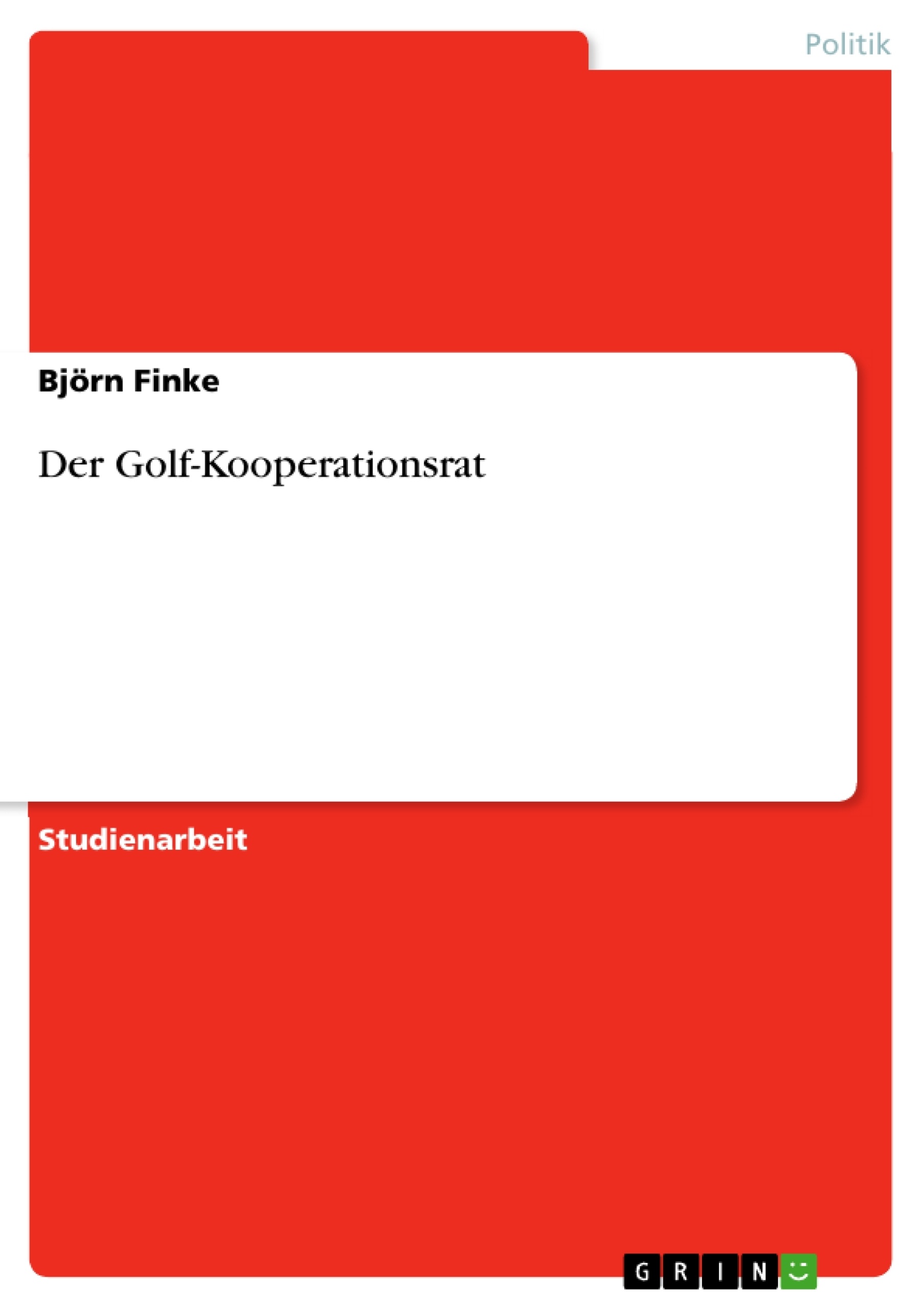Der Golf-Kooperationsrat (GKR) ist ein regionales Forum, in dem sechs arabische Staaten zusammenarbeiten: Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Herrschafts- und Wirtschaftsstruktur und der kulturelle Hintergrund der Mitglieder sind relativ ähnlich, trotzdem gibt es große Interessensgegensätze. Die Gegensätze hemmen die Zusammenarbeit, zum Teil entladen sie sich in militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern. Auf der anderen Seite gibt es auch Kooperationsfortschritte, der GKR plant wirtschaftliche Integration. Die Seminararbeit zeigt, wo die Staaten kooperieren und wo nicht. Zudem wird erklärt, welche Interessensgegensätze die Kooperation in bestimmten Bereichen hemmen.
Eine der größten Bremsen ist das Misstrauen der kleineren GKR-Staaten gegenüber Saudi-Arabien. Im Bereich der Wirtschaft ergänzen sich die Staaten außerdem zu wenig, um große Kooperationsgewinne erzielen zu können. Am erfolgreichsten ist die Zusammenarbeit noch bei der Bekämpfung der Opposition.
Gesondert wird die Frage behandelt, welche externen Einflüsse die Kooperation trotz der internen Spannungen am Leben halten und wie der GKR auf Druck von Nicht-Mitgliedern reagiert. Denn einigend wirken vor allem die gemeinsamen Feinde: Die GKR-Staaten können sich nur an das brüchige Bündnis anlehnen, eine Anlehnung an die großen Nachbarn Iran und Irak würde Souveränitätsverluste bedeuten.
Inhaltsübersicht
I. Einleitung
II. Vorgeschichte
III. Struktur
IV. Felder der Kooperation
V. Externe Einflüsse auf die Kooperation
VI. Bilanz und Ausblick
VII. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Der Golfkooperationsrat (GKR) ist ein regionales Forum, in dem sechs arabische Staaten zusammenarbeiten. Die Herrschafts- und Wirtschaftsstruktur und der kulturelle Hintergrund der Mitglieder sind relativ ähnlich, trotzdem gibt es große Interessensgegensätze. Die Gegensätze hemmen die Zusammenarbeit, zum Teil entladen sie sich in militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern. Auf der anderen Seite gibt es auch Kooperationsfortschritte, der GKR plant wirtschaftliche Integration. In meiner Seminararbeit untersuche ich, wo die Staaten kooperieren und wo nicht. Zudem zeige ich, welche Interessensgegensätze die Kooperation in bestimmten Bereichen hemmen. Gesondert behandele ich die Frage, welche externen Einflüsse die Kooperation trotz der internen Spannungen zusammenhalten, und wie der GKR auf Druck von Nicht-Mitgliedern reagiert.
Grundlage der Untersuchung ist der Kooperationsbegriff von Robert Keohane: Von Kooperation ist dann zu sprechen, wenn Akteure ihr Verhalten mit den Interessen anderer abstimmen; dank dieses zielgerichteten Verhaltens sollen sich am Ende alle Seiten in einer besseren Lage befinden als wenn sie nicht kooperiert hätten, sprich: Sie erzielen Gewinne.1
Die Ausführungen zu den externen Einflüssen basieren auf Ruth Zimmerlings Untersuchung: Externe Einflüsse auf die Integration von Staaten. Zur politikwissenschaftlichen Theorie regionaler Zusammenschlüsse, Freiburg/München 1991. Zimmerling beschäftigt sich mit externen Einwirkungen auf Integrationsprozesse. Integration setzt Kooperation voraus,2 daher verwende ich ihre Ausführungen, obwohl der GKR kaum Ansätze zur Integration beinhaltet.
II. Vorgeschichte
Die Gründungs-Charta für ,,The Cooperation Council for The Arab States of The Gulf" unterzeichneten die Staatsoberhäupter der sechs teilnehmenden Länder am 25. Mai 1981 in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Mitglieder des Rates sind das Königreich Saudi-Arabien und das Sultanat Oman sowie Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.3 Die Idee einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Golfstaaten ist älter:
II.1 Die Vereinigten Arabischen Emirate
Großbritanniens Premierminister Harold Wilson kündigte 1968 an, daß sich sein Land, die Protektoratsmacht, bis Ende 1971 vom Golf zurückzuziehen werde. Damit nach dem Schließen ihrer Stützpunkte kein Machtvakuum entsteht, drängten die Briten die neun Emirate am Golf, eine Föderation zu gründen. Seit 1968 wurde verhandelt, 1971 schlossen sich sechs Emirate zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen; 1972 folgte ein siebtes Emirat. Die beiden übrigen Emirate Bahrain und Katar blieben dem Zusammenschluß fern.4 Der Golfkooperationsrat stellt also nicht die erste Plattform für Kooperation zwischen arabischen Golfanreinern dar.
II. 2 Bedrohungsvorstellungen und Eskalation
Mitte der 70er Jahre intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen den späteren GKR-Mitgliedern. Den Staaten war gemein, daß sie ihre Souveränität von den ungleich mächtigeren Nachbarn Iran und Irak bedroht sahen. Von 1978 bis 1980 spitzte sich die Lage zu: Im Sommer 1978 kamen im Südjemen radikal-marxistische Kräfte an die Macht, im Dezember 1979 besetzte die Sowjetunion Afghanistan. Die konservativen Herrscher der Golfstaaten fühlten sich von der Sowjetunion und ihren Verbündeten umzingelt. Im Frühjahr 1979 siegte die islamische Revolution im Iran, der Schah von Persien wurde abgesetzt. Die Oberhäupter der Golfstaaten befürchteten, daß die neuen iranischen Herrscher die Revolution auf das andere Ufer des Golfes exportieren - in ihre Staaten, in denen große schiitische Volksgruppen leben. Im November 1979 besetzten Oppositionelle die große Moschee in Mekka mit dem Ziel, die saudischen Herrscher zu stürzen. Als dann die großen Nachbarn Iran und Irak ab September 1980 ihre Kräfte in einem Krieg gegenseitig banden, konnten die sechs Golfstaaten einen Zusammenschluß wagen, ohne Gegenmaßnahmen erwarten zu müssen.5
III. Struktur
III.1 Oberster Rat
Der Oberste Rat ist höchstes Gremium des GKR: In ihm treffen sich der König von Saudi-Arabien, der Sultan von Oman und die vier Emire - in der Regel einmal im Jahr. Im Obersten Rat werden die politischen Entscheidungen gefällt. Jeder Herrscher hat eine Stimme. ,,In substantive matters"6 (bei wesentlichen Fragen) muß Einstimmigkeit vorliegen. Die Präsidentschaft wird per Rotationsverfahren für ein Jahr vergeben.7 Das 19. und bislang letzte Gipfeltreffen fand im Dezember 1998 in Abu Dhabi statt.8
III. 2 Ministerrat
In diesem Rat sitzen die Außenminister der sechs Staaten. Ihm beigeordnet sind weitere Gremien für die Minister anderer Ressorts und die Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der Ministerrat trifft sich vierteljährlich: Er bereitet die Gipfeltreffen des Obersten Rates vor, macht Vorschläge zur GKR-Politik und spricht Empfehlungen für die Gremien der Fachminister aus.9
III.3 Generalsekretariat
Die Verwaltung des GKR sitzt in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh. Der Generalsekretär wird vom Obersten Rat für drei Jahre ernannt, maximal zwei Amtszeiten sind möglich. Das Sekretariat erarbeitet Studien, dokumentiert die Tätigkeit des GKR und verfolgt die Umsetzung der GKR-Beschlüsse in den Staaten.10
III. 4 Schlichtungskommission (dem Obersten Rat angeschlossen)
Sie ist in der Charta vorgesehen, um Empfehlungen aussprechen, wie Konflikte zwischen GKR-Mitgliedern zu lösen sind. Der Oberste Rat wählt bei Bedarf sachkundige Bürger aus nicht-konfliktbeteiligten GKR-Staaten in das Gremium. Da die Mitglieder des Obersten Rates aber im Konfliktfall kein Interesse daran haben, Befugnisse abzugeben, existiert die Schlichtungskommission nur auf dem Papier.11
III. 5 Konsultativrat
Ihn ihm sitzen fünf Bürger aus jedem GKR-Staat, also insgesamt 30. Die Mitglieder werden für drei Jahre von den Staatsoberhäuptern ernannt. Der Rat darf nur Stellung nehmen zu Themen, die der Oberste Rat an ihn verweist.12
IV. Felder der Kooperation
In Artikel vier der Charta des Golfkooperationsrats wird als Ziel festgehalten, die Einheit der Mitgliedsstaaten zu erreichen. Dies soll durch Koordination, Integration und Verbindungen zwischen den Staaten bei allen Aufgabenfeldern erreicht werden. Regelungen in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, Handel und Zölle, Ausbildung und Kultur, Soziales und Gesundheitsfürsorge, Information und Tourismus, Gesetzgebung und Verwaltung sollen vereinheitlicht werden; zudem sind joint-ventures geplant.13 Wurden die Pläne umgesetzt?
IV.1 Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Wirtschaftlich kooperieren die sechs Staaten nur auf begrenztem Niveau, obwohl diesem Bereich der Zusammenarbeit in der Gründungs-Charta viel Platz beigemessen wurde. Zwar billigten die Staatsoberhäupter am 11. November 1981 auf dem zweiten Treffen des Obersten Rates des GKR ein Unified Economic Agreement. Dessen Ziel ist ein gemeinsamer Markt mit einheitlicher Währung und Wirtschaftsplanung, also schon Wirtschaftsintegration statt - kooperation.14 Allerdings sind die Staaten von diesem Ziel auch heute noch weit entfernt.15
Aber es ist einfacher geworden für Bürger aus GKR-Staaten, in anderen Ratsstaaten Geschäfte zu machen: So werden Firmen aus GKR- Ländern bei der Vergabe staatlicher Aufträgen in den Ratsländern bevorzugt, und GKR-Bürger können in einigen Bereichen ohne Vermittler Geschäfte tätigen. Verkehrswege wurden aus-, die Formalitäten beim Grenzübertritt abgebaut. Es existieren eine Gulf Investment Cooperation, die joint-ventures finanzieren soll (ein Beispiel für ein joint-venture: eine Raffinerie im Oman) und Institutionen, die den Handel vereinfachen (GCC Patent Bureau, GCC Commercial Arbitration Center, GCC Specifications and Standards Cooperation).16
Trotzdem stieß die Kooperation an ihre Grenzen: So findet keine gemeinsame Industrieplanung statt, obwohl ein abgestimmtes Vorgehen bei der Diversifikation der Wirtschaft (Aufbau weiterer Branchen neben der Petrochemie) Verluste durch gegenseitige Konkurrenz verhindern würde. Als Kooperationsbremse wirkt die Wirtschaftsstruktur der GKR-Mitglieder: Alle Ländern leben größtenteils vom Ölexport. Sie stehen in Konkurrenz zueinander; die Volkswirtschaften ergänzen sich nicht; der gemeinsame Markt, der durch Kooperation entstehen würde, ist zudem sehr klein (20 Millionen Konsumenten). Kein Staat würde daher große Gewinne daraus ziehen, wenn er wirtschaftlich enger kooperieren würde mit seinen Nachbarn. Im Gegenteil herrscht zum Teil Angst vor dem Verlust wirtschaftlicher Souveränität.17 Insofern kann ein Übermaß an Homogenität auch Kooperation behindern, ,,homology"18 muß nicht nur fördernd wirken.
IV.2 Zusammenarbeit in der Außenpolitik
Auch in der Außenpolitik ist die Kooperation nicht weit gediehen. Eine abgestimmte GKR-Außenpolitik ist die Ausnahme, eher kann man von einer ,,Fortsetzung früherer einzelstaatlicher Diplomatie"19 sprechen. Als Saudi-Arabien beispielsweise 1988 die Beziehungen zum Iran abbrach, folgten die anderen GKR-Staaten nicht dieser Entscheidung.20 Oman, Katar - manchmal auch die Vereinigten Arabischen Emirate - scheren regelmäßig aus dem Konsens der übrigen Staaten aus. Die drei Staaten verhielten sich im Tankerkrieg 1987 relativ neutral. Oman und Katar unterstützten als einzige GKR-Staaten offiziell das Gaza-Jericho- Abkommen, und trotz des irakischen Überfalls auf Kuwait stellte der omanische Sultan nicht seine guten Beziehungen zum Irak in Frage.
Kuwait dagegen hatte mehrere Jahre lang als einziger GKR-Staat offiziellen Kontakt zur Sowjetunion. Auf der anderen Seite dient der GKR den Staaten als Plattform, um mit der EU und Vereinigungen anderer Wirtschaftsräume zu verhandeln.21
Offensichtlich liegen nicht in jedem Fall gemeinsame Interesse für eine außenpolitische Zusammenarbeit vor. Kleinere GKR-Staaten scheuen eine zu enge Anlehnung an Saudi-Arabien und wollen sich mit Sonderbeziehungen zum Iran und Irak einen gewissen Freiraum schaffen. Saudi-Arabien als Hegemon erzeugt Mißtrauen, die Asymmetrie in der Machtverteilung förderte zwar anfangs die Kooperation, behindert sie aber nun.22
IV.3 Austausch und Kriege
Kooperation verlangt Austausch: mindestens unter den Staatsführungen, besser noch zugleich unter den Bürgern.23 Um bei der Erreichung von Zielen zusammenzuarbeiten, muß man sich über die Ziele und Interessen gegenseitig informieren. Zudem kann gegenseitiges Kennenlernen Mißtrauen abbauen. Dank GKR treffen sich die Staatsoberhäupter mindestens einmal im Jahr, die Minister mindestens viermal. In Diskussionsgruppen des Generalsekretariats treffen die Eliten der Bevölkerung aus Bürokratie und Wirtschaft zusammen. So veranstaltet das Sekretariat Treffen zwischen Mitgliedern der Industrie- und Handelskammern der Staaten. Daß Geschäftskontakte einfacher geworden sind (siehe IV.1), führt ebenfalls zu einem besseren gegenseitigen Kennenlernen. Ärgerlich für die Staatsoberhäupter: Auch die Opposition kooperiert.24 Doch die Zusammenarbeit der Staaten hat Grenzen. Im Jahr 1994 hatten die GKR-Mitglieder Bahrain und Katar noch keine Botschafter ausgetauscht. Schlimmer noch: Unstimmigkeiten über den Grenzverlauf zwischen den beiden Staaten führen regelmäßig zu bewaffneten Auseinandersetzungen, auch zwischen Saudi-Arabien und Katar eskalierte der Grenzstreit 1992.25 Der GKR konnte diesen Konflikt nicht alleine lösen. Das Vertrauen zwischen den Staaten scheint nicht ausgeprägt genug zu sein, militärische Lösungen werden Verhandlungslösungen teilweise vorgezogen.
IV.4 Sicherheitskooperation
IV.4.1 Militär
,,Die Bewahrung der Herrschaftssysteme und der Schutz der nationalen Souveränität jedes Landes"26 sei ein Hauptziel des GKR, sagte Abdalla Yaqub Bishara, erster GKR-Generalsekretär. Daß die Staaten dies in der Charta nicht ausdrückten (siehe IV.Einleitung), hat externe Gründe (siehe V.2). Die Mitgliedschaft im GKR bedeutet zugleich Mitgliedschaft in einem Beistandspakt. Die GKR-Länder richteten und richten gemeinsame Manöver aus, allerdings mit so wenig Einheiten, daß den Übungen mehr symbolischer Charakter zukommt. Im Sommer 1984 bewährte sich der Beistandspakt, als der Rat geschlossen gegen iranische Luftangriffe auf Tanker im Golf vorging. Im November 1984 beschlossen die Staatsoberhäupter, eine schnelle Eingreiftruppe (Rapid Deployment Force) zu bilden. 1994 verfügte die Einheit über 17.000 Soldaten, ihr Abschreckungspotential ist also sehr gering. Geplant ist die Vernetzung der Radarsysteme, abgestimmte Rüstungskäufe scheiterten.27
Daß die Kooperation nur langsam vorangeht trotz der Bedrohung von außen (Iran, Irak) und der formulierten Zielsetzung, hat mehrere Gründe: Zum einen ist das militärische Potential der bevölkerungsarmen Staaten trotz hoher Rüstungsausgaben zu gering; die wenigen Soldaten, die ein Staat hat, will er nur ungern bei einem gemeinsamen GKR-Einsatz zur Verfügung stellen. Zum anderen herrscht Mißtrauen unter den GKR-Staaten. Die kleinen Länder befürchten eine Hegemonie des militärisch stärksten Mitgliedsstaat Saudi-Arabien und wollen nicht in einem so sensiblen Bereich eng kooperieren. Zudem gibt es Befürchtungen, daß eine GKR-Truppe auch gegen das eigene Land eingesetzt werden könnte. Einige GKR-Länder setzen Militär gegeneinander ein (siehe IV.4), sie werden nur ungern sensible Informationen über ihre Truppe preisgeben.28 Der Hauptgrund aber: In den autoritären GKR-Staaten ist Militär eine Machtbasis und eine Quelle von Prestige. Die vollständige Kontrolle über die Armee abzugeben heißt, die Stabilität des Regimes und die Souveränität des Landes anzutasten. Es existiert zwar ein gemeinsames Interesse (Schutz vor Iran und Irak), aber der Kooperationsgewinn in Form von erhöhter Sicherheit gegen die beiden Regionalmächte wird - vor allem von den kleinen GKR-Staaten - als niedriger empfunden als der Verlust in Form von Abgabe der vollständigen Kontrolle über die Armee.29 Daß der Gewinn so klein ist, liegt daran, daß selbst bei einer militärischen Integration hin zu einer großen GKR-Armee diese Truppe alleine dem Iran oder Irak wenig entgegenzusetzen hätte. Die Herrscher setzen daher lieber auf westliche Hilfe, schließen bilaterale Schutzverträge mit Frankreich, Großbritannien und den USA ab und gewinnen so Unabhängigkeit vom GKR.30 Sicherheit garantiert der Westen, nicht der Beistandspakt GKR.
IV.4.2 Bekämpfung der Opposition
Äußere und innere Sicherheit sind in den Golfstaaten nicht zu trennen. Die Regionalmacht Iran ist nicht nur militärisch eine Bedrohung, sie stachelt die schiitischen Volksgruppen in den Staaten am anderen Ufer des Golfes auf und gibt auch anderen Oppositionsgruppen Rückenwind, indem sie die Legitimität der Herrschaft der Staatsoberhäupter in Frage stellt. Zudem macht die Bindung an den Westen, die einerseits militärischen Schutz bietet, die Staaten zugleich innenpolitisch verletzlich. Oppositionsgruppen in den Golfstaaten lehnen die Westbindung und die große Anzahl westlicher Ausländer ab.31
Gemäß dem Ziel des GKR - Bewahrung der Herrschaftssysteme (siehe IV.4.1) - kooperieren die Staaten daher auch im Bereich der inneren Sicherheit, und zwar erfolgreicher als im militärischen Sektor. Nach einem Umsturzversuch in Bahrain 1981 - angeblich vom Iran initiiert - schloß Saudi-Arabien bilaterale Kooperations-Abkommen im Bereich der inneren Sicherheit mit allen GKR-Mitgliedern außer Kuwait ab. Im Dezember 1987 folgte dann ein GKR-Vertrag: Die Opposition sollte gemeinsam kontrolliert, Ausländer überwacht werden. Das Abkommen sah zum Unwillen Saudi-Arabiens kein hot pursuit vor, also keine Erlaubnis, daß Polizeikräfte eines Staates im GKR-Ausland agieren - eine zu starke Einschränkung der Souveränität. Trotzdem erleichterte die Kooperation die Unterdrückung der Opposition in Saudi-Arabien.32 Die Regimes sind alle ähnlich autokratisch und haben mit ähnlichen Oppositionsgruppen zu kämpfen - diese Homogenität führt zu Interessengleichheit. Man sitzt im selben Boot. Zu starke Souveränitätsverluste wollen die Herrscher zwar nicht hinnehmen, trotzdem arbeiten sie zusammen und erzielen dabei in der Tat Gewinne.33
V. Externe Einflüsse auf die Kooperation
Trotz der Ähnlichkeiten im Herrschaftssystem, in der Wirtschaftsstruktur und im kulturell-religösen Bereich (alle GKR- Mitglieder sind islamische, arabische Staaten)34 haben die GKR- Mitglieder zum Teil widerstrebende nationale Interessen, die der Zusammenarbeit Grenzen ziehen (siehe IV.). Die Gründung des GKR war daher vor allem eine Reaktion auf externe Entwicklungen und weniger Ergebnis der freundschaftlichen und engen Beziehungen zwischen den Staaten. Auch auf die offizielle Zielsetzung des GKR wirkten externe Einflüsse ein.
V.1 Negative externe zwingende Gründe
Die gemeinsame Wahrnehmung von Staaten einer Region, daß sie von anderen Akteuren bedroht werden, ist ein häufig beobachteter Impuls für Kooperationen oder Integrationsprozesse.35 Die Staaten des GKR fühlten sich 1981 von mehreren Seiten bedroht (siehe auch II.2): Zum einen befürchteten sie eine Einkreisung durch die Sowjetunion, zum anderen, daß der Golf durch eine Ausweitung des iranisch-irakischen Krieges zum Konfliktfeld der Supermächte wird. Israel stellte ein Bedrohungspotential dar, da die Golfstaaten davon ausgehen mußten, daß die israelische Luftwaffe jederzeit strategische Ziele in arabischen Staaten angreift.36
Die größten Sorgen machten sich die Staatsoberhäupter aber wegen der Nachbarn Iran und Irak. Nach dem Umsturz im Iran befürchteten die Herrscher ein Überschwappen der Revolution. Irans Führung plante in der Tat einen Revolutionsexport. Weiteres Konfliktpotential liegt darin, daß der Iran drei Inseln im Golf besetzt hatte, die Staatsgebiet der Vereinigten Arabischen Emiraten sind. Iraks Anspruch, Hegemonialmacht in der Golfregion zu sein, stellte ebenfalls eine Bedrohung dar.37 Die gemeinsame Angst vor Oppositionsbewegungen wurde schon in IV.4.2 dargestellt. Die Gründung des GKR als Beistandspakt sollte den Staaten Sicherheit geben.
V.2 Erwartete Reaktionen anderer Staaten
Auch die erwarteten Reaktionen Dritter auf eine Entscheidung zur Zusammenarbeit beeinflussen die Kooperation.38 Sieht ein Staat die Kooperationspläne seiner Nachbarn mit Unbehagen, wird er versuchen, die Kooperation zu verhindern. Die Staaten, die zur Zusammenarbeit bereit sind, müssen diese Reaktionen und die Folgen bei ihrer Entscheidung für oder gegen eine Kooperation berücksichtigen. Die Staaten des GKR taten dies auch. Zum einen galt es, Bedenken der anderen Mitglieder der Arabischen Liga zu zerstreuen. Einige arabische Staaten sahen in dem GKR einen Klub reicher Länder, die sich von den anderen arabischen Nationen absetzen und so das Ideal der arabischen Einheit beschädigen. Daher betonte der GKR, daß der Zusammenschluß in Übereinstimmung mit der Charta der arabischen Liga stehe, und daß es sich lediglich um ein Wirtschaftsbündnis handele, nicht um eine Institution zur Sicherheitskooperation.39 Irak und Iran lehnten die Kooperation der Nachbarstaaten ab, da sie sich beide als Hegemonialmacht am Golf verstehen, die Nachbarn sich also nur mit ihnen verbünden sollten. Daher warteten die späteren GKR-Staaten mit der Gründung, bis beide Nachbarn ihre Kräfte durch den ersten Golfkrieg gebunden hatten, folglich keine militärischen Reaktionen auf die GKR-Gründung zu erwarten waren.40
V.3 Demonstrationseffekt
Bestehende Kooperationen können externer Impulsgeber für neue Kooperationen sein: Die bestehenden Kooperationen dienen als Vorbilder, die von Staaten nachgeahmt werden.41 Die GKR-Staaten konnten die Vereinigten Arabischen Emirate als Vorbild ansehen (siehe II.1).42 Diese Union wurde gegründet, da die kleinen Emirate nach dem Abzug der Protektoratsmacht alleine nicht überlebensfähig gewesen wären. Genau wie der GKR soll die Union ihren Mitgliedern Sicherheit und Bestandsschutz garantieren. Ein positives Beispiel, das den späteren GKR-Ländern zeigte, daß Kooperation Gewinne bringt.
VI. Bilanz und Ausblick
Der Golfkooperationsrat ist vor allem ein Forum für Sicherheitskooperation. Die wirtschaftliche Kooperation entwickelt sich noch schleppender als die militärische, und in der Außenpolitik spricht der GKR bei wichtigen Fragen (Verhältnis zum Iran) nicht mit einer Stimme. Von Integration hin zu einem Einheitsstaat, wie in der Charta formuliert, kann keine Rede sein.
Der Impuls für die Gründung kam von außen - der Rat ist Antwort auf die Bedrohungen, denen sich die Mitglieder 1981 ausgesetzt gesehen haben. Militärische Kooperation sollte die Souveränität der Mitglieder stärken; die Staaten wollten sich nicht den Hegemonie-Ansprüchen der großen Nachbarn beugen. Daß der GKR hier versagt hat (was bei den geringen militärischen Ressourcen der Mitglieder kein Wunder ist), zeigte die irakische Invasion in Kuwait. Die Sicherheit der GKR- Mitglieder garantiert heute der Westen, nicht die gemeinsame GKR- Armee und nicht die gemeinsame Radarüberwachung. Als Erfolg hingegen ist die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Opposition zu bewerten.
Als Kooperationsbremse wirkten die Interessensunterschiede der Mitglieder und das Mißtrauen der kleineren GKR-Staaten gegenüber Saudi-Arabien. Im Bereich der Wirtschaft ergänzen sich die Staaten zu wenig, um große Kooperationsgewinne erzielen zu können. Einigend wirken die gemeinsamen Feinde: Die GKR-Staaten können sich nur an das brüchige Bündnis anlehnen, eine Anlehnung an die großen Nachbarn Iran und Irak würde Souveränitätsverluste bedeuten. Es gibt also keine Alternative.
Wenn Iran und Irak aber keine Bedrohung mehr darstellten, bräche der GKR beim nächsten internen Grenzscharmützel auseinander. Iran und Irak werden nie so geschwächt werden, daß sie für die kleinen autoritär regierten Staaten keine Gefahr mehr bedeuten. Wenn sich allerdings die Sicherheitsgarantien des Westens als Abschreckung gegen die Nachbarn bewähren, und die Westbindung von der eigenen Bevölkerung akzeptiert wird, verlieren Iran und Irak ihren Schrecken. Die Akzeptanz wird beeinflußt von der Haltung des Westens im Israel/Palästina-Konflikt. Die Zukunft des GKR entscheiden externe Akteure.
VII. Literaturverzeichnis
- Braun, Ursula: Der Kooperationsrat arabischer Staaten am Golf: Eine neue Kraft? Regionale Integration als Stabilitätsfaktor, Baden-Baden 1986
- Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zeitung für Deutschland (Unbekannte Autoren)
- Galtung, Johan: A Theory of Peaceful Co-operation, in: Galtung, Johan (Hrsg.): Co-operation in Europe, Oslo u. a. 1970
- http://www.g-c-c.net, Stand: 20.04.1999
- Hünseler, Peter: Die Gründung des Golf-Rates, in: Steinbach, Udo/Robert, Rüdiger (Hrsg.): Der nahe und mittlere Osten. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte und Kultur, Bd. 1 (Grundlagen, Strukturen und Problemfelder), Leverkusen 1988, S. 691f
- Hünseler, Peter: Die islamische Revolution in Iran und ihre Auswirkungen auf die Golfregion, in: Steinbach, Udo/Robert, Rüdiger (Hrsg.): Der nahe und mittlere Osten. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte und Kultur, Bd. 1 (Grundlagen, Strukturen und Problemfelder), Leverkusen 1988, S. 687f
- Kistenfeger, Hartmut: Maghreb-Union und Golfrat. Regionale Kooperation in der arabischen Welt, DGAP-Arbeitspapiere zur Internationalen Politik, Nr. 89, Bonn 1994
- Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg. für das Deutsche Orient-Institut): Nahost Jahrbuch 1997. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten, Leverkusen 1998
- Milner, Helen: International theories of cooperation among nations. Strength and weaknesses, in: World Politics 3/1992, S. 466-496
- Nohlen, Dieter/Nuscheler, Franz (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, Bd. 6 (Nordafrika und Naher Osten), Bonn 1993
- Tripp, Charles: Regional Organizations in the Arab Middle East, in: Fawcett, Louise/Hurrell, Andrew (Hrsg.): Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order, Oxford 1995, S. 283-308
- Ulfkotte, Udo: Überraschende Teilnahme Qatars, in: FAZ v. 22.12.1992, S. 8
- Zimmerling, Ruth: Externe Einflüsse auf die Integration von Staaten. Zur politikwissenschaftlichen Theorie regionaler Zusammenschlüsse, Freiburg/München 1991
Der Golf-Kooperationsrat (GKR)
Thesenpapier zum Referat von Björn Finke am 6. Mai 1999
I. Der GKR in Kürze:
- Mitglieder sind Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate: alle relativ wohlhabend, alle militärisch schwach, alle autoritär beherrscht. Sitz des Generalsekretariats ist die saudi-arabische Hauptstadt Riyadh.
- Der Rat wurde 1981 gegründet als Reaktion auf die islamische Revolution in Iran, den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und den Beginn des ersten Golfkriegs (Iran gegen Irak).
- Laut Charta ist der GKK ein Wirtschaftsbündnis, in Wirklichkeit aber ein Forum für Sicherheitskooperation (Zusammenarbeit der Armee und der Geheimdienste): Die Staaten wollten sich durch einen Beistandspakt gegenseitig schützen und ihre Unabhängigkeit gegenüber den großen Nachbarn Iran und Irak wahren. Spätestens seit der Besetzung Kuwaits durch den Irak ist klar, daß das militärische Potential der sechs Mitgliedsstaaten nicht ausreicht - der GKR ist weit davon entfernt, gleichwertiger Akteur neben Iran und Irak in der Golfregion zu sein. Der Westen schützt die Golfstaaten, nicht der GKR.
- Die Kooperation im GKR entwickelt sich schleppend.
II. Diskussionsthesen
1. Der GKR ist bei den Kooperationsbemühungen an seine Grenze gestoßen. Die Mitglieder fürchten bei zu starker Zusammenarbeit um ihre Souveränität. Die Kooperation wird nicht weiter vertieft werden (außer vielleicht bei der Bekämpfung der Opposition, wo die Kooperationsgewinne hoch sind).
2. Der GKR wird vor allem durch den Druck von außen zusammengehalten: Die sechs Staaten eint, daß sie sich von Iran und Irak mehr oder minder bedroht fühlen. Bewährt sich der Schutzschild des Westens in der Golfregion, nimmt das Bedrohungsgefühl ab. Der GKR bräche wegen interner Streitigkeiten auseinander oder versänke als Leiche, die nicht offiziell beerdigt ist, in der Bedeutungslosigkeit.
3. Auf lange Sicht retten könnte den GKR eine Demokratisierung seiner Mitgliedsstaaten. Die bürgerlichen Eliten ziehen aus der zaghaften Wirtschaftskooperation Gewinne, sie werden den GKR stärken wollen. Herrscher mit breiterer Machtbasis könnten es sich auch leisten, die Kontrolle über Teile der Armee zugunsten einer GKR-Armee abzugeben. Umkehrschluß: Der GKR leidet unter den autoritären Herrschaftssystemen seiner Mitglieder.
[...]
1 Vgl. Milner, Helen: International theories of cooperation among nations. Strength and weaknesses, in: World Politics 3/1992, S. 466-496 (467f)
2 Vgl. Zimmerling, Ruth: Externe Einflüsse auf die Integration von Staaten. Zur
politikwissenschaftlichen Theorie regionaler Zusammenschlüsse, Freiburg/München 1991, S. 53f
3 Vgl. die vom GKR-Generalsekretariat herausgegebene englische Übersetzung der Charta, abgedr. in: Braun, Ursula: Der Kooperationsrat arabischer Staaten am Golf: Eine neue Kraft? Regionale Integration als Stabilitätsfaktor, Baden-Baden 1986, S.136-138
4 Vgl. Braun (Anm. 3), S. 11f, und Kistenfeger, Hartmut: Maghreb-Union und Golfrat. Regionale Kooperation in der arabischen Welt, DGAP-Arbeitspapiere zur Internationalen Politik, Nr. 89, Bonn 1994, S. 86-96. Vgl. für die Jahreszahlen der Staatsgründungen Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg. für das Deutsche Orient-Institut): Nahost Jahrbuch 1997. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten, Leverkusen 1998, S. 62, 68, 70
5 Vgl. Tripp, Charles: Regional Organizations in the Arab Middle East, in: Fawcett, Louise/Hurrell, Andrew (Hrsg.): Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order, Oxford 1995, S. 283-308 (293). Vgl. auch Hünseler, Peter: Die islamische Revolution in Iran und ihre Auswirkungen auf die Golfregion, in: Steinbach, Udo/Robert, Rüdiger (Hrsg.): Der nahe und mittlere Osten. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte und Kultur, Bd. 1 (Grundlagen, Strukturen und Problemfelder), Leverkusen 1988, S. 687f. Vgl. zudem Braun (Anm. 3), S. 15-25, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 96-98 sowie S. 100 für Angaben zu den Schiiten
6 Artikel neun, Punkt zwei der Charta, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 137
7 Vgl. die vom GKR-Generalsekretariat herausgegebene englische Übersetzung der Geschäftsordnung, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 139-141. Vgl. für eine Zusammenfassung Braun (Anm. 3), S. 35f, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 109-111
8 Vgl. ,,Besorgnis über niedrigere Öleinnahmen", in: FAZ v. 7.12.1998, S. 8
9 Vgl. die Charta, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 137. Vgl. zudem die Geschäftsordnung, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 142-145. Vgl. für eine Zusammenfassung Braun (Anm. 3), S. 36, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 112
10 Vgl. die Charta, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 137f. Vgl. für eine Bewertung Braun (Anm. 3), S. 36f, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 112f
11 Vgl. die Charta, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 136f, und die Geschäftsordnung, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 146f. Vgl. für eine Zusammenfassung Braun (Anm. 3), S. 38, für eine Bewertung Kistenfeger (Anm. 4) S. 111, 137f
12 Vgl. Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 182
13 Vgl. die Charta, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 136
14 Vgl. die englische Übersetzung des Abkommens, abgedr. in: Braun (Anm. 3), S. 148f. Vgl. zur Definition von Integration Zimmerling (Anm. 2), S. 55
15 Vgl. Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 182f
16 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 148, und Braun (Anm. 3), S. 119f. Vgl. für die gemeinsamen Institutionen http://www.g-c-c.net (am 20.04.1999 gelesen)
17 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 148-152, und Hünseler, Peter: Die Gründung des Golf- Rates, in: Steinbach, Udo/Robert, Rüdiger (Hrsg.) (Anm. 5), S. 691f. Vgl. speziell zur Homogenität der Wirtschaft Braun (Anm. 3), S. 45. Vgl. speziell zu den Bemühungen um Diversifikation ,,Golfrat industrialisiert mit Auslandshilfe", in: FAZ v. 15.2.1995 und ,,Golfstaaten müssen Industrie diversifizieren", in: FAZ v. 4.7.1996. Vgl. für einen Überblick über die Wirtschaftsstruktur der Staaten Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 62-71, 138, 143
18 Galtung, Johan: A Theory of Peaceful Co-operation, in: Galtung, Johan (Hrsg.): Cooperation in Europe, Oslo u. a. 1970, S. 9-20 (13). Galtung führt aus, daß strukturelle Ähnlichkeit Kooperation fördern kann.
19 Braun (Anm. 3), S. 122
20 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 125f
21 Vgl. für einen Überblick ebd., S. 141-145, und Braun (Anm. 3), S. 122-126. Vgl. zu Kuwaits Beziehungen zur UdSSR Kistenfeger (Anm. 4), S. 122, zum Tankerkrieg ebd., S. 116, und zu den Verhandlungen mit der EU ebd., S. 152
22 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 141f, 158. Vgl. zu den unterschiedlichen Machtressourcen der Länder Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 62-71, 138, 143. Vgl. zum positiven Einfluß von asymmetrischer Machtverteilung auf Kooperationen Milner, Helen (Anm. 1), S. 480
23 Vgl. Galtung (Anm. 18), S. 9f, 14f
24 Vgl. Braun (Anm. 3), S. 41-44, 120f. Vgl. zur Zusammenarbeit der Opposition Kistenfeger (Anm. 4), S. 114
25 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 135-138, und Ulfkotte, Udo: Der Streit blieb aus, in: FAZ v. 6.12.1995, S. 9, sowie ,,Zerstrittene Araber suchen Einigkeit", in: FAZ v. 7.12.1996, S. 5, und ,,Bahrein bleibt Gipfeltreffen fern", in: FAZ v. 9.12.1996, S. 7
26 Bishara, Abdalla Yaqub, zit. in: Kistenfeger (Anm. 4), S. 106
27 Vgl. zu abgestimmten Waffenkäufen Braun (Anm. 3), S. 61f, und zum gemeinsamen Schutz der Tanker ebd., S. 81f. Vgl. zur Funktion des GKR als Beistandspakt Kistenfeger (Anm. 4), S. 115, und zur Stärke der GKR-Armee ebd., S. 139. Vgl. zum Radarsystem Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 183. Vgl. eine Bewertung des Militärkonzepts von Tripp, Charles (Anm. 5), S. 294
28 Vgl. zum beschränkten militärischen Potential Braun (Anm. 3), S. 66-70, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 115f. Vgl. zum Mißtrauen gegenüber Saudi-Arabien Kistenfeger (Anm. 4), S. 144f. Vgl. zum Mißtrauen gegenüber einer starken GKR-Armee Ulfkotte, Udo: Überraschende Teilnahme Qatars, in: FAZ v. 22.12.1992, S. 8
29 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 142, und Braun (Anm. 3), S. 60. Wie schwierig Militärkooperation ist, zeigt auch das Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate, wo sich erst 1997 die Streitkräfte des Emirats Dubai der gemeinsamen Truppe der übrigen Emirate angeschlossen haben: Vgl. Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 70
30 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 145, 158f. Militärpräsenz von anderen arabischen Staaten als Sicherheitsgarantie wird kritisch gesehen; die Herrscher befürchten Souveränitätsverluste. Daher hat die Damaskus-Erklärung langfristig keine Bedeutung erlangt: Vgl. Nohlen, Dieter/Nuscheler, Franz (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, Bd. 6 (Nordafrika und Naher Osten), Bonn 1993, S. 562f, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 119f
31 Vgl. zum Faktor Iran Braun (Anm. 3), S. 20-25, 92-99, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 100. Vgl. zur Kritik am Westen Braun (Anm. 3), S. 19f, 103-105
32 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 140f, und Braun (Anm. 3), S. 60f
33 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 102f, 159, und für eine Darstellung der Herrschaftssysteme Koszinowski, Thomas/Mattes, Hanspeter (Hrsg.) (Anm. 4), S. 62-72, 138-140, 144. Vgl. für eine positive Bewertung der Sicherheitskooperation Tripp, Charles (Anm. 5), S. 293
34 Vgl. Kistenfeger (Anm. 4), S. 100-104, 107, und Braun (Anm. 3), S. 13
35 Vgl. Zimmerling (Anm. 2), S. 140-149
36 Vgl. zur Einkreisung durch die UdSSR Braun (Anm. 3), S. 19f, und zur Angst vor den Supermächten ebd., S. 26, 77. Vgl. zur Bedrohung durch Israel ebd, S. 78, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 122
37 Vgl. zum Revolutionsexport Braun (Anm. 3), S. 20f, 92-94, und zur militärischen Bedrohung druch Iran ebd., S. 75. Vgl. zu Territorialkonflikten mit Iran ,,Besorgnis über niedrige Öleinnahmen", in: FAZ v. 7.12.1998, S. 8, und Kistenfeger (Anm. 4), S. 92, 128- 132, 144. Vgl. für eine Darstellung der Größe der Streitkräfte ebd., S. 123. Vgl. zur Bedrohung durch Irak Braun (Anm. 3), S. 24f, 54, 77
38 Vgl. Zimmerling (Anm. 2), S. 224-233
39 Vgl. Braun (Anm. 3), S. 29, 132
40 Vgl. ebd., S. 24f, 54. Vgl. Hünseler, Peter (Anm. 17), S. 691
41 Vgl. Zimmerling (Anm. 2), S. 154f
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Golfkooperationsrat (GKR)?
Der Golfkooperationsrat (GKR) ist ein regionales Forum, in dem sechs arabische Staaten zusammenarbeiten: Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Wann wurde der GKR gegründet?
Die Gründungs-Charta wurde am 25. Mai 1981 in Abu Dhabi unterzeichnet.
Was waren die Gründe für die Gründung des GKR?
Die Gründung erfolgte als Reaktion auf Bedrohungen wie die islamische Revolution im Iran, die sowjetische Invasion in Afghanistan und den ersten Golfkrieg (Iran gegen Irak). Die Staaten wollten ihre Souveränität wahren und sich gegenseitig durch einen Beistandspakt schützen.
Welche Ziele verfolgt der GKR laut Charta?
Laut Charta ist der GKR ein Wirtschaftsbündnis, aber in Wirklichkeit ein Forum für Sicherheitskooperation. Ziel ist die Einheit der Mitgliedsstaaten durch Koordination, Integration und Verbindungen in Bereichen wie Wirtschaft, Finanzen, Handel, Zölle, Bildung, Kultur, Soziales und Sicherheit.
Wie ist der GKR strukturiert?
Die Struktur umfasst:
- Oberster Rat: Höchstes Gremium mit den Staatsoberhäuptern.
- Ministerrat: Mit den Außenministern, bereitet Gipfeltreffen vor und macht Vorschläge zur GKR-Politik.
- Generalsekretariat: Verwaltungssitz in Riyadh, Saudi-Arabien, erarbeitet Studien und verfolgt die Umsetzung der GKR-Beschlüsse.
- Schlichtungskommission: Soll Konflikte zwischen Mitgliedern lösen, existiert aber nur auf dem Papier.
- Konsultativrat: Besteht aus Bürgern der Mitgliedsstaaten, berät den Obersten Rat.
In welchen Bereichen kooperieren die GKR-Staaten?
Die Kooperation findet in folgenden Bereichen statt:
- Wirtschaft: Begrenzte wirtschaftliche Zusammenarbeit, Vereinfachung von Geschäftsbeziehungen, staatliche Aufträge an GKR-Firmen bevorzugt.
- Außenpolitik: Eher einzelstaatliche Diplomatie als abgestimmte GKR-Außenpolitik.
- Sicherheit: Militärische Zusammenarbeit (gemeinsame Manöver, schnelle Eingreiftruppe), Bekämpfung der Opposition (Kooperation im Bereich der inneren Sicherheit, Überwachung der Opposition).
Welche externen Einflüsse wirken auf die Kooperation?
Die Kooperation wird beeinflusst durch:
- Negative externe zwingende Gründe: Gemeinsame Wahrnehmung von Bedrohungen (Iran, Irak, Israel).
- Erwartete Reaktionen anderer Staaten: Berücksichtigung der Haltung der Arabischen Liga, Irans und Iraks.
- Demonstrationseffekt: Die Vereinigten Arabischen Emirate dienten als Vorbild für Kooperation.
Was sind die Haupthindernisse für eine engere Zusammenarbeit?
Die Haupthindernisse sind:
- Interessensunterschiede der Mitglieder.
- Misstrauen der kleineren GKR-Staaten gegenüber Saudi-Arabien.
- Wirtschaftliche Homogenität (hauptsächlich Ölexport).
- Angst vor dem Verlust wirtschaftlicher und militärischer Souveränität.
Welche Rolle spielt der Westen für die Sicherheit der GKR-Staaten?
Die Sicherheit der GKR-Mitglieder wird heute eher vom Westen (bilaterale Schutzverträge mit Frankreich, Großbritannien und den USA) als von einer gemeinsamen GKR-Armee garantiert.
- Quote paper
- Björn Finke (Author), 1999, Der Golf-Kooperationsrat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101926