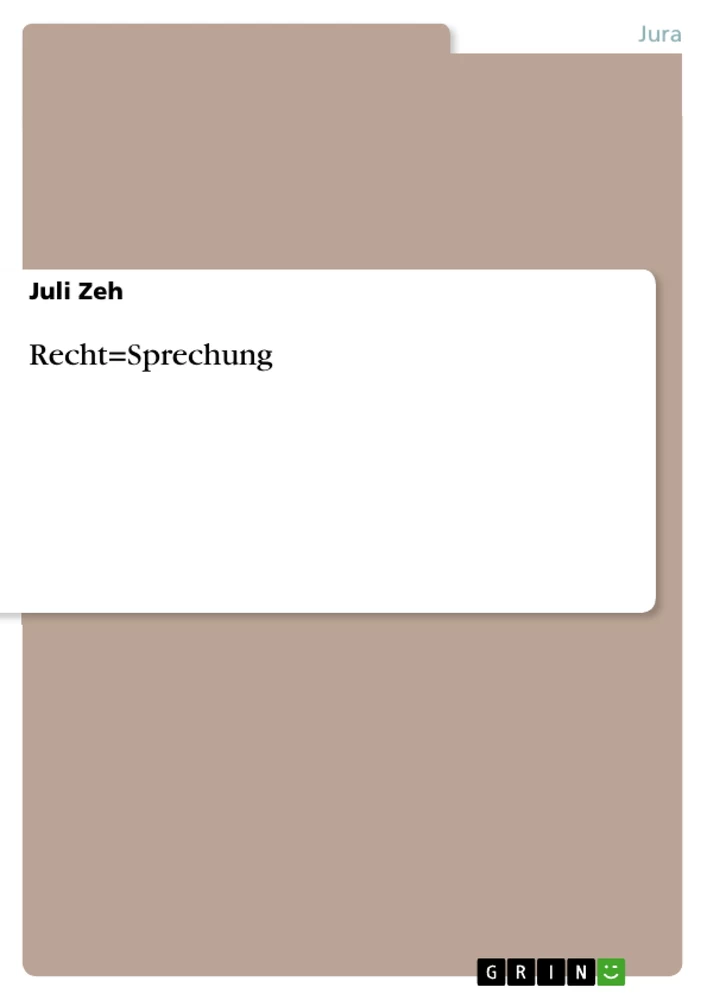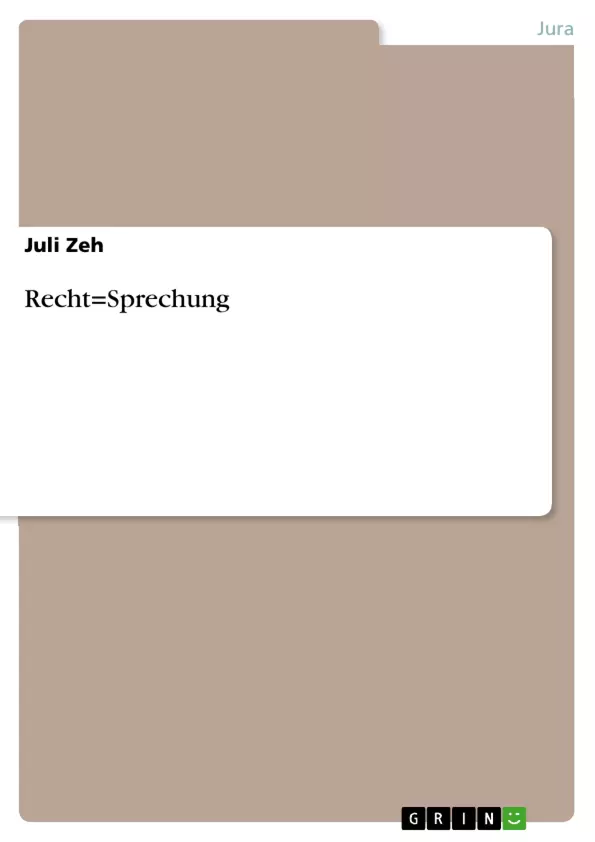Recht=Sprechung
Ein Zirkelschluss in zehn Schritten
Die juristische Sprache ist - komisch. Dem Rechtskundigen etwas Selbstverständliches oder selbstverständlich Gewordenes, Werk- und Spielzeug; dem Nicht-Juristen jedoch Gegenstand für Spott oder verzweifeltes Händeringen, lach- oder brechreizerregend. Aber was ist sie? Und warum?
1. Sprache
Was Sprache ist, weiß jeder. Manche wissen es noch etwas besser als andere, so zum Beispiel Kröner's Lexikon der Sprachwissenschaft: Auf kognitiven Prozessen basierendes, gesellschaftlich bedingtes, historischer Entwicklung unterworfenes Mittel zum Ausdruck beziehungsweise Austausch von Gedanken, et cetera pepe, oder, wenn man einen eher semiotischen Ansatz wählt: Jedes zu Kommunikationszwecken verwendete Zeichensystem. Also auch der aufs Richterpult geklopfte Hammer. Oder ein hochgereckter Finger. Immer gilt: Schön ist's für den, der weiß, was es heißt.
2. Juristen
Was aber nicht für alle immer der Fall ist. Und dafür muss man nicht notwendigerweise ins Ausland fahren. Betrachten wir folgende Szene: An der Kinokasse oder vor dem Deutschen Pavillon auf dem Expo-Gelände stehen Menschen auf nicht artgerecht engem Raum beieinander, darunter zwei Männer in Anzügen und mit rechteckigen schwarzen Koffern, die ihnen den jeweils rechten Arm auf affenartige Länge herunterziehen, sowie eine Mutter mit Kind. Einer der Männer erzählt gerade vom wiederholten tätlichen Angriff des Ex-Freunds seiner Freundin, von einer zerbrochenen Brille und zerrissenem Hemd. Sein Zuhörerlachend: "Der hat wohl noch nie was von >Ne bis in idem< gehört?" Hinter ihm, das Kindneugierig: "Mami, Mami, was ist ein >Ibis im Nebel<?" Die Mutterunterdrückt: "Weiß ich auch nicht."
Das Kind: "Aber Mami, warum redet der Mann so komisch?" Die Mutterpeinlich berührt:
"Schweig still, mein Kind, der ist Jurist."
3. Griechen und Römer
Ein wenig überraschend aus der Sicht unseres gegenwärtigen Rechtsverständnisses scheint es, dass es in der ersten Blütezeit der antiken juristischen Rhetorik wenig um die Sache, gar nicht um die Wahrheit und nur gelegentlich um die Anwendung juristischer Normen ging. Die öffentliche Rede war darauf gerichtet, den Richter, die Zuhörerschaft und am besten noch die Gegenpartei selbst von der Alleingültigkeit des eigenen Standpunkts zu überzeugen, und wem es gelang, einen noch bluttropfenden Schwerverbrecher zum Unschuldsengel zu stilisieren, der konnte sich Meister nennen. Es liegt auf der Hand: Die juristische Rhetorik war Kunst und in diesem Sinne Selbstzweck, und deshalb ist es kein Zufall, dass gerade der berühmte Gerichtsredner Lysias ebenfalls als einer der ersten und wichtigsten attischen Prosaschriftsteller in die Geschichte eingegangen ist.
Wenn aber historisch die Vertreter des Rechts zu den Vätern des öffentlichen, rhetorischen, sogar literarischen Sprechens gehören - warum muss ich mich dann auslachen lassen, wenn ich am Telephon frage, ob die Vorbestellung eines Tischs für 20:00h im vorliegenden Restaurant Aussicht auf Erfolg hat?
4. Der Ibis im Nebel
Materiell gesehen ist es weniger das griechische als das römische Erbe, das vom Zwölftafelgesetz über Prätorenedikte, Corpus Iuris Civilis und Glossatoren letztlich in weiten Teilen Europas rezipiert wurde und unser gegenwärtiges Rechtssystem nach wie vor wesentlich bestimmt. Gehen wir hier einmal davon aus, dass eine der Besonderheiten des juristischen Sprechens, nämlich die beliebte Verwendung lateinischer Ausdrücke und Merksätze, der mehr oder weniger tief empfundenen Verbindung des Rechtswissenschaftlers zu seinen römischen Vorläufern entspringt.
Aber daran ist eigentlich nichts Besonders. Die Priester reden ja auch gern Latein, die Ärzte Griechisch, die Köche Französisch und MTV Englisch, jede berufliche oder soziale Gruppierung hat ihren eigenen Fachjargon, ihre Geheimsprache, ihren Code; auch an Kinokasse und Kneipentisch ist es schön, wenn man selbst dazugehört und die anderen nicht. Der Außenstehende ist eigentlich daran gewöhnt, nichts zu verstehen. Er fühlt sich wie der Ibis im Nebel und ist's, kopfschüttelnd, zufrieden.
5. Bibel und BGB
Sprache, die nicht, wie oben definiert, dem Austausch von Gedanken, sondern eigentlich eher deren Geheimhaltung dient, ist häufig eine Ausdrucksform der Macht. Lange hat es die katholische Kirche vorexerziert, wie Glauben und Gehorsam der Massen sich durch das Vorenthalten von Wissen und Verständnismöglichkeit unterstützen lassen, und es war nicht nur ein reformatorischer Akt, sondern ein wahrhaft revolutionäres Ereignis, als die lutherische Übersetzung der Bibel deren Inhalt begreifbar und damit hinterfragbar machte. Wie die Religion ist auch das Recht (unter anderem) ein gesellschaftliches Ordnungssystem, es beinhaltet damit notwendig machterzeugende und machterhaltende Mechanismen. In sprachlicher Hinsicht hat dies zwei Konsequenzen: Zum einen sind gewisse Hürden, welche die Massen vom Verständnis des heiligen Textes ausschließen, zwar spätestens seit der Aufklärung nicht mehr offiziell beabsichtigt, dennoch dem Wirken und Weiterbestehen des Systems durchaus zuträglich. Zum anderen äußert sich in der Formelhaftigkeit der Rede deren grundsätzlich konservierende Funktion. Ein Normenkomplex ist immer auf Dauer angelegt, er muss sich selbst und die in ihm niedergelegten Werte (auf-) bewahren. Das BGB ist alt, die Bibel noch älter.
Werfen wir aber einen Blick in die deutschen Gesetze, stellen wir schnell fest, dass sie nicht auf Lateinisch verfasst sind, und wir wissen ja auch, dass sie, zugunsten der Rechtssicherheit, nicht nur dauerhaft sein sollen, sondern auch noch klar und eindeutig formuliert. Aber klar und eindeutig für wen? Man drücke dem Ibis im Nebel einen Auszug aus dem Deliktshaftungsrecht in die Hand und frage ihn, an wen, wie und wann er sich wegen seiner zerbrochenen Brille wenden würde. Und man wird sehen: Er hat keinen Durchblick.
6. Gefahr, Genuss und Guter Glaube
Aber woran liegt das? Unsere Gesetze als eine Form, vielleicht sogar als das Substrat juristischen Sprechens, enthalten keine Vokabeln wie Granulomatose oder Gnathoschisis; stattdessen finden wir einfache Wörter wie Gefahr oder Genuss oder Glaube - Wörter, die wir kennen. Kennen wir sie? Ein Blick ins Wörterbuch, Deutsch für Deutsche: Gefahr, das ist drohendes Unheil, eine Bedrohung. Unter Genuss versteht man: Das Schwelgen im Angenehmen. Aber was ist dann, juristisch, eine Gefahrtragungspflicht oder der Genussschein? Guter Glaube ist, wenn man an das Gute glaubt?
7. Juristische Textrezeption
In dieser Kluft zwischen Wortbedeutungen liegt eine wichtige Eigenheit der juristischen Sprache: Sie entnimmt ihre Vokabeln, selbst ihre Fachterminologie häufig dem allgemein verständlichen Sprachgebrauch, unterlegt sie aber mit neuer Bedeutung, kreiert eigene Definitionen und schafft so einen anderen, fachspezifischen semantischen Gehalt. Wörter wie "Gefahr", "Genuss" oder "Glaube" sind gemäß ihrer gesellschaftlichen Kontexte belegt, erregen dazu beim Leser oder Hörer Assoziationen, die seinem individuellen Erfahrungsschatz entsprechen, und werden vor diesen Hintergründen verstanden. Sie rufen bestimmte Gefühle, Vorstellungen, Erinnerungen hervor. Ein Jurist aber lernt ein anderes Verfahren der Textrezeption. Es folgt den Mechanismen der Auslegung. Nach dem Grundsatz, dass eine juristische Regel in einer Vielzahl von Fällen Gültigkeit und eine möglichst einheitliche Bedeutung haben muss, ist es notwendig, ein überindividuelles, man könnte sagen: "mechanisches" Deutungsverfahren zu befolgen. Der Jurist also darf nicht lesen und verstehen wie er will, sondern so, wie er und alle anderen aus seiner Branche es gelernt haben. Er liest anders als der Normalbürger.
Und er spricht auch anders.
8. Zum Beispiel so
Nach einer Gesamtbetrachtung der Umstände und Abwägung der widerstreitenden Interessen unter Einbeziehung des allgemeinen Verkehrsinteresses bleibt zu sagen, dass für den Juristen nicht nur die Anerkennung der Bedeutung der Zollung von Respekt gegenüber dem Lateinischen kein Problem ist, sondern dass diese Spezies, zum Beispiel, auch zu Substantivierungen neigt. Und man sich wohl wahrscheinlich auch eher nicht so gern festlegt. Wovon dann der Mandant verwirrt wird, der davon ausging, wenigstens sein teuer bezahlter Rechtsbeistand müsse sich eigentlich sicher sein.
Weiterhin ist davon auszugehen, dass eine gewisse Korrektheit im sprachlichen Ausdruck sowie die generelle Vermeidung umgangssprachlicher und idiomatischer Wendungen einer präzisen und objektiven Darstellung des vorzutragenden Inhalts immer angemessen ist, weshalb ich auch völlig von den Socken war, als ich in einer Klageerwiderung vom Anwalt der Gegenpartei erfuhr, mein Vorbringen "schlüge dem Fass ja wirklich die Krone ins Gesicht". Den Prozess gewann ich vor Schreck.
Letztlich bleibt festzustellen, dass auch die Syntax des Juristen formelhaften Regeln folgt: Der begutachtende Rechtskundige sagt nicht: "Wir reden komisch, weil wir Juristen sind", sondern legt erst die Fakten dar und zieht dann die Schlussfolgerung: "Wir sind Juristen. Deshalb reden wir komisch". Der richtende hingegen: "Wir reden komisch. Aus folgenden Gründen: ..."
9. Entindividualisierung der Rede
Wenn das Verstehen und Ausdeuten von Sprache im Normalfall ein stark individuelles Gepräge aufweist, so gilt das erst recht für den Akt des Sprechens: Sage mir, wie du sprichst, und ich sage dir, wer du bist. Nicht nur Kleider machen Leute. Im Herrschaftsbereich der blinden Justitia aber darf es eben gerade keine Rolle spielen, "wer" jemand ist, und da man ihr zusätzlich zu den Augen schlecht auch noch den Mund verbinden kann, muss auf andere Art deutlich gemacht werden, dass der Rechtsentscheid im demokratischen Rechtsstaat nicht der Weisheit eines salomonischen Urteilers, sondern der objektiven Anwendung generell- abstrakter Rechtssätze entspringt. Der Verurteilte im Strafprozess oder der enttäuschte Antragsteller vor dem Zivilrichter würde die Entscheidung von Herrn X, wohnhaft in Y und Z Jahre alt, auch gar nicht akzeptieren wollen. Er akzeptiert die Gültigkeit von etwas Absolutem, dem Recht an sich, und maximal dessen Handhabung durch einen von Justitias Verrichtungsgehilfen. Deshalb versteckt der Sprecher des Rechts seine Individualität nicht nur unter der vereinheitlichenden Robe, sondern auch unter vereinheitlichten Formulierungen. Zwar stellt niemand fest, aber trotzdem wird festgestellt, und auch wenn keiner davon ausgeht, ist trotzdem davon auszugehen - nämlich davon, dass der Jurist nicht "Ich" sagt. Ganz anders als die Kunstredner im alten Griechenland geben wir vor, unsere Sprache einem überindividuellen, abstrakten und absoluten Komplex zu entleihen, deshalb ist sie unnatürlich, künstlich im formelhaften Sinn. Wir sprechen mit entfremdeter Zunge. Und das, manchmal, eben auch an der Kinokasse.
10. Übersetzer gesucht
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Recht=Sprechung: Ein Zirkelschluss in zehn Schritten"?
Der Text untersucht die Eigenart der juristischen Sprache, die für Rechtskundige selbstverständlich ist, für Nicht-Juristen aber oft unverständlich und sogar lächerlich erscheint. Er fragt, was juristische Sprache ausmacht und warum sie so ist.
Was sind die Hauptpunkte des Textes?
Der Text beleuchtet die juristische Sprache aus verschiedenen Blickwinkeln, darunter ihre historische Entwicklung (Griechen und Römer), die Verwendung lateinischer Ausdrücke, ihre Funktion als Ausdruck von Macht, die Kluft zwischen juristischer und allgemeiner Sprachbedeutung, die Entindividualisierung der Rede und die Rolle der Juristen als Übersetzer.
Warum verwenden Juristen lateinische Ausdrücke?
Die Verwendung lateinischer Ausdrücke wird auf die historische Verbindung des Rechtswissenschaftlers zu seinen römischen Vorläufern zurückgeführt. Es wird aber auch argumentiert, dass jede berufliche oder soziale Gruppierung ihren eigenen Fachjargon hat.
Inwiefern dient die juristische Sprache der Macht?
Die juristische Sprache wird als Ausdrucksform der Macht betrachtet, da sie durch Komplexität und Unverständlichkeit Wissen vorbehält und somit gesellschaftliche Ordnungssysteme stützt. Ähnlich wie die katholische Kirche früher Glauben und Gehorsam durch das Vorenthalten von Wissen förderte.
Warum ist die juristische Sprache oft formelhaft?
Die Formelhaftigkeit der juristischen Sprache wird auf ihre konservierende Funktion zurückgeführt. Normen sollen dauerhaft sein und die in ihnen niedergelegten Werte bewahren. Die Gesetze sollen nicht nur dauerhaft, sondern auch klar und eindeutig sein, jedoch oft nur für Juristen.
Wie unterscheidet sich die juristische Textrezeption von der allgemeinen Textrezeption?
Juristen lernen ein "mechanisches" Deutungsverfahren, das überindividuell ist und darauf abzielt, eine einheitliche Bedeutung von juristischen Regeln in einer Vielzahl von Fällen zu gewährleisten. Sie lesen anders als der Normalbürger, indem sie gesellschaftliche Kontexte und individuelle Erfahrungen ausklammern.
Warum neigen Juristen zu Substantivierungen und vermeiden Festlegungen?
Juristen neigen zu Substantivierungen und vermeiden Festlegungen, um präzise und objektiv zu sein. Sie wollen nicht "Ich" sagen, sondern die Sprache einem überindividuellen, abstrakten Komplex entleihen. Dies führt zu einer Entindividualisierung der Rede.
Was ist die Rolle des Juristen als Übersetzer?
In einer Kultur, die von der Akzeptanz von Autoritäten und verabsolutierten Textstücken geprägt ist, treten Juristen als Vermittler oder Übersetzer auf. Sie entnehmen ihre Sprache nicht ihrem persönlichen Erfahrungsschatz, sondern dem allgemeingültigen, objektiven Diskursystem.
Warum ist die juristische Sprache für Nicht-Juristen oft unverständlich?
Die juristische Sprache dient der Autorität des Rechts, wodurch das Verständnis des Nicht-Juristen oft eingeschränkt wird. Sie verkörpern und erhalten dessen Autorität und reduzieren die Möglichkeit von Willkür und Missbrauch.
- Quote paper
- Juli Zeh (Author), 2000, Recht=Sprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101942