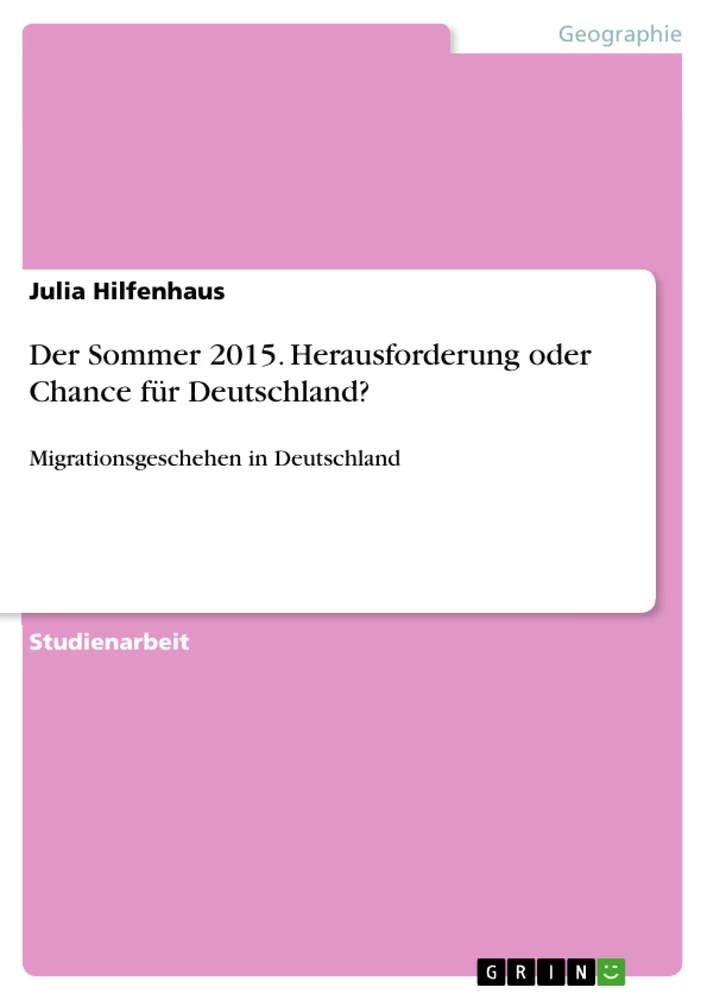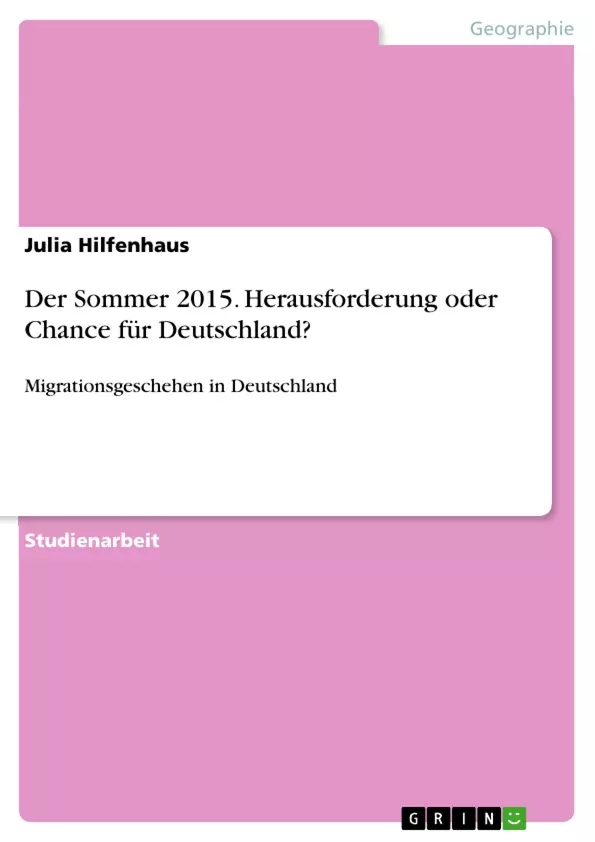Migration kann viele verschiedene Ursachen haben und in verschiedenste Kategorien eingeordnet werden. In Deutschland ist vor allem der "Sommer 2015" bekannt. Im Folgenden wird der Fragestellung nachgegangen, ob die Migration, speziell der Sommer 2015, eine Herausforderung oder eine Chance für Deutschland darstellt. Dieser wird, als Hochpunkt einer Flüchtlingswelle bezeichnet. Betrachtet wird im Folgenden nur die Zuwanderung der Drittstaatenangehörigen nach Deutschland. Um sich diesem Thema auf sachlicher Ebene nähern zu können, werden zuerst grundlegende Zahlen vorgestellt, dann die Herausforderungen und die Chancen erarbeitet, um abschließend ein möglichst umfassendes Fazit ziehen zu können.
Das einwanderungsstarke Jahr 2015 hat viele Veränderungen in Deutschland mit sich gebracht und das politische, kulturelle und soziale Umdenken aller gefördert und gefordert. Als Folgen des Einwanderungsereignisses kollabierte das europäische Grenzregime und Migrationspolitik wird Gegenstand nationaler Wahlkämpfe und Parlamentswahlen, Migration wird zu einer gesellschaftspolitisch stark umkämpften Frage. Hierbei stärken sich extreme Gruppierung, die zur Ausländerfeindlichkeit aufrufen und für schnelle Abschiebung aller Flüchtlinge plädieren. Als zentrale Bedingung für Integration wird die Offenheit gegenüber den Migranten und ihren Bedürfnissen gesehen. Mit der entsprechenden Denk- und Handlungsweise entstehen durch die Migranten aber nicht nur die finanzielle Belastung des Staates und die Unsicherheit vieler gegenüber der Migranten benachteiligt zu werden, sondern auch Chancen auf das gemeinsame Nebeneinanderleben, Lückenschließung im Arbeitsmarkt, Entgegenwirken der Überalterung in Deutschland und sowohl kulturellen, als auch sozialen Austausch.
Unterstützend werden hierzu die Theorien sozialer Ungleichheiten von Tajfel, Henri und Tunrer, John und ein Diveritäts-Management-Modell erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Sommer 2015
- Herausforderungen für Deutschland
- Diversitätspolitiken und räumliche Dimension
- „Theorie sozialer Identitäten“ und rechtsextremistische Gruppierungen
- Chancen für Deutschland
- Demographischer Wandel
- Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Vorteile für deutsche Unternehmen
- Evaluation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Migration – insbesondere der „Sommer 2015“ – eine Herausforderung oder eine Chance für Deutschland darstellt. Ziel ist es, die Auswirkungen der Migration auf Deutschland zu analysieren und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen zu beleuchten. Dabei werden empirische Daten und Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und des Statistischen Bundesamtes herangezogen, um die Fragestellung zu beantworten.
- Auswirkungen der Migration auf Deutschland
- Herausforderungen der Integration
- Chancen der Migration für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft
- Demographischer Wandel und seine Folgen
- Soziale und räumliche Mobilität von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Migration im Allgemeinen und den „Sommer 2015“ als Hochpunkt einer Flüchtlingswelle. Es werden verschiedene Motive für Migration und Flucht beschrieben, darunter humanitäre, politische und wirtschaftliche Gründe. Außerdem wird der demografische Wandel und seine Bedeutung für die Migration in Deutschland beleuchtet.
Kapitel 2 befasst sich mit den Herausforderungen der Migration für Deutschland. Dabei werden insbesondere die Diversität der Migranten und die damit verbundenen Integrationsprobleme im Fokus stehen. Die „Theorie sozialer Identitäten“ und die Rolle rechtsextremistischer Gruppierungen werden in diesem Kontext diskutiert.
Im dritten Kapitel werden die Chancen der Migration für Deutschland erörtert. Insbesondere der demografische Wandel und die damit verbundenen Folgen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft werden beleuchtet. Es wird dargestellt, wie Migration den Arbeitsmarkt dynamisieren und das Wirtschaftswachstum fördern kann.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Migration und deren Auswirkungen auf Deutschland. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Chancen der Integration, der demografische Wandel, die „Theorie sozialer Identitäten“, rechtsextremistische Gruppierungen, Diversitätspolitiken, räumliche und soziale Mobilität von Migranten sowie empirische Daten und Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und des Statistischen Bundesamtes.
- Quote paper
- Julia Hilfenhaus (Author), 2020, Der Sommer 2015. Herausforderung oder Chance für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020310