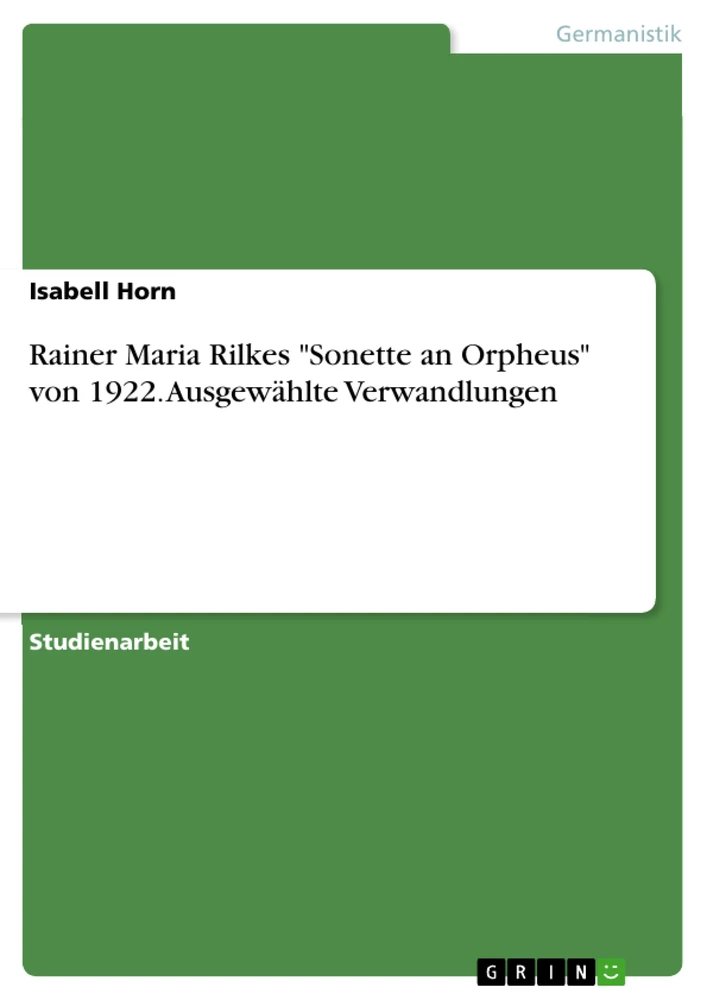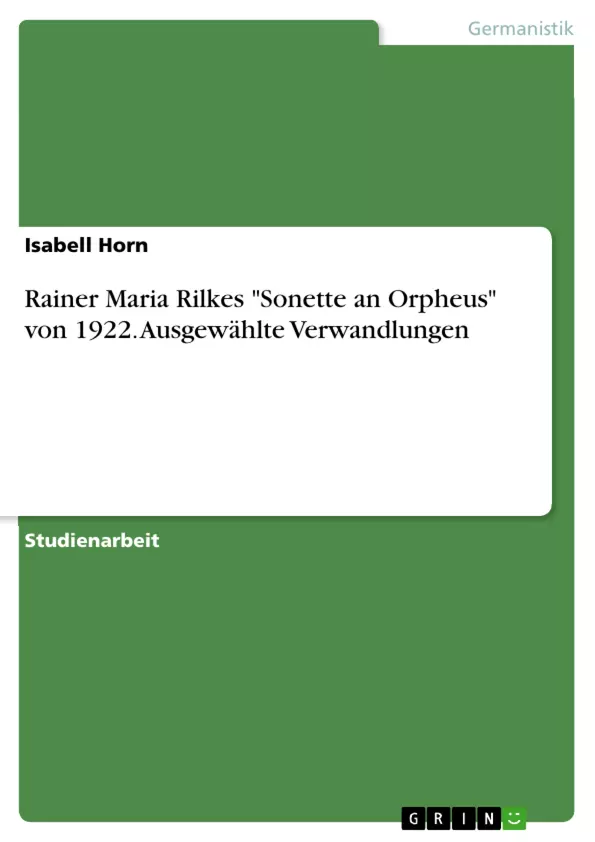In dieser Arbeit soll nach einer eingehenden Betrachtung der Forschungsergebnisse von Judith Ryan, Britta Maché und Manfred Engel primär der Frage nachgegangen werden, wie die Verwandlungen in "Sonette an Orpheus" funktionieren und an welchen Stellen sie in den Gedichten stattfinden. Unter dieser Frage sollen verschiedene Aspekte oder auch Arten der Verwandlungen betrachtet werden. Als Erstes wird die Verwandlung durch Dichtung beziehungsweise Sprache näher beleuchtet. Weiterhin soll ein Augenmerk auf Verwandlungen in der Natur, insbesondere die der Rose, gelegt werden. Die letzten zu betrachtenden Verwandlungen sind jene, die Orpheus und auch seine Umwelt aufgrund seines Todes erfahren.
Außerdem muss festgehalten werden, dass der Umfang der Arbeit eine Betrachtung aller Sonette nicht zulässt, weshalb lediglich anhand ausgewählter Beispiele aufgezeigt werden soll, wie Verwandlung unter den oben erläuterten Gesichtspunkten funktioniert. Zunächst werden noch einige einleitende Bemerkungen zur Entstehung und dem Umfang der Sonette an Orpheus geäußert, die zwar nicht für den weiteren Verlauf der Arbeit notwendig, jedoch hilfreich für das bessere Verständnis des Gesamtgefüges sind.
Der Mythos der Orpheus-Figur, wie er in den Metamorphosen von Ovid vorgestellt worden ist, wurde bis heute vielfach in den bildenden Künsten, in der Musik, aber selbstverständlich auch in der Literatur rezipiert. Er handelt von Orpheus, dem begnadeten Sänger und Leierspieler, der seine Frau Eurydike aus den Fängen der Unterwelt befreien möchte und daran letztendlich scheiterte. Auf diese Weise entwickelte er sich zum Sinnbild eines christlichen Heilands, zu einer Sagengestalt, um die sich zahlreiche Mythen ranken, und zum mustergültigen Inbegriff des Gesangs und auch der Dichtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sonette an Orpheus
- Forschungsstand zu Verwandlungen bei Rilke
- Ausgewählte Verwandlungen in den Sonetten an Orpheus
- Verwandlung durch Gesang/Dichtung bzw. Sprache
- Verwandlung von Blumen
- Verwandlung durch Tod
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Verwandlungen in Rilkes „Sonetten an Orpheus“ und untersucht, wie diese im Kontext der Gedichte funktionieren. Dabei wird der Fokus auf verschiedene Aspekte der Verwandlung gelegt, wie die durch Gesang/Dichtung, die Verwandlung von Blumen und die durch den Tod. Ziel ist es, anhand ausgewählter Beispiele die Mechanismen der Verwandlung in den Sonetten zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Sprache und des Gesangs als transformative Kräfte in den Sonetten
- Die Darstellung der Verwandlung in der Natur, insbesondere am Beispiel der Rose
- Die Rolle des Todes als Katalysator für Verwandlungen im Gedichtzyklus
- Die Verbindung von Verwandlungen mit Transzendenz und dem Überschreiten von zeitlichen und räumlichen Dimensionen
- Die Bedeutung von Orpheus als exemplarische Figur für den Dichter und die transformative Kraft des Singens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Orpheus-Mythos in der Literatur. Es werden die wichtigsten Charakteristika der Figur des Orpheus und dessen Bedeutung für Rilkes „Sonette an Orpheus“ hervorgehoben.
Das Kapitel „Sonette an Orpheus“ beleuchtet die Entstehung des Gedichtzyklus und seine Besonderheiten. Es werden die Entstehungsumstände sowie die Besonderheiten der Struktur des Gedichtzyklus beleuchtet.
Das Kapitel „Forschungsstand zu Verwandlungen bei Rilke“ präsentiert wichtige Forschungsansätze zu den Motiven des Umschlags und der Verwandlung in Rilkes Lyrik. Es werden die Beiträge von Judith Ryan, Britta Maché und Manfred Engel aufgezeigt, die als Grundlage für die eigene Analyse dienen.
Die Arbeit widmet sich im Anschluss ausgewählten Beispielen der Verwandlung in den „Sonetten an Orpheus“, wobei die Verwandlung durch Gesang/Dichtung, die Verwandlung von Blumen und die Verwandlung durch Tod im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Verwandlung, Orpheus-Mythos, Sonette, Dichtung, Gesang, Sprache, Tod, Transzendenz, Natur, Rose, Spiritualität, Rilke, „Sonette an Orpheus“, Judith Ryan, Britta Maché, Manfred Engel.
Häufig gestellte Fragen zu Rilkes Sonetten
Welche Bedeutung hat der Orpheus-Mythos für Rilke?
Orpheus dient als Sinnbild für den vollkommenen Dichter und Sänger, der durch seine Kunst die Grenzen zwischen Leben und Tod sowie Mensch und Natur überschreitet.
Wie wird "Verwandlung" in den Sonetten dargestellt?
Verwandlung geschieht bei Rilke durch die Sprache, den Gesang, den Zyklus der Natur (z. B. die Rose) und letztlich durch den Tod, der als Teil eines größeren Ganzen begriffen wird.
Warum spielt die Rose eine so zentrale Rolle?
Die Rose symbolisiert bei Rilke die Schönheit der Vergänglichkeit und die Fähigkeit der Natur, sich ständig neu zu erschaffen und zu verwandeln.
Was ist das Besondere an der Entstehung der Sonette?
Die "Sonette an Orpheus" entstanden 1922 in einem regelrechten Schaffensrausch innerhalb weniger Tage als Grab-Mal für eine verstorbene Freundin seiner Tochter.
Was versteht Rilke unter "Umschlag"?
Der Umschlag bezeichnet den Moment der Transformation, in dem Leid in Kunst oder Vergänglichkeit in zeitlose Existenz übergeht.
- Quote paper
- Isabell Horn (Author), 2021, Rainer Maria Rilkes "Sonette an Orpheus" von 1922. Ausgewählte Verwandlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020345