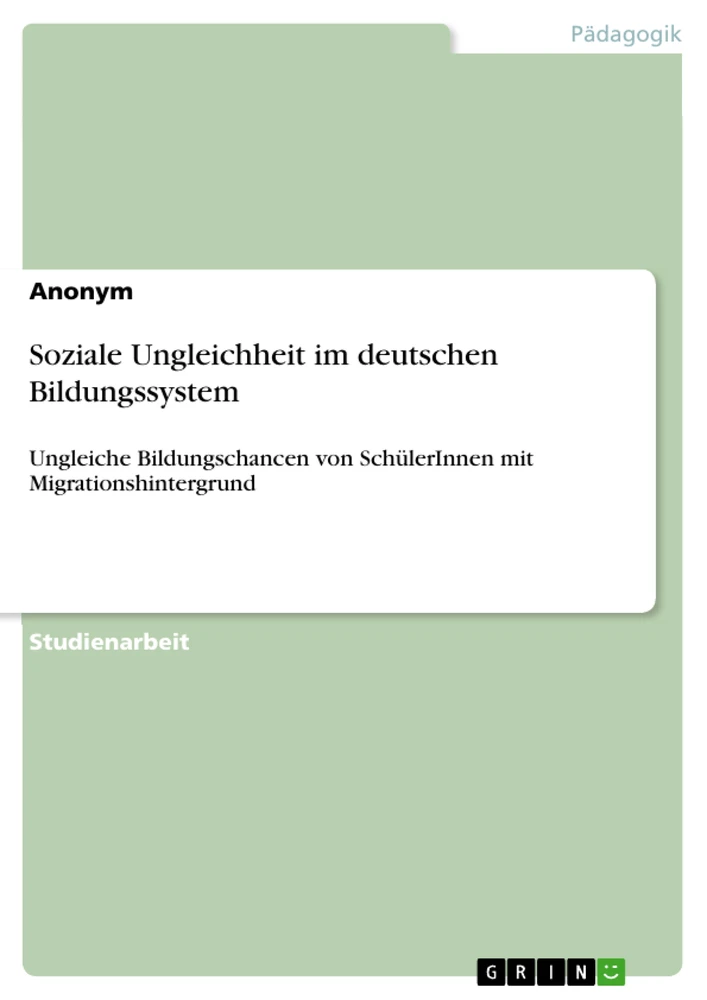Welche Ursachen genau eine Rolle bei den ungleichen Bildungschancen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund spielen, soll in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von Literatur zu Migrantenkindern im deutschen Schulsystem untersucht werden. Der Arbeit liegt der theoretische Ansatz zugrunde, dass Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem nicht dieselben Chancen für einen erfolgreichen Bildungsweg haben, wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Ausgehend von dieser These soll überprüft werden, ob sich diese Annahme bewahrheitet oder ob jedem die gleichen Möglichkeiten im Bildungssystem gegeben sind, und wie sich diese auf den Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I auswirkt. Deutschland beschäftigt sich mit der Untersuchung der Ursachen für die Ungleichheit im Bildungserwerb erst seit etwa 20 Jahren und steht mit der Forschung noch ganz am Anfang, es ist jedoch unbestritten, dass Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem deutlich benachteiligt sind.
Eines der höchsten Bestreben einer verantwortungsbewussten, modernen und gerechten Gesellschaft sollte die Weitergabe von Bildung sein. Dabei ist es besonders wichtig, dass den Menschen in der Gesellschaft die Bildung und die damit verbundenen Chancen unabhängig von Aussehen, sozialem Status und Geschlecht ermöglicht werden. Eine gerechte Chancengleichheit herzustellen und diese aufrechtzuerhalten sollte im Fokus eines jeden Systems stehen. Schaut man sich jedoch die Berichte der PISA-Studie an, ist vor allem die Bildungsungleichheit zwischen deutschen SchülerInnen und SchülerInnen mit Migrationshintergrund nirgendwo größer als in der Bundesrepublik Deutschland. Somit bleiben Kinder aus Migrantenfamilien in vielen Bereichen weit hinter ihren deutschen MitschülerInnen. Dabei geht es um einen erheblichen Einfluss auf den Kompetenzerwerb und auf die Bildungsentscheidungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff „Migration“ und das Migrationskonzept in Deutschland
- 3. Soziale Herkunft - Zwei Ebenen Modell
- 4. Verteilung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund auf die einzelnen Schularten
- 5. Ursachen der ungleichen Bildungschancen:
- 5.1. Makroebene - Die Ebene des Schulsystems
- 5.2. Mesoebene - Die Bedeutung der Einzelschulen
- 5.3. Mikroebene - Die Bedeutung der individuellen Ebene
- 6. Prävention – Überlegungen zur Minimierung der Benachteiligung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Hinblick auf die Bildungschancen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die Ursachen für diese Ungleichheit zu untersuchen und Lösungsansätze zur Minimierung der Benachteiligung zu erarbeiten.
- Der Begriff „Migration“ und das Migrationskonzept in Deutschland
- Die Rolle der sozialen Herkunft und ihre Auswirkungen auf Bildungschancen
- Die Verteilung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund auf verschiedene Schulformen
- Die verschiedenen Ebenen, auf denen ungleiche Bildungschancen entstehen
- Mögliche Präventionsmaßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen für SchülerInnen mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Bildungsungleichheit zwischen deutschen SchülerInnen und SchülerInnen mit Migrationshintergrund vor und zeigt die Relevanz der Untersuchung auf.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff „Migration“ und beleuchtet das Migrationskonzept in Deutschland, wobei verschiedene Migrationsgruppen und ihre statistische Erfassung im Fokus stehen.
In Kapitel 3 wird das „Zwei Ebenen Modell“ der sozialen Herkunft vorgestellt, das sowohl Schicht- und Klassentheorien als auch Milieutheorien integriert, um herkunftsspezifische Zusammenhänge im Bildungssystem zu erklären.
Kapitel 4 analysiert die Verteilung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund auf die verschiedenen Schulformen, um die bestehenden Ungleichheiten aufzuzeigen.
Kapitel 5 untersucht die Ursachen für die ungleichen Bildungschancen auf drei Ebenen: Makroebene (Schulsystem), Mesoebene (Einzelschulen) und Mikroebene (Individuelle Ebene).
Kapitel 6 befasst sich mit Präventionsmaßnahmen, um die Benachteiligung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund zu minimieren und ihre Bildungschancen zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Bildungschancen, Migrationshintergrund, Schulform, Prävention, Benachteiligung, Kompetenzentwicklung, Bildungsentscheidungen, familien- und kulturinterne Faktoren, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Schüler mit Migrationshintergrund oft geringere Bildungschancen?
Die Arbeit untersucht Ursachen auf Makro-, Meso- und Mikroebene, darunter sprachliche Barrieren, der soziale Status der Familie und institutionelle Hürden im Schulsystem.
Was zeigt die PISA-Studie bezüglich Deutschland?
PISA-Berichte belegen, dass die Bildungsungleichheit zwischen einheimischen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland besonders groß ist.
Welchen Einfluss hat der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe?
Dieser Übergang gilt als kritische Phase, in der Kinder mit Migrationshintergrund trotz vergleichbarer Leistungen oft seltener für das Gymnasium empfohlen werden.
Was ist das "Zwei-Ebenen-Modell" der sozialen Herkunft?
Es kombiniert Schicht- und Klassentheorien mit Milieutheorien, um zu erklären, wie das familiäre Umfeld den Bildungserfolg prägt.
Welche Präventionsmaßnahmen werden vorgeschlagen?
Diskutiert werden unter anderem eine bessere Sprachförderung, eine längere gemeinsame Schulzeit und eine stärkere Unterstützung von Einzelschulen in sozialen Brennpunkten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020377