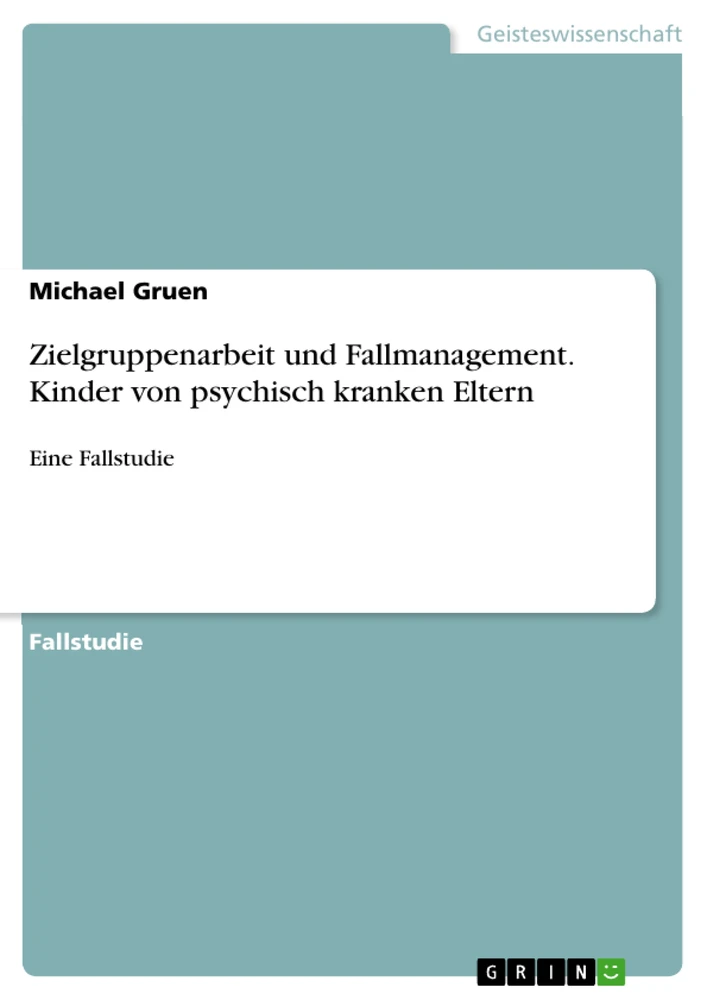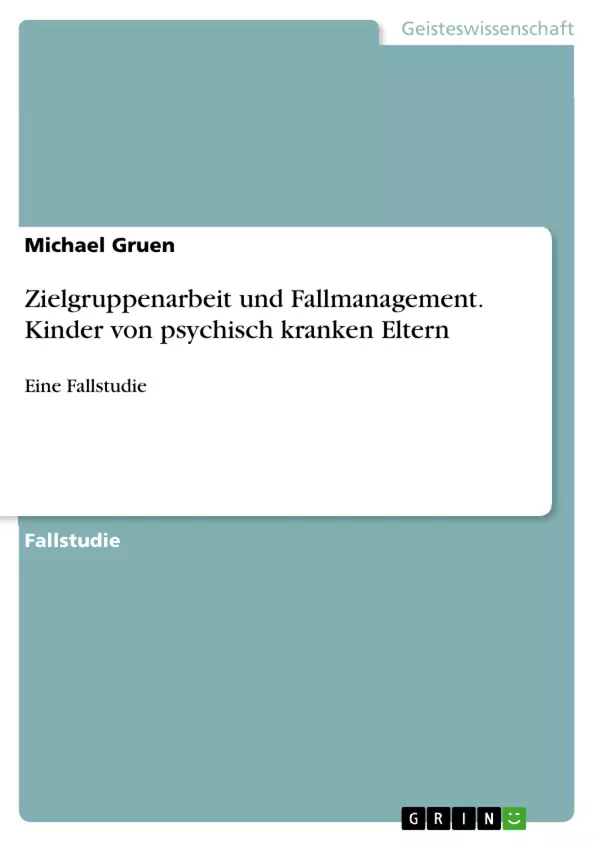In dieser Arbeit wird ein fiktiver Fall beschrieben mit der Frage, welche psychosozialen Auswirkungen beziehungsweise Belastungen eine psychische Erkrankung der Eltern bei Kindern hat und welche Interventionen, mithilfe des Case Managements, sich daraus ergeben.
Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen stammen häufig aus Familien, in denen ein Elternteil selbst eine schwerwiegende psychische Erkrankung oder psychische Probleme hat. Nach Remschmidt und Mattejat sind die psychischen Störungen und Pathologien der Eltern ein zentrales Thema bei psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen. Kinder psychisch kranker Eltern erleben die Krankheit der Eltern als einen hohen Belastungsfaktor, welcher den gewohnten Alltag im kindlichen Leben verändert.
Zu den Symptomen zählen nach Mattejat unter anderem die Parentifizierung. Die Kinder fühlen sich für die Eltern und für die Familie verantwortlich. Sie übernehmen die Erwachsenenrolle und somit elterliche Funktionen für ihre Geschwister. Diese elterlichen Funktionen dienen auch der Stabilisation des erkrankten Familiensystems, was zu einer Überforderung führt. Zudem kann es durch die psychische Belastung der Eltern zu einer Desorientierung, zu Schuldgefühlen, sowie Tabuisierung und Betreuungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Fall- und Aufgabenstellung
- Problemanalyse und Erfassung
- Auswirkung auf die Lebenssituation der Kinder
- Zusammenfassung der Problemanalyse
- Phasen des Case Management
- Maßnahmen und Methoden zur Zielerreichung
- Erstellte Ziele
- Zielgruppenangebote und Maßnahmen
- Linking - Umsetzung der vereinbarten Ziele
- Monitoring - Steuerung der Leistungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie befasst sich mit der Analyse der psychosozialen Auswirkungen und Belastungen, die eine psychische Erkrankung der Eltern bei Kindern mit sich bringt. Sie untersucht anhand eines fiktiven Falls, wie Case Management eingesetzt werden kann, um Interventionen zu entwickeln und die Situation der Kinder zu verbessern.
- Die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf Kinder
- Die Rolle von Case Management bei der Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern
- Die Identifizierung und Umsetzung von Interventionen zur Verbesserung der Lebenssituation der Kinder
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren im Sozialwesen
- Die Herausforderungen und Chancen der Arbeit mit Familien in Belastungssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den fiktiven Fall einer Familie mit zwei Kindern vor, in dem die Mutter an Depressionen und der Vater an einer Spielsuchtproblematik leidet. Die Auswirkungen dieser Erkrankungen auf die Lebenssituation der Kinder werden beleuchtet.
Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen der psychischen Erkrankungen der Eltern auf die Kinder und beschreibt die Belastungen, denen sie ausgesetzt sind. Es werden verschiedene Problemfelder, wie z.B. Parentifizierung, Desorientierung und Schuldgefühle, aufgezeigt.
Kapitel 3 fasst die Ergebnisse der Problemanalyse zusammen und stellt die Herausforderungen für die Interventionen mit Hilfe des Case Management heraus.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Phasen des Case Management und beschreibt die Maßnahmen und Methoden zur Zielerreichung. Es werden spezifische Ziele für die Interventionen formuliert.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankungen der Eltern, Kinder von psychisch kranken Eltern, Case Management, Interventionen, Belastungen, Parentifizierung, Desorientierung, Schuldgefühle, Sucht, Spielsucht, Depressionen, Familienhilfe, Sozialarbeit, Interventionen, Unterstützung, Zusammenarbeit, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Belastungen erleben Kinder psychisch kranker Eltern?
Kinder leiden oft unter Desorientierung, Schuldgefühlen, Tabuisierung der Krankheit und einem Mangel an altersgerechter Betreuung.
Was versteht man unter „Parentifizierung“?
Parentifizierung bedeutet, dass Kinder die Erwachsenenrolle übernehmen und Verantwortung für ihre Eltern oder Geschwister tragen, was zu massiver Überforderung führt.
Wie hilft Case Management in solchen Fällen?
Case Management koordiniert verschiedene Hilfsangebote, erstellt individuelle Hilfepläne und steuert die Leistungen (Monitoring), um die Familie zu stabilisieren.
Welche Rolle spielt die „Spielsucht“ in diesem Fallbeispiel?
Im fiktiven Fall wird neben der Depression der Mutter die Spielsucht des Vaters als zusätzlicher Belastungsfaktor für das Familiensystem analysiert.
Was ist das Ziel der Interventionen für die Kinder?
Ziel ist es, die Kinder zu entlasten, ihnen ihre Kindrolle zurückzugeben und ihre psychosoziale Entwicklung trotz der elterlichen Erkrankung zu sichern.
- Quote paper
- Michael Gruen (Author), 2019, Zielgruppenarbeit und Fallmanagement. Kinder von psychisch kranken Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021088