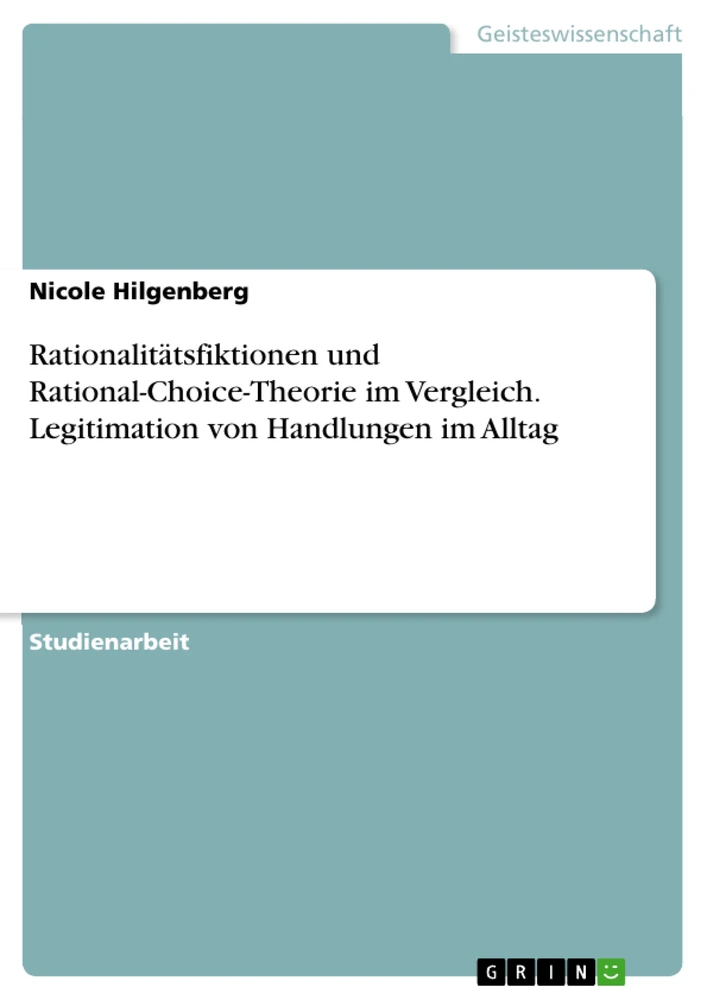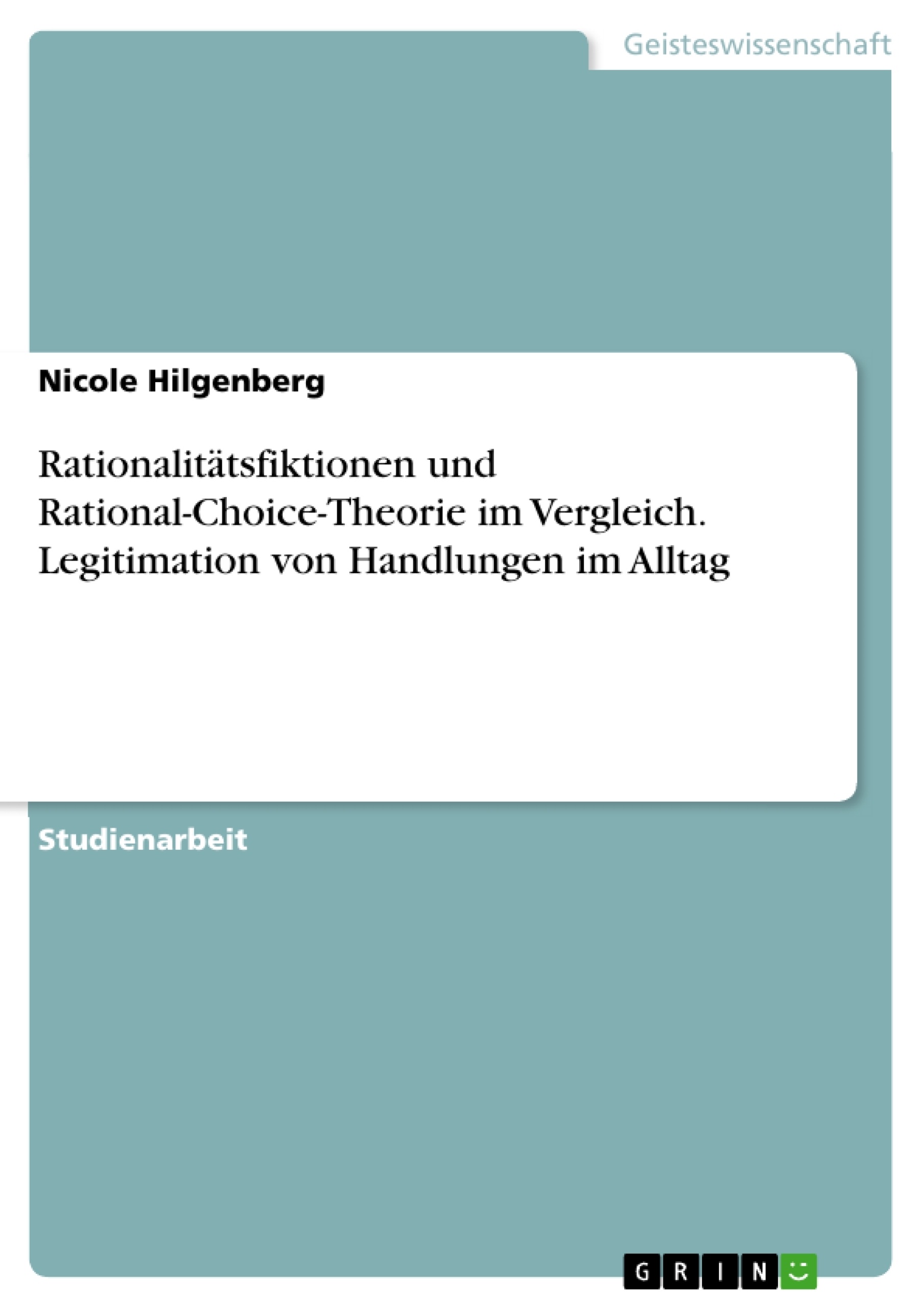Die vorliegende Arbeit behandelt die Rationalitätsfiktionen nach Uwe Schimank, welcher einen Ansatz dafür liefert, wie Menschen rationale Entscheidungen treffen, ohne sie jedes Mal kritisch hinterfragen zu müssen, und den Rational-Choice-Ansatz. Zunächst wird definiert, welche Gesellschaftsform die Grundlage für die Theorien bildet, bevor es zu den Definitionen beider Theorien kommt. Im letzten Schritt soll es um einen Vergleich von Rationalitätsfiktionen und der Rational-Choice-Theorie gehen.
Im Alltag müssen viele Entscheidungen getroffen werden - und das von jedem einzelnen Individuum. Dabei scheinen viele Entscheidungen zunächst unbedeutend zu sein, wie beispielsweise die Entscheidung, ob man zu Fuß geht oder das Fahrrad nutzt, um an sein Ziel zu kommen oder ob man selbst kocht oder Essen bestellt.
Andere Entscheidungen hingegen beeinflussen bemerkbar das ganze Leben, weswegen solche Entscheidungen häufig schwieriger zu fällen sind. Zum Beispiel sind die Partnerwahl und die Frage, wo man denn gerne leben möchte, große Faktoren, die unser Leben nachhaltig beeinflussen, wobei einem bewusst sein sollte, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man darüber selbst entscheiden darf.
In altmodischen Gesellschaften war vieles schon gegeben: als Mann übte man häufig den Beruf des Vaters aus, während man als Frau zu Hause blieb und sich um die Kinder kümmerte. Heute liegt es in einer modernen Gesellschaft in der eigenen Hand des Menschen, was er studiert und welchen Beruf er ausübt, ob er wirklich in einer monogamen Beziehung mit dem gegensätzlichen Geschlecht leben und Kinder zur Welt bringen möchte.
Die Möglichkeit selbstständig Entscheidungen zu fällen gibt dem Individuum natürlich die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie es das gerne machen möchte, was gesellschaftlich insgesamt als positiv bewertet wird. Da aber viele Handlungen, vor allem auch viele alltägliche Handlungen mit Entscheidungen zusammenhängen, haben sich in der Gesellschaft Muster herausgebildet, die erklären, wie ein Mensch seine Entscheidungen trifft, die in der Gesellschaft als rational gelten und somit gesellschaftlich auch legitimiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition einer Entscheidungsgesellschaft
- 3. Rationalitätsfiktionen
- 4. Rational-Choice-Theorie
- 5. Vergleich von Rationalitätsfiktionen und Rational-Choice-Theorie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimation von Handlungen im Alltag, indem sie zwei zentrale Ansätze – Rationalitätsfiktionen und die Rational-Choice-Theorie – gegenüberstellt. Sie beleuchtet, wie Individuen in einer Entscheidungsgesellschaft rationale Entscheidungen treffen, welche Herausforderungen sich dabei stellen und welche Theorien versuchen, diese Prozesse zu erklären.
- Die Definition und Charakteristika einer Entscheidungsgesellschaft
- Die Rolle von Rationalitätsfiktionen in der Legitimation alltäglicher Handlungen
- Die zentralen Prinzipien der Rational-Choice-Theorie und ihre Anwendung auf Entscheidungsfindungen
- Ein Vergleich der beiden Ansätze und deren jeweiligen Stärken und Schwächen
- Die gesellschaftlichen Implikationen und Herausforderungen, die mit der Legitimation von Handlungen im Alltag verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung führt in die Thematik der Legitimation von Handlungen im Alltag ein und stellt die beiden zentralen Ansätze – Rationalitätsfiktionen und die Rational-Choice-Theorie – vor. Sie zeigt auf, dass in einer Entscheidungsgesellschaft die Frage der rationalen Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung ist.
- Kapitel 2: Definition einer Entscheidungsgesellschaft
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Entscheidungsgesellschaft und beleuchtet, wie sich die moderne Gesellschaft von anderen Gesellschaftsformen unterscheidet. Es werden zentrale Merkmale einer Entscheidungsgesellschaft, wie die funktional-differenzierte Struktur und die zunehmende Bedeutung rationalen Handelns, diskutiert.
- Kapitel 3: Rationalitätsfiktionen
In diesem Kapitel wird der Ansatz der Rationalitätsfiktionen nach Uwe Schimank vorgestellt. Es wird erläutert, wie dieser Ansatz die rationalen Entscheidungsfindungen im Alltag erklärt und welche Rolle Fiktionen dabei spielen.
- Kapitel 4: Rational-Choice-Theorie
Dieses Kapitel behandelt die Rational-Choice-Theorie und ihre zentralen Prinzipien. Es wird erklärt, wie diese Theorie Entscheidungen als Ergebnis rationaler Abwägungen versteht und welche Annahmen sie dabei trifft.
- Kapitel 5: Vergleich von Rationalitätsfiktionen und Rational-Choice-Theorie
Dieses Kapitel vergleicht die beiden Ansätze und untersucht deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es beleuchtet, welche Stärken und Schwächen die jeweiligen Ansätze haben und wie sie sich in der Praxis ergänzen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Legitimation von Handlungen im Alltag und analysiert die Konzepte der Rationalitätsfiktionen und der Rational-Choice-Theorie. Dabei spielen zentrale Themen wie Entscheidungsgesellschaft, funktionale Differenzierung, rationale Entscheidungen, soziale Normen, Legitimität und Handeln im Mittelpunkt.
Häufig gestellte Fragen zu Rationalitätsfiktionen und Rational-Choice
Was sind Rationalitätsfiktionen nach Uwe Schimank?
Rationalitätsfiktionen sind Ansätze, die erklären, wie Menschen im Alltag Entscheidungen treffen, ohne jeden Schritt kritisch hinterfragen zu müssen. Sie dienen als gesellschaftlich anerkannte Muster, die Handlungen legitimieren.
Was ist der Kern der Rational-Choice-Theorie?
Die Rational-Choice-Theorie geht davon aus, dass Individuen Entscheidungen auf Basis rationaler Abwägungen treffen, um ihren eigenen Nutzen zu maximieren.
Wie unterscheidet sich die moderne Entscheidungsgesellschaft von traditionellen Gesellschaften?
In traditionellen Gesellschaften waren viele Lebenswege (Beruf, Partnerwahl) vorgegeben. In der modernen Entscheidungsgesellschaft liegt die Wahlfreiheit beim Individuum, was jedoch einen höheren Begründungszwang für Handlungen erzeugt.
Warum müssen alltägliche Handlungen legitimiert werden?
Da Handlungen in einer modernen Gesellschaft oft auf individuellen Entscheidungen basieren, müssen sie als rational erkennbar sein, um gesellschaftlich akzeptiert und legitimiert zu werden.
Welche Rolle spielt die funktionale Differenzierung in diesem Kontext?
Die funktionale Differenzierung ist ein Merkmal der modernen Gesellschaft, das verschiedene Lebensbereiche trennt und somit die Komplexität von Entscheidungen und deren rationaler Begründung erhöht.
Was ist das Ziel des Vergleichs beider Theorien?
Der Vergleich untersucht die Stärken und Schwächen beider Ansätze bei der Erklärung, wie Menschen in einer komplexen Gesellschaft ihre täglichen Handlungen als vernünftig darstellen.
- Citar trabajo
- Nicole Hilgenberg (Autor), 2020, Rationalitätsfiktionen und Rational-Choice-Theorie im Vergleich. Legitimation von Handlungen im Alltag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021095