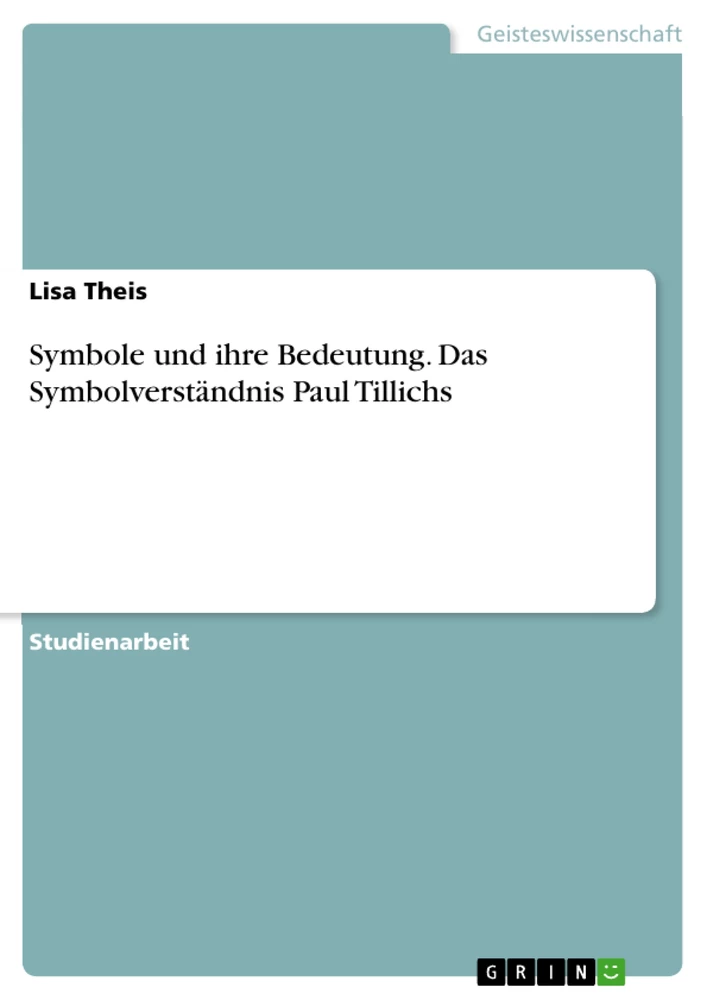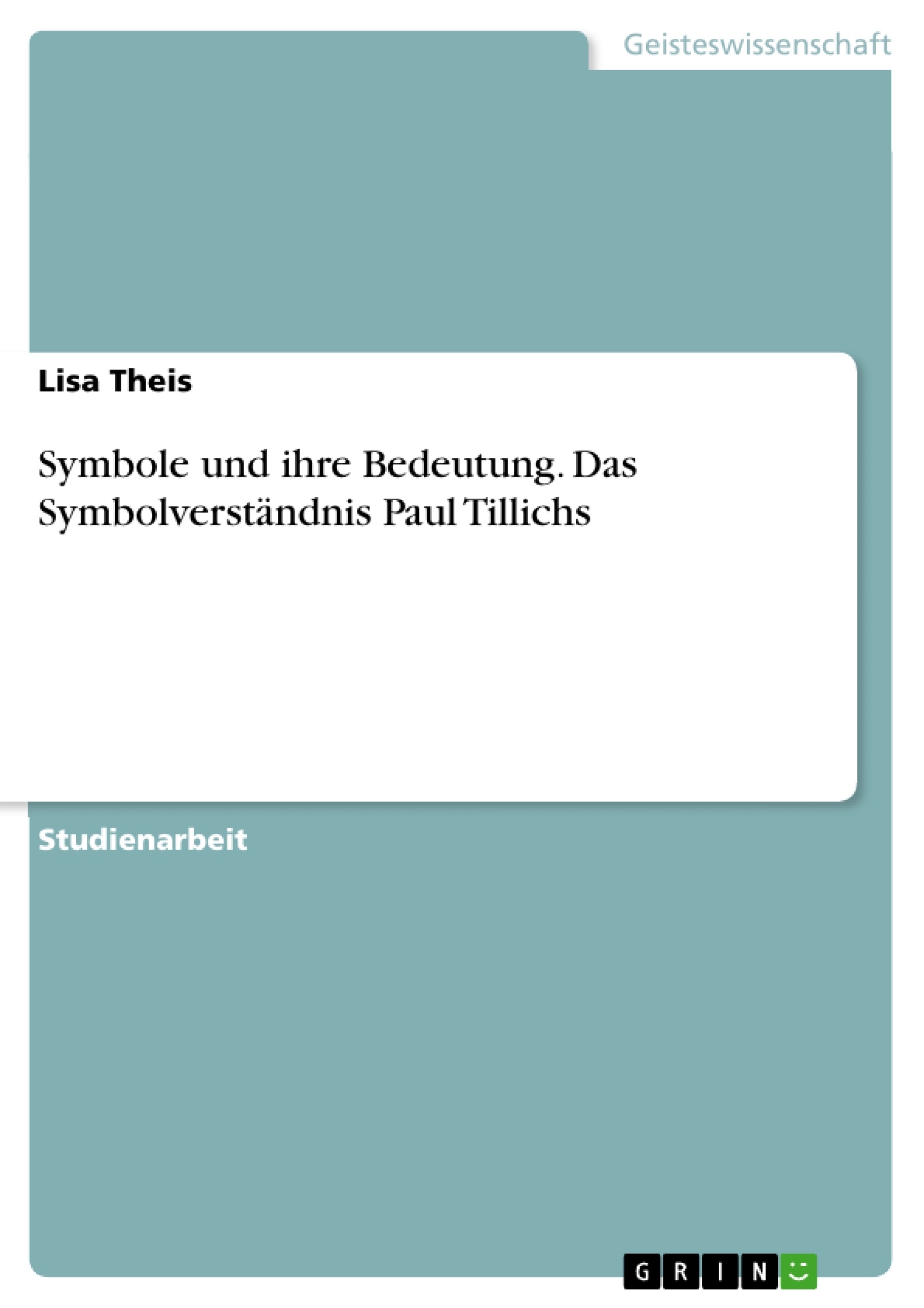Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den Theorien, Deutungen und Methoden des großen Denkers Paul Tillich rund um sein Symbolverstehen.
In Tillichs theologischen Aufsätzen und Werken lassen sich zahlreiche Auseinandersetzungen und Gedankengänge seinerseits mit dem religiösen Symbol finden. Es ist ihm ein Anliegen, auf die Aktualität dieser Symbole mit ihren Antworten auf existenzielle Fragen hinzuweisen und die Wahrheit der christlichen Botschaft hinter den religiösen Symbolen auch für die heutige Zeit neu zugänglich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biografie Tillich
- Definition Symbol allgemein
- Merkmale des Symbols
- Die Uneigentlichkeit
- Die Anschaulichkeit
- Die Selbstmächtigkeit
- Die Anerkanntheit
- Das religiöse Symbol
- Symbolbedeutung
- Die phänomenologische Methode
- Die ontologische Methode
- Die Bedeutung des Symbols für die Existenzanalyse
- Die Genesisgeschichte als religiöses Symbol
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Symbolverständnis des Religionsphilosophen Paul Tillich. Sie analysiert seine Theorien und Methoden zur Interpretation religiöser Symbole, die in seinen theologischen Werken und Aufsätzen deutlich werden. Das Ziel ist es, Tillichs Ansatz zum Symbol und seine Relevanz für das Verständnis der christlichen Botschaft in der heutigen Zeit zu beleuchten.
- Tillichs Biografie und seine philosophischen Interessen
- Definition und Merkmale des Symbols im Allgemeinen
- Das religiöse Symbol: Tillichs Definition und Methoden zur Interpretation
- Die Bedeutung religiöser Symbole für die Existenzanalyse
- Die Genesisgeschichte als Beispiel für ein religiöses Symbol
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Tillichs Hauptthese zum Symbol als Sprache der Religion dar und gibt einen Überblick über die Themen der Arbeit. Sie betont die Relevanz des Symbolverständnisses für die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen.
- Kapitel 2 bietet Einblicke in Tillichs Biografie, die seine philosophischen und theologischen Entwicklungen nachzeichnet.
- Kapitel 3 definiert den Begriff "Symbol" allgemein, erläutert seine vielfältigen Erscheinungsformen im Alltag und hebt seine Bedeutung für die Kommunikation und das Ausdrücken von Emotionen hervor.
- Kapitel 4 befasst sich mit den vier Merkmalen, die Tillich für das Symbol kennzeichnend hält: Uneigentlichkeit, Anschaulichkeit, Selbstmächtigkeit und Anerkanntheit. Die Uneigentlichkeit des Symbols beschreibt seine Fähigkeit, auf eine hinter der sichtbaren Welt liegende Realität zu verweisen.
- Kapitel 5 beschäftigt sich mit Tillichs Definition des religiösen Symbols und seiner spezifischen Bedeutung im Kontext von Glaube und Existenz.
- Kapitel 6 beschreibt Tillichs Methoden zur Interpretation religiöser Symbole, die er als phänomenologisch und ontologisch bezeichnet. Die phänomenologische Methode konzentriert sich auf die empirische Beobachtung von Symbolen, während die ontologische Methode sich auf die tiefere Bedeutung und den Ursprung des Symbols konzentriert.
- Kapitel 7 untersucht die Relevanz des Symbolverständnisses für die Existenzanalyse, indem es Tillichs Gedanken zur Bedeutung religiöser Symbole für die menschliche Existenz und die Bewältigung existentieller Fragen beleuchtet.
- Kapitel 8 erläutert, wie Tillich die Genesisgeschichte als religiöses Symbol interpretiert und welche Bedeutungen er in ihr sieht.
Schlüsselwörter
Religiöses Symbol, Symbolverständnis, Paul Tillich, Existenzanalyse, Theologie, phänomenologische Methode, ontologische Methode, Genesisgeschichte,
- Quote paper
- Lisa Theis (Author), 2019, Symbole und ihre Bedeutung. Das Symbolverständnis Paul Tillichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021160