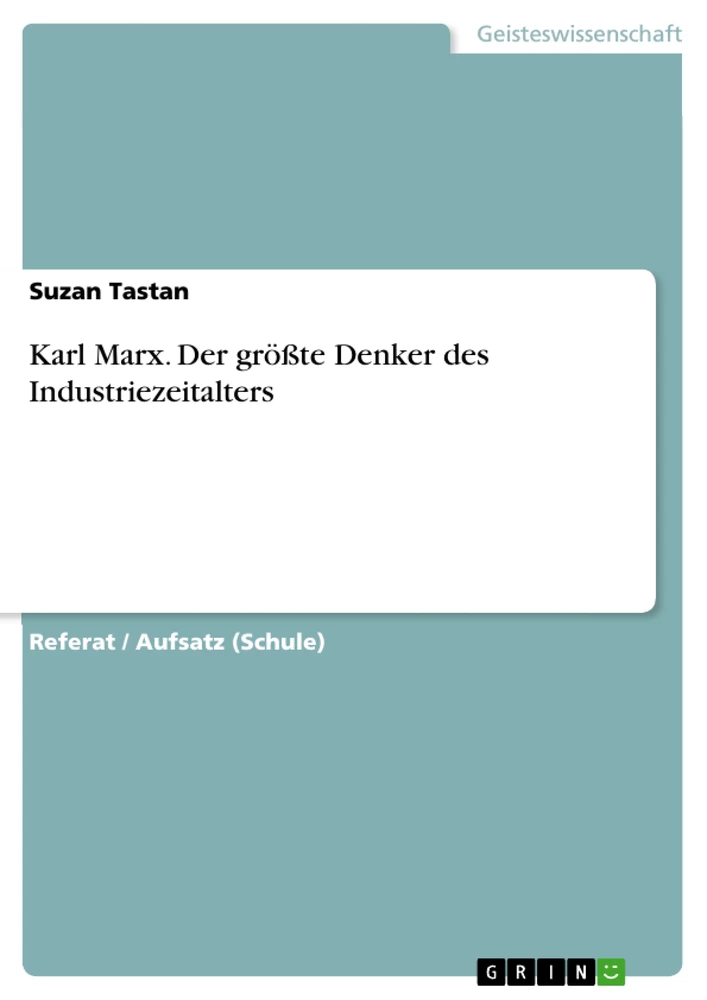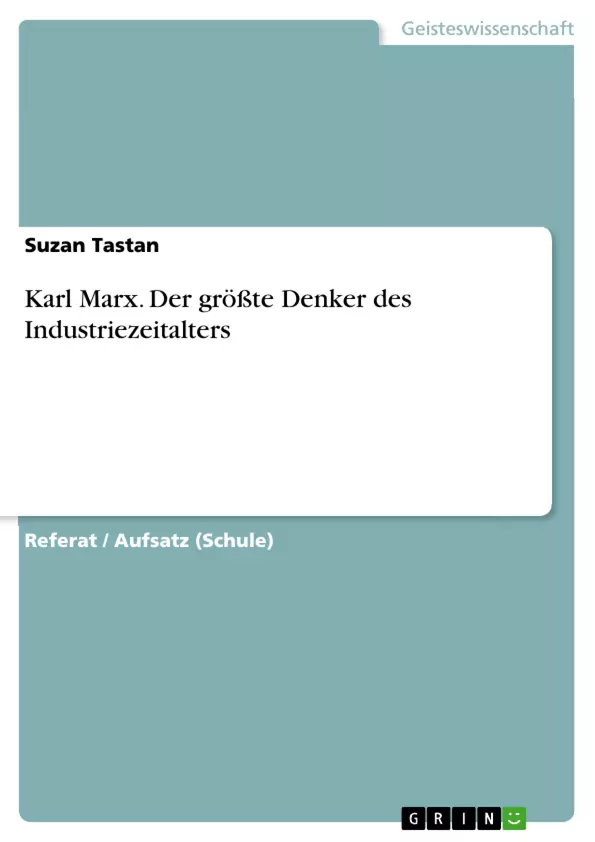Karl Marx - der größte Denker des Industriezeitalters
Karl Marx (1818 bis 1883) gilt als derjenige Philosoph, dem es tatsächlich gelang, die Philosophie praktisch werden zu lassen. Nach ihm wurde eine ganze Weltanschauung (Marxismus) benannt; die dazugehörigen politischen Bewegungen, der Sozialismus, die Sozialdemokratie und der Kommunismus waren lange erfolgreich, sind aber zur Zeit etwas aus der Mode geraten (Sozialdemokratie) oder fast ganz von der Bildfläche verschwunden (Kommunismus). Marx interessierte sich mehr für Philosophie, im besonderen für Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)1, der zwar schon tot, aber noch immer sehr einflussreich war, wofür seine Schüler sorgten, die einige Lehrstühle an deutschen Universitäten besetzt hielten. An Hegel interessierte Marx vor allem die Dialektik und die Selbstbewegung der Geistes; bei beiden hatte er das Gefühl, dass sie noch nicht richtig beim Wort genommen, geschweige denn auf den Prüfstand der Realität gebracht worden waren. Karl Marx übernahm die hegel'sche Dialektik in seinen Theorien weitestgehend, jedoch nahm er eine entscheidende Änderung vor. Marx ging nicht vom Idealismus, sondern Materialismus aus. Der Materialismus geht von der auf der Materie basierenden Idee aus; die Materie selbst sei die Grundlage von allem. Der Grundgedanke des dialektische Materialismus setzt sich in allen späteren Werken Marx fort. Er kennt drei Stufen. 1) Die Erkenntnis, 2) die Kritik und 3) die Handlung. Bei der Erkenntnis wird die wahre Idee des menschlichen Zusammenlebens gesucht, in der Kritik wird dieser Zustand am gesellschaftlichen Ideal abgewogen und in der Handlung wird die resultierende Idee schließlich zur Realität. Eben diese Realität zeigte sich mittlerweile von ihrer unfreundlichsten Seite: Die arbeitende Bevölkerung verarmte zusehend; dafür häuften sich die Reichtümer in der Händen Weniger.
Die Entfremdung, Ausbeutung und Verelendung des Proletariats
Da der Proletarier gezwungen ist, seine ,,Ware" Arbeitskraft zu verkaufen - er besitzt ja nichts anderes - ist sein Arbeiten nicht eine Äußerung des Tätigkeitsdranges, sondern das ihm aufgezwungene Mittel der Selbsterhaltung, um seine Existenz aufrecht zu erhalten. Im Kapitalismus sieht Marx die Ausbeutung schon in einer nachteiligen Aufteilung der Produktionsverhältnisse. Die Kapitalisten, also die Besitzer der Produktionsmittel sind in der deutlichen Minderheit gegenüber den Proletariern, die ihrerseits von den Kapitalisten durch eine starke Entfremdung abhängen. Marx sieht in der Gesellschaftsform des Kapitalismus eine ernst zu nehmende Gefahr, da sie eine Entwicklung - wenn überhaupt - nur in eine absolute Gesellschaft als Endziel zulässt, in der immer weniger Kapitalisten Produktionsmittel besitzen und als Extrem schließlich nur noch einer. Diese Entwicklung wird begünstigt durch die Form der Ausbeutung, bei dem ein Kapitalist an einem Proletarier einen Mehrwert gewinnt, der ihm als Profit zufließt. Durch diese die wachsende Akkumulation des Kapitals in den Händen der Bourgeoisie und der zunehmenden Entfremdung des Menschen von der Arbeit und seiner selbst kommt es zu einer Verelendung des Proletariats.
Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Geldes - Die Geburt des Kapitalismus
Die kapitalistische Produktionsweise ist ein Kreislauf aus vorhandenem Kapital, dessen Einsatz in einer Warenproduktion, daraus erzeugten Mehrwert (Gewinn) und dadurch neu akkumulierten Kapital. Um in diesen Kreislauf zu ,,starten", bedarf es einer ,,ursprünglichen" Akkumulation von Adam Smith als ,,previous accumulation" bezeichnet. Marx entfernt sich mit seiner Kritik der ,,sogenannten ursprünglichen Akkumulation" eindeutig von der Sichtweise der bürgerlichen Ökonomie, wie sie Smith formuliert hat. Die ursprüngliche Akkumulation ist das Ergebnis von Sparsamkeit und Fleiß einer kleinen Elite. Für Marx ist die Teilung des Warenmarktes im Sinne eines Kapitalverhältnisses zwischen Eigentümer von Kapital, Produktionsmitteln und Arbeitern die Grundbedingung für eine kapitalistische Produktionsweise. Damit ist die sogenannte ursprüngliche Akkumulation der Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Produktionsmittel in Kapital verwandelt, anderseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Klassentheorie von Marx
Marx geht davon aus, dass menschliche Gesellschaften in ihrer primitiven Form klassenlos war. Das vorhandene Eigentum war vergesellschaftet, durch die Anhebung der Wohlstandsniveaus wurden auch die Bedingungen für umfangreiches privates Eigentum geschaffen. Die Gesellschaft wurde nun in zwei Hauptklassen gespalten, in die kleine Gruppe der Unterdrücker und in die der bedeutend größerer, der Unterdrückten. Im Kapitalismus gibt es zwei Hauptklassen, die Kapitalisten (Produktionsmittelbestitzer) und die Proletarier (Arbeiter). Das Proletariat aber unterscheidet sich von allen früheren Klassen dadurch, dass es alle spezifischen Menschenmerkmale wie Kultur, Religion, Nationalität eingebüßt hat. Ihr einziges Interesse gilt der Überwindung der gesellschaftlichen Entfremdung auf dem Weg der Vergesellschaftung der Produktionsmittel.
Die Klasse an sich, die Klasse für sich und das Klassenbewusstsein
Jede gesellschaftliche Großgruppierung, deren Mitglieder unter vergleichbaren sozioökonomischen Bedingungen leben, ist zunächst Klasse an sich. Die Individuen dieser Menge sind untereinander unverbunden und sich ihrer Gemeinsamkeit unbewusst. Daher erdulden sie ihr Schicksal, sehen sich selbst aber nicht in der Lage, es aktiv zu beeinflussen. Es gibt Gruppen, deren Mitgliedern es besonders schwerfällt, sich ihrer Gemeinsamkeit klar zu werden, z. B. durch eine starke räumliche Trennung der Individuen untereinander. Marx führt hierfür exemplarisch die französischen Parzellenbauern an: Sie ,, bilden eine ungeheure Masse, deren Glieder in gleicher Situation leben, aber ohne in Beziehung zueinander zu treten. Ihre Produktionsweise isoliert sie voneinander. Die Isolierung wird gefördert durch die schlechten Kommunikationsmittel Die Bauern sind daher unfähig, ihr Klasseninteresse geltend zu machen. Sie können sich nicht vertreten. Anderen Klassen - und hier vor allem dem Proletariat - wird in ihren konkreten Situationen gleichsam die Anweisung zum Bewusst werden vorgegeben.
Dieses kollektive Bewusstsein über die eigene Lage ist das Klassenbewusstsein. Und genau dieses Bewusst-Sein macht aus einer Masse - einer Klasse an sich - eine selbstbewusste und handlungsfähige Einheit. Durch die Organisation, das massenhafte Zusammenhalten des Proletariats wird dieses zur Klasse für sich, und damit zur politischen Partei.
Vom Klassenbewusstsein zum Klassenkampf
Durch das Klassenbewusstsein zur Stärke und Einheit gelangt, trachtet das Proletariat nach einer Beseitigung dieser Klassengesellschaft. Dies ist nur möglich durch den Klassenkampf: Umsturz und Revolution.
Wesentliche Ziele der Revolution sind die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Abschaffung des Privateigentums. Die neue Gesellschaftsordnung wird den Betrieb der Industrie und aller Produktionszweige überhaupt aus den Händen der einzelnen Individuen nehmen und durch die ganze Gesellschaft betreiben lassen müssen. Das Privateigentum als notwendige Folge des Kapitalismus wird also ebenfalls abgeschafft werden müssen, und an seine Stelle wird die Gütergemeinschaft treten.
Am Ende dieser Umwälzung steht das Verschwinden aller Klassenunterschiede. Die Diktatur des Proletariats, die während dieses Prozesses notwendig war, um als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufzuheben, hat sich damit selbst abgeschafft. Für Marx galt der Kapitalismus als Übergangsphase zum Kommunismus, die keine Klassen aufweist. Somit das Volk zur Urgesellschaft zurückführt, hier fängt auch für Marx die eigentliche Menschheitsgeschichte an.
Die Aktualität des marxschen Denkens
Eine erstaunliche Aktualität besitzen die Betrachtungen Karl Marx zum Wesen des Kapitalismus und dessen Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche, auf Kultur, Politik, Moral usw.
Dies und eine gewisse Vorahnung der Wissens- oder Informationsgesellschaft sowie des Zurückgehens der alten nationalstaatlichen Lenkungsmöglichkeiten im Zeitalter des ungehemmten internationalen Kapitalverkehrs wird beispielhaft im folgenden Zitat veranschaulicht, in dem ,,Bourgeoisie2 " durch die ,,Globalisierung" ersetzt wurde:
,,Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Die Globalisierung hat durch die Ausbeutung des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Diese werden verdrängt durch neue Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörigen Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten nationalen Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, der Nationen voneinander. Die geistigen Erzeugnisse werden Gemeingut. Die Globalisierung reißt durch die unendlich erleichterten Komplikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Globalisierung Sie zwingt alle Nationen, die Globalisierung sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Zwar kann von einer offenen Verelendung der Lohnabhängigen nicht mehr die Rede sein: Der moderne Wohlfahrtsstaat beugt den schlimmsten Auswüchsen des Kapitalismus vor. Formen der Verelendung sind dennoch, wenn auch weniger offensichtlich, feststellbar:
,,Fremdbestimmung der Arbeit, Verwandlung schöpferischer Individuen in stumpfsinnige Lohnarbeiter und Konsumenten, Unterbindung von freier Tätigkeit und Passivisierung des Verhaltens."
Polemisch gesagt: Die Verelendung findet heute im Geiste statt und heißt Verdummung. Eventuell aufkeimendes revolutionäres Bewusstsein wird durch Ruhigstellen der Massen erfolgreich verhindert.
Quelle
Störig, Hans Joachim: Kleine Weltphilosophie 2 / Otto A. Böhmer: Sofies Lexikon / Pötzsch, Horst: Informationen zur politischen Bildung, Kommunistische Ideologie I / Geschichte, Politik und Gesellschaft 1 (Geschichtsbuch für die 11 Klasse)
[...]
1 Die sogenannte hegel'sche Dialektik sieht in der Welt nicht einen Komplex von Dingen, sondern einen Komplex von sich ständig in Bewegung befindlichen Prozessen. Es gibt nach dieser Auffassung keine Endgültigkeit und nichts Absolutes. Die Welt ist also einem ständigen Prozess der Veränderung unterworfen. Diese Entwicklung folgt dem These- Gegenthese-Synthese-Schema. Eine These - ein Prozess in die eine Richtung - wird mit einer Gegenthese - also ein entgegenwirkender Prozess - zur Synthese - die schließlich neue These - vereint. Es ist also ein ständiger Kreislauf.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Karl Marx und warum ist er wichtig?
Karl Marx (1818-1883) war ein einflussreicher Philosoph, der eine ganze Weltanschauung (Marxismus) prägte. Er interessierte sich für die Philosophie Hegels und entwickelte den dialektischen Materialismus. Seine Theorien befassten sich mit Entfremdung, Ausbeutung und der Verelendung des Proletariats im Kapitalismus.
Was ist dialektischer Materialismus?
Der dialektische Materialismus ist ein von Marx entwickelter philosophischer Ansatz, der auf der Idee basiert, dass die Materie die Grundlage von allem ist. Er besteht aus drei Stufen: Erkenntnis, Kritik und Handlung. Zuerst wird die wahre Idee des menschlichen Zusammenlebens erkannt, dann am gesellschaftlichen Ideal gemessen und schließlich durch Handlung in die Realität umgesetzt.
Was versteht Marx unter der Entfremdung, Ausbeutung und Verelendung des Proletariats?
Marx argumentierte, dass der Proletarier gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen, was zur Entfremdung von seiner Arbeit führt. Die Ausbeutung entsteht durch die nachteilige Aufteilung der Produktionsverhältnisse im Kapitalismus, wo Kapitalisten einen Mehrwert aus der Arbeit der Proletarier ziehen. Dies führt zur Verelendung des Proletariats, da sich Reichtum in den Händen Weniger ansammelt.
Was ist die "ursprüngliche Akkumulation"?
Die "ursprüngliche Akkumulation" beschreibt den Prozess, durch den gesellschaftliche Produktionsmittel in Kapital verwandelt werden und die unmittelbaren Produzenten (Arbeiter) zu Lohnarbeitern werden. Dies ist eine Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise.
Was ist die Klassentheorie von Marx?
Marx glaubte, dass Gesellschaften ursprünglich klassenlos waren, aber durch die Anhäufung von privatem Eigentum in Unterdrücker und Unterdrückte gespalten wurden. Im Kapitalismus sind die Hauptklassen die Kapitalisten (Besitzer der Produktionsmittel) und die Proletarier (Arbeiter).
Was ist der Unterschied zwischen "Klasse an sich" und "Klasse für sich"?
Eine "Klasse an sich" ist eine gesellschaftliche Großgruppe, deren Mitglieder unter ähnlichen sozioökonomischen Bedingungen leben, sich aber ihrer Gemeinsamkeit nicht bewusst sind. Eine "Klasse für sich" entsteht, wenn diese Gruppe ein kollektives Bewusstsein entwickelt und sich als handlungsfähige Einheit organisiert.
Wie führt das Klassenbewusstsein zum Klassenkampf?
Durch das Klassenbewusstsein erkennen die Proletarier ihre Stärke und Einheit und streben nach der Beseitigung der Klassengesellschaft. Dies führt zum Klassenkampf, der einen Umsturz und eine Revolution beinhaltet.
Was sind die Ziele der Revolution nach Marx?
Die wesentlichen Ziele der Revolution sind die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Abschaffung des Privateigentums. Anstelle des Privateigentums soll eine Gütergemeinschaft treten.
Was ist die Diktatur des Proletariats?
Die Diktatur des Proletariats ist eine Übergangsphase, die während des Klassenkampfes notwendig ist, um die alten Produktionsverhältnisse aufzuheben. Nach Marx führt sie letztendlich zum Kommunismus, einer klassenlosen Gesellschaft.
Wie aktuell ist das marxsche Denken heute?
Die Betrachtungen von Karl Marx zum Wesen des Kapitalismus und dessen Einfluss auf die Gesellschaft haben weiterhin eine erstaunliche Aktualität, insbesondere im Hinblick auf die Globalisierung und die Auswirkungen auf Kultur, Politik und Moral.
- Arbeit zitieren
- Suzan Tastan (Autor:in), 2000, Karl Marx. Der größte Denker des Industriezeitalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102121