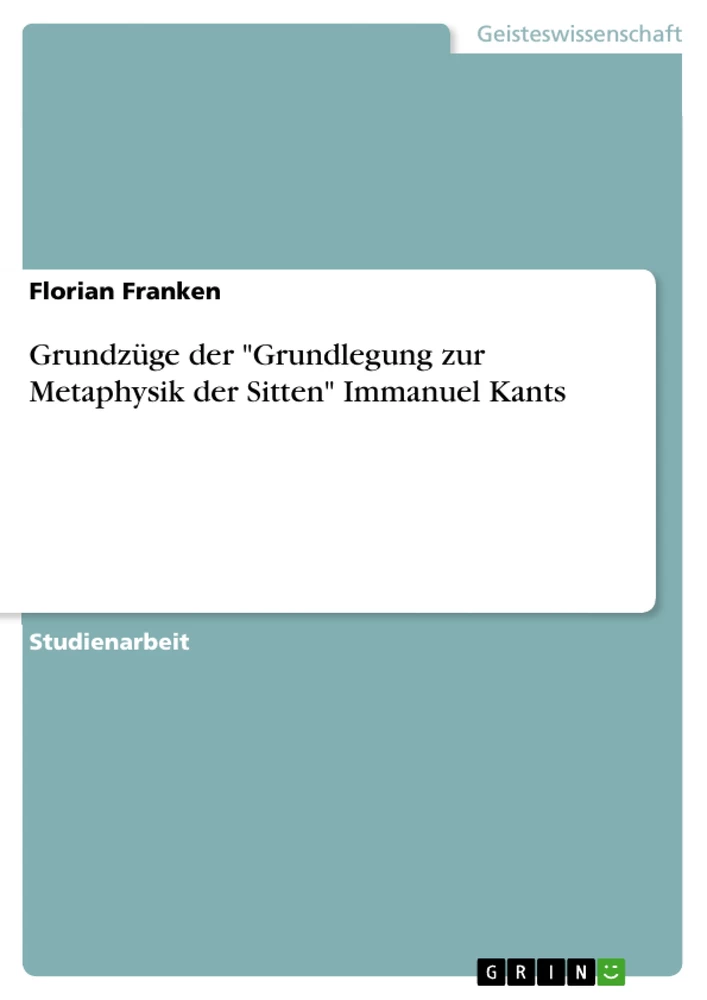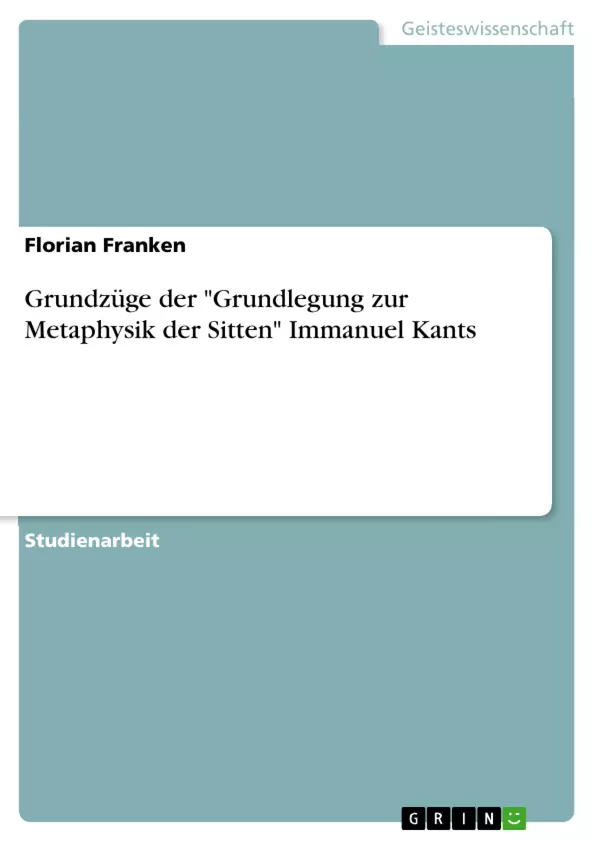Was, wenn die tiefsten Antworten auf die Frage nach richtigem Handeln nicht in religiösen Dogmen oder gesellschaftlichen Konventionen, sondern in der unbestechlichen Logik unserer eigenen Vernunft verborgen liegen? Immanuel Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, ein Eckpfeiler der Moralphilosophie, fordert uns heraus, unser Verständnis von Pflicht, Moral und Autonomie radikal zu überdenken. Diese eingehende Analyse entführt den Leser in das Herz von Kants ethischem System, indem sie seine Schlüsselkonzepte – den guten Willen, den kategorischen Imperativ und die Achtung vor dem Gesetz – aufschlüsselt und in einen zugänglichen Kontext stellt. Entdecken Sie, wie Kant die traditionelle Vorstellung von Moral auf den Kopf stellt, indem er argumentiert, dass wahre moralische Handlungen nicht aus Neigung oder erwartetem Nutzen entstehen, sondern aus der reinen Pflicht, einem universellen moralischen Gesetz zu folgen, das in unserer Vernunft verankert ist. Untersuchen Sie die revolutionäre Idee der kopernikanischen Wende in der Ethik, die besagt, dass moralische Gesetze nicht von einer äußeren Autorität auferlegt werden, sondern aus unserer eigenen Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung entspringen. Ergründen Sie die Bedeutung der Maxime als subjektives Handlungsprinzip und wie sie mit dem objektiven moralischen Gesetz in Einklang gebracht werden kann. Wagen Sie es, an der Gültigkeit einer a priori Moral zu zweifeln, und erleben Sie, wie Kant diese Einwände mit dem Argument entkräftet, dass empirische Erfahrungen allein keine Grundlage für universelle moralische Prinzipien bieten können. Verstehen Sie den Unterschied zwischen dem kategorischen und dem hypothetischen Imperativ und wie sie unser Handeln in verschiedenen Situationen leiten. Erkennen Sie das vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst und die daraus resultierende Verpflichtung, die Menschheit niemals bloß als Mittel zum Zweck zu behandeln. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit den Grundlagen ethischen Denkens auseinandersetzen und die zeitlose Relevanz von Kants Moralphilosophie für die Herausforderungen unserer modernen Welt entdecken möchten. Es bietet nicht nur einen klaren und präzisen Überblick über Kants Werk, sondern regt auch dazu an, die eigenen moralischen Überzeugungen kritisch zu hinterfragen und ein tieferes Verständnis für die Prinzipien zu entwickeln, die unser Handeln leiten sollten. Tauchen Sie ein in die Welt der Kant’schen Ethik und lassen Sie sich von der Kraft der Vernunft inspirieren, ein moralisch verantwortungsvolles Leben zu führen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung der Kant’schen Moralphilosophie Seite
II. Wie kommt Kant auf den Moralbegriff? Seite
III. Die Notwendigkeit eines Moralbegriffes a priori Seiten 2-
IV. Der Wille als Grundlage moralischen Handelns Seiten 3-
V. Der Kant’sche Pflichtbegriff Seite
VI. Die Maxime als Grundlage der Pflichthandlung Seite
VII. Die Achtung fürs Gesetz führt zur Bestimmung des Pflichtbegriffes Seiten 5-
VIII. Das moralische Gesetz Seiten 6-
IX. Zweifel an einer Moral a priori Seiten 7-
X. Der kategorische und der hypothetische Imperativ Seiten 8-
XI. Das vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst Seiten 9-
XII. Schlusswort Seite
Literaturverzeichnis Seite
I. Einleitung der Kant’schen Moralphilosophie
1785 erscheint die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von Immanuel Kant. Das Werk gilt als Vorläufer der „Kritik der praktischen Vernunft“ (1788) und der „Metaphysik der Sitten“ (1797) und reiht sich damit in die Werke der Kant’schen Moralphilosophie ein. Die Moralphilosophie Kants wird geleitet durch die Frage „Was soll ich tun?“ oder auch „Wie soll ich handeln?“.
Unser Handeln wird durch den menschlichen Willen bestimmt. Daher gibt es für die Beantwor- tung dieser Frage grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wird unser Wille durch Gesetze bestimmt, die in uns selbst, in unserer Vernunft liegen. In diesem Fall wäre die Vernunft selbstge- setzgebend. Oder unser Wille wird bestimmt durch etwas, dass außer uns, außerhalb unserer Vernunft liegt. Dann wäre unser Wille durch ein fremdes Gesetz bestimmt. Alle bisherigen Versuche der Philosophie, eine Ethik als Lehre vom richtigen Handeln zu entwi- ckeln, haben nach Kant den Fehler, dass sie den Bestimmungsgrad für unseren Willen außerhalb unser selbst legen.
Kant entgegnet dieser Auffassung mit der von ihm selbst eingeleiteten Kopernikanischen Wende. Diese vertritt die Ansicht, dass die Gegenstände sich nach unserer Erkenntnis richten und nicht umgekehrt. Dadurch geleitet, ist Kant der Überzeugung, dass die Moralgesetze Bestandteil der Vernunft, also unserer selbst sind. Denn das Erstreben von Idealen, wie Glückseeligkeit oder Vollkommenheit ist geprägt von Erfahrungen, die verschiedenartig jedem einzelnen durch die Außenwelt gegeben werden. Sie können daher niemals Ursache eines Moralverständnisses sein. Ein wirklich allgemein geltendes Prinzip könnte nach den Vorstellungen Kants nur der Vernunft entnommen werden. Dieses ist der Grundsatz auf den Kant seine „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ aufbaut.
Ziel meiner Arbeit wird es sein, die Grundbegriffe aus der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ zu erläutern, um sie dann grob in Zusammenhang zueinander zu stellen. Auf diesem We- ge soll ein kleiner Überblick über die Argumentation und das Moralverständnis Kants gegeben werden.
II. Wie kommt Kant auf den Moralbegriff?
Kant geht davon aus, dass sich die griechische Philosophie in drei Wissenschaften unterteilen lässt: Die Physik, die Ethik und die Logik.
Logik, so Kant, ist die formale Philosophie, das bedeutet, dass sie sich mit den allgemeinen Regeln des Denkens, ohne dem Inhalt Bedeutung zuzumessen, also lediglich mit der Form, in der Denken möglich ist befasst.
Dem gegenüber steht die materiale Philosophie, deren Ziel es ist, sich mit Inhalten, also mit der Betrachtung von Objekten auseinander zu setzen. Sie ist wiederum in zwei Teilgebiete untergliedert. Zum einen ist das die Physik oder Naturlehre, die sich mit den Gesetzen der Natur beschäftigt, zum anderen die Ethik oder Sittenlehre, welche die Gesetze der Freiheit umfasst. Worauf Kant bei dieser Trennung hinaus will, ist die Unterscheidung zwischen empirischen Lehren der Philosophie, also solchen, die auf unserer Erfahrung (a posteriori) beruhen und solchen, die keinen empirischen Teil haben, sondern rational, d.h. a priori aus der Vernunft entstehen und somit als reine Philosophie zu verstehen sind.
Als Beispiel einer reinen Wissenschaft a priori nennt Kant die Logik, die als Richtschnur für den Verstand gilt und auf Grund dessen keinen empirischen Teil hat.
Neben der Logik gibt es auch Wissenschaften, die nicht rein formal, sondern auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt sind.
Eine Lehre, die zwar den Gegenstand der reinen Philosophie verwirklicht, weil a priori, sich jedoch nicht mit der Form des Denkens sondern mit den Gegenständen des Denkens beschäftigt, nennt Kant die Metaphysik.
Die Ethik hat somit einen empirischen Teil, den wir praktische Anthropologie, d.h. die praktische Lehre vom Menschen nennen und einen rationalen Teil, die Moral.
III. Die Notwendigkeit eines Moralbegriffes a priori
Dass es eine Moralphilosophie geben muss, begründet Kant damit, dass überhaupt ein Pflicht- begriff und eine Vorstellung von sittlichen Gesetzen innerhalb unseres Alltags existieren. Der menschliche Alltag wird durch soziale Handlungen geprägt, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufweisen.
Kant geht davon aus, dass die Gesetzmäßigkeit mit einer allgemeinen Verbindlichkeit gekoppelt ist, dessen Ursprung nicht in der Natur des Menschen, sondern in den Begriffen der reinen Ver- nunft a priori liegt. „Jedermann muss eingestehen“, so Kant, „...; dass das Gebot: Du sollst nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftigen Wesen sich aber daran nicht zu kehren hätten.“1
Wenn dem so wäre, würden vernünftige Wesen dem Anspruch sittlicher Begriffe allein dadurch unterliegen, dass sie vernünftig sind.
Allgemeine Vorschriften, die sich auf empirische Gründe stützen nennt Kant lediglich eine praktische Regel. Für eine allgemeine Verbindlichkeit moralischer Gesetze muss diese also nach Kant a priori aus der Vernunft entstammen, d. h. es muss eine reine Moralphilosophie sein, die frei von jeglicher empirischen Erfahrung ist.
IV. Der Wille als Grundlage moralischen Handelns
Jedem menschlichen Wesen wird ein Wille zugerechnet. Kant geht davon aus, dass allein der gute Wille auch für gut gehalten werden kann. Dazu muss er bestimmten Grundsätzen unterworfen sein.
Ohne diese Grundsätze kann der Wille nicht als gut identifiziert werden und die inneren Werte eines Menschen können sich zum Bösen wenden. So kann beispielsweise die Glückseligkeit, d.h. die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ohne den Vorsatz eines guten Willens zu Übermut füh- ren.
Daraus entnimmt Kant, dass „der gute Wille die unerlässliche Bedingung selbst der Würdigkeit, glücklich zu sein, auszumachen scheint“2, oder mit anderen Worten, dass, um unserem Glück überhaupt gerecht zu werden, ein guter Wille im Umgang mit anderen Menschen elementar ist.
Glückseligkeit schließt Kant ohnehin als vorgegebenes Ziel menschlichen Handelns aus. Seine Begründung liegt darin, dass das menschliche Wesen mit der Vernunft ausgestattet ist, die den Willen steuert. Wäre menschliches Ha ndeln allein auf den Erhalt der Glückseligkeit ausgerichtet, bestünde keinesfalls die Notwendigkeit der Vernunft. Es wäre indes vorteilhafter, lediglich einem Instinkt folgen zu können, um von der Last Entscheidungen treffen zu müssen befreit zu sein,die den Weg zur Glückseligkeit erschwert.
So ist also nach Kant der Wille das höchste Gut, weil er im Zusammenspiel mit der Vernunft das Verlangen nach Glückseligkeit einschränkt und allein aus der Erfüllung eines Zwecks, der durch Vernunft bestimmt ist Befriedigung bewirkt. Der Weg zur moralischen Persönlichkeit führt also über die Beseitigung der inneren Hindernisse zur Bestrebung die nie verlierbare ursprüngliche Anlage eines guten Willens in sich zu entwickeln.
V. Der Kant’sche Pflichtbegriff
Die Erörterung des Pflichtbegriffes ist für den Ablauf der Untersuchung insofern bedeutsam, weil er den des guten Willen integriert.
Um zu erläutern, was man sich eigentlich unter dem Begriff Pflicht vorzustellen habe, geht Kant zunächst systematisch von der Frage aus, welche Verhaltensweisen nicht mittels Pflicht verwirklicht sind. So grenzt er pflichtwidrige Handlungen, sowie die offensichtlich pflichtgemäße, jedoch durch menschliche Neigung motivierte Handlungen, d.h. die Begehung einer Handlung aus Eigennutz, vom Pflichtbegriff ab: „Denn da lässt sich leicht unterscheiden, ob die pflichtmäßige Handlung aus Pflicht oder aus selbstsüchtiger Absicht geschehen sei.“3
Allerdings sieht Kant es als problematischer an, zu erkennen, wann eine Handlung zwar pflichtgemäß geschieht, der Handelnde mit dem pflichtgemäßen Handeln jedoch, für den objektiven Betrachter versteckt, unmittelbar Neigungen verbindet.
Im Grunde ist aber in solchen Fällen, so die Wertung Kants, die Pflichtmäßigkeit zu vernachlässigen, da hier in eigennütziger Absicht gehandelt wurde. Die Subsumtion des Ganzen wäre also, dass der Charakter, d.h. der Wille eines Menschen dann die höchste Moralität erlangt hat, wenn er nicht aus den eigenen Neigungen, sondern ex ante aus Pflicht handele.
Des weiteren ist Kant davon überzeugt, dass es ebenfalls Pflicht sei, seine eigene Glückseligkeit zu sichern.
Was im ersten Moment ein Widerspruch zu Kants vorherigen Thesen zu sein scheint, da Glückseligkeit in sich die Summe aller Neigungen vereint, wird dadurch begründet, dass ein Mangel der Zufriedenheit, d.h. Frustration, zu Übertretungen der Pflichten führen kann.
VI. Die Maxime als Grundlage der Pflichthandlung
Wenn der Wille allein nicht auf einen moralischen Wert schließen lässt, weil er Neigungen nicht offenbart, stellt sich für Kant die Frage, worin der moralische Wert zu finden sei. Der menschliche Wille beinhaltet zum einen eine Absicht etwas zu tun oder zu unterlassen, einen Zweck oder, wie Kant es nennt, die Triebfeder einer Handlung. Diese wäre a posteriori zu betrachten, da sie materiell ist, d.h. auf Erfahrungen beruht.
Zum anderen beinhaltet der Wille ein Prinzip a priori, durch das dieser bestimmt wird. Als solches Prinzip bezeichnet Kant die Maxime. Wenn also der moralische Wert einer Handlung aus Pflicht nicht in der Absicht zu finden ist, und das kann nicht der Fall sein, da sie a posteriori entsteht, dann muss er folglich im subjektiven Prinzip des Wollens, in der Maxime zu finden sein. Das bedeutet, dass nicht die Handlung im eigentlichen Sinne den moralischen Wert bestimmt, sondern das Prinzip des Wollens.
VII. Die Achtung fürs Gesetz führt zur Bestimmung des Pflichtbegriffes
„Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.“4 Die Begründung Kants für diese These geht von der Frage aus, was der Grund für das Vorhandensein des menschlichen Willens sei.
Der Grund für einen Willen drückt sich in der Tätigkeit desselben aus. Somit scheidet Neigung, wie Bereits im dritten Abschnitt erläutert, als Grund aus, denn diese ist nur eine Wirkung und nicht Tätigkeit eines Willens. Nur das, was Grund und nicht die bloße Wirkung eines Willen ist kann diesen auch bestimmen. Und dieser Faktor ist die reine Achtung für ein praktisches Gesetz. Achtung wird bei Kant „als Gefühl dargestellt, welches sich durch die aktive Einnahme der Stel- lung des inneren Gesetzgebers bildet. (...), es ist das Gefühl für die Autorität des Gesetzes und des Gesetzgebers.“5
Was bedeutet das für den moralischen Wert einer Handlung?
Wie bereits erörtert, lässt sich das moralisch höchste Gut, der gute Wille, vom Pflichtbegriff ab- leiten. Pflicht schließt jegliche Form von Neigung aus, d.h., dass der einzige Grund für eine Handlung aus Pflicht rein objektiv das Gesetz sein kann, subjektiv die Achtung vor dem Gesetz,die ihren Ausdruck in der Maxime findet.
Somit ist das Handeln nach einem moralischen Gesetz, wenn nötig auch unter Abbruch aller menschlichen Neigungen als moralisches Handeln zu begreifen. Insofern kann man Maximen durchaus als subjektive Handlungsregeln begreifen, die jedoch lediglich für das Handeln eines einzelnen Menschen gelten soll, wohingegen das Gesetz einen Grundsatz darstellt, der den Willen jedes Menschen bestimmen soll.
VIII. Das moralische Gesetz
Um den Pflichtbegriff zu bestimmen, benötigt Kant den Begriff der Achtung und den des Geset- zes.
Achtung, so Kant, ist ein, durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gefühl, das zur unmittelbaren Bestimmung des Willens durch das Gesetz und zum Bewusstsein dessen führt. Interessant ist Kants Definition der Achtung insofern, dass sie dem Subjekt eine Doppelrolle zuschreibt. Auf der einen Seite bedeutet sie eine Wirkung auf das Subjekt, d. h. das Handeln des Subjekts wird durch Achtung beeinflusst, auf der anderen Seite liefert die Maxime und damit letztendlich der eigene Wille des Subjekts die Ursache einer Achtung für das Gesetz. In dem Bestehen dieser Doppelrolle drückt sich die eigentliche Freiheit des vernünftigen Wesens aus. Es ist nicht Objekt kausaler Zusammenhänge, sondern hat als Subjekt die Möglichkeit, sich kraft seiner Persönlichkeit den eigenen Sittengesetzen um des Sittengesetzes willen ohne äußere Autorität, weder weltlicher noch himmlischer, zu verpflichten.
Diese Auffassung Kants war, wie schon in der Einleitung angesprochen, die von ihm selbst ein- geleitete revolutionäre Kopernikanische Wendung. Die Umkehrung der Rangordnung zwischen dem guten Willen und dem guten Gegenstand ist nach Kant dadurch begründet, dass „nicht der Wille sich gleichsam um das Gute an sich zu drehen hat, um ihm gemäß zu werden und daher „guter“ Wille heißen zu dürfen, sondern umgekehrt verleiht der gute Wille den von ihm gewähl- ten Zwecken die Qualität des Gut-seins: Diese müssen sich um den guten Willen drehen.“6
Wie aber entsteht nun das Gesetz, das das vernünftige Wesen achten soll?
Das Gesetz muss den menschlichen Willen in irgendeiner Weise bestimmen um Gültigkeit zu erlangen. Wie bereits erörtert geht Kant von einem materialen Teil des Willens, der Absicht, und einem formalen Prinzip des Wollens, der Maxime, aus. Nach Kant kann das Gesetz seinen Ein-fluss nur auf den formalen Teil gültig machen. Denn allein dieser ist zweifelsohne a priori zu be- trachten.
Aus diesem Prinzip entwickelt sich der kategorische Imperativ. Dieser lautet: „ich soll niemals anders verfahren, als so, dass ich auch wollen könne meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden.“7 Die Inhaltslosigkeit dieser Maxime macht deutlich, dass es sich hierbei lediglich um ein Prinzip handelt.
Nach diesem Prinzip, so stellt Kant fest, handeln Menschen tagtäglich ohne es sich bewusst zu machen, werden Maximen tagtäglich als Richtlinien für Beurteilungen benötigt. Sollte da eine Philosophie, so stellt sich Kant die Frage, den Versuch unternehmen, den Menschen über eine Metaphysik der Sitten aufzuklären, ihn durch Theorie endlos zu verwirren, wo sich das praktische im gemeinen Menschenverstand bewährt hat?
Er kommt allerdings zu dem Schluss, dass es das geringere Übel sei den Menschen die Unschuld zu nehmen, als die Gefahr einzugehen, dass das Pflichtbewusstsein immer mehr von Neigungen überschwemmt wird.
IX. Zweifel an einer Moral a priori
Ausgehend von den Erfahrungen, die man bei der Beobachtung zwischenmenschlicher Verhaltensweisen macht, könnte man kritisch hinterfragen, wie es zu denken sei, dass es trotz einer Moral, die a priori aus der Vernunft stammen soll, dennoch derart viele Beispiele menschlichen Eigennutzes und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse aufzuzählen gibt.
Was nützt ein Moralbegriff a priori, wenn er als solcher nicht begriffen wird?
Läge es da nicht viel näher, der These zuzustimmen, dass sich das Sittlichkeitsgefühl aus den Er- fahrungen entwickelt, wenn man vor die Beobachtung gestellt wird, dass Sittlichkeit dermaßen unterschiedlich interpretiert wird, dass sie unwahrscheinlich a priori aus einer Quelle stammen kann?
Kant entgegnet dieser These mit dem Argument, dass, wenn die Sittlichkeit auf Erfahrungen begründet wäre, unser moralisches Handeln an der Stelle an seine Grenzen stoßen würde, an der wir völlig neue Erfahrung machen müssen. Von daher, so Kant, kann der Moralbegriff nur a priori aus der Vernunft stammen.
Ferner setzt ein Gesetz Allgemeingültigkeit voraus. Diese kann nur gewährleistet sein, wenn der Grund menschlichen Handelns in einer Quelle zu finden ist. Kant vertritt in diesem Zusammenhang den Standpunkt, dass, wenn die Menschen erfahrungsgemäß mit dem Sittengesetz wenig anfangen können, wenn ihr wirkliches Handeln mit ihm kaum etwas zu tun hat, dann spricht dies gegen das, was geschieht, nicht gegen das, was geschehen soll. Und dann wäre es nicht das Sittengesetz, das es zu ändern gälte.
X. Der kategorische und der hypothetische Imperativ
Wie bereits erörtert, ist eine Handlung dann von hohem moralischen Wert, wenn das Subjekt ein Handeln, das als objektiv notwendig anerkannt wird subjektiv im Sinne der Pflicht durch das Zusammenspiel von Wille und Vernunft ebenfalls als notwendig anerkennt. Dieser Idealfall ist mit Sicherheit, wie im vorhergegangenen Abschnitt erläutert, nicht immer ge- geben. Vielmehr tritt der Fall ein, dass das objektiv notwendige Handeln subjektiv nicht allein durch Wille und Vernunft bestimmt wird, sondern anteilig durch andere Beweggründe, wie zum Beispiel Neigungen, gelenkt wird, die den Willen beeinflussen. In einem solchen Falle würde in subjektiver Hinsicht der Wille nicht mehr der Vernunft folgen, so dass die sich ereignende Hand- lung (aus Neigung) rein zufällig wäre.
Was objektiv Notwendig ist bestimmt das Gesetz und die Bestimmung eines, durch andere Fak- toren als der Vernunft gesteuerten Willens durch ein objektives Gesetz bezeichnet Kant als Nöti- gung.
Des weiteren nennt er ein vorangestelltes objektives Prinzip, sofern es für einen Willen nötigend ist, ein Gebot, dessen Formel er als Imperativ bezeichnet.
Unter den Imperativen unterscheidet Kant zwischen dem hypothetischen und dem bereits erwähnten kategorischen Imperativ.
Der kategorische (d.h. unbedingt gültige) Imperativ steht zwischen subjektiver Maxime und ob- jektiv-notwendigem Gesetz. Er nötigt das Subjekt seine Maximen logisch so zu durchdenken, als ob es ein allgemeingültiges Gesetz sein könnte. Das Resultat dieses Denkexperiments ist mora- lisch von entscheidendem Wert, denn „beweist sich die in die Form eines Gesetzes gebrachte Maxime als für das Denken und Wollen annehmbar, dann entscheidet das Experiment für die Moralität dieser Maxime. Ist die moralische Qualität der Maxime durch dieses Experiment erwie-sen worden, dann tritt der zweite Teil des Kategorischen Imperatives in Kraft: Jetzt wird der Wil-le aufgefordert, sich für diese Maxime zu entscheiden.“8
Der hypothetische (bedingte) Imperativ begründet die praktische Notwendigkeit einer Handlung als Mittel zu etwas. Er kann sich zum einen als ein problematisch-praktisches Prinzip zum anderen als ein assertorisch-praktisches Prinzip erweisen.
Ersteres ist der Imperativ der Geschicklichkeit, der dem Subjekt Regeln vorgibt ein bestimmtes Ziel auf eine mögliche Art und Weise zu erreichen.
Das assertorisch-praktische Prinzip ist der Imperativ der Klugheit. Klugheit ist nach Kant „die Einsicht,... Absichten zu seinem eigenen daurenden Vorteil zu vereinigen.“9 Somit dient der Im- perativ der Klugheit als Ratgeber für die Wahl der Mittel, seine eigene Glückseligkeit zu sichern.
XI. Das vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst
Worin sich der kategorische und die hypothetischen Imperative nicht unterscheiden, da sie beides Handlungsprinzipien sind, ist die Notwendigkeit der Erfüllung eines Zweckes durch die entsprechende Handlung. Die Begründung für eine Handlung ist immer der Zweck, der mit der Handlung erreicht werden soll. Kant unterscheidet hier zwei Arten von Zwecke. Zum einen konstruiert er den formalen, objektiven Zweck, der, wenn er durch bloße Vernunft gegeben wird für alle vernünftigen Wesen gleich gelten muss.
Den Gegensatz dazu bildet der materiale, subjektive Zweck, der in der Möglichkeit einer Hand- lung (hypothetischer Imperativ) begründet ist und mit Hilfe eines Mittels erreicht werden kann. Für Kant stellt sich nun folgende Frage. Wenn für den kategorische Imperativ eine Notwendig- keit gelten soll, dann kann nicht von der Möglichkeit einer Handlung und einem damit verbun- denen Zweck-Mittel-Verhältnis ausgegangen werden, da aus dieser lediglich Bedingtheit und Zu- fälligkeit resultiert. Wie aber lässt sich der objektive Zweckbegriff in Relation setzen?
Der Grund für eine formale Handlung ist nach Kant der „Beweggrund“, konkret die Achtung vor dem allgemeingültigem Gesetz. Der Grund für das Gesetz wiederum ist der gleiche, aus dem auch der objektive Zweck resultiert: Das vernünftige Wesen.
Kant geht also von der Hypothese aus, dass das vernünftige Wesen an sich selbst einen absoluten Wert hat: „der Mensch,(...), existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen,...10
Aus dieser Behauptung formuliert Kant den praktischen Imperativ: „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“11
Hieraus wird deutlich welche Stellung Kant dem vernünftigen Wesen zuschreibt. Entgegen der herrschenden Meinung sieht Kant den Menschen nicht als lediglich interessenadsorbierendes Subjekt. „Man sahe den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, dass er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei, seinem eigenen, (...), Willen gemäß zu handeln.“12
Das revolutionäre an der Sicht Kants ist die Vorstellung, das Handeln vernünftiger Wesen sei nicht einem Gesetz von außen unterworfen, sondern dem eigenen autonomen Willen. Damit löst sich für Kant der Knoten in der Frage nach dem Beweggrund heteronomer Willensbildung. Der Beweggrund kann für Kant nur in der Erfüllung des Zweckes liegen, und damit im Unterwerfen des vernünftigen Subjekts nach seiner eigenen Maxime.
Aus diesem Prinzip entwickelt sich der Kant’sche Freiheitsbegriff, auf den an dieser Stelle noch kurz eingegangen werden soll.
Die Freiheit des Subjekts besteht für Kant zum einen darin sich für ein vernünftiges Handeln oder für eine Handlung aus Neigung zu entscheiden. Die Entscheidungsfreiheit ist in diesem Zusammenhang elementar, denn hat sich das vernünftige Wesen für ein moralisches Handeln entschieden, besitzt es die Freiheit seine eigene Maxime zum Gesetz zu machen, ohne sich dabei nach Gesetzen anderer Wesen richten zu müssen. Freiheit ist „als Handeln zu verstehen, durch welches sie sich verwirklicht: Dieses Handeln besteht in der Einnahme des Standes des Selbstge- setzgebers.“13
XII. Schlusswort
Es ist beachtlich, welche Komplexität sich hinter dem Gedankengerüst Kants verbirgt. Es gelingt Kant allein durch die Integration der Begriffe untereinander ein überzeugendes Gesamtbild zu schaffen. Im Endeffekt stellen sich jedoch zwei Aspekte als problematisch dar. Nachdem Kant über zwei Drittel des Textes zunächst seine Vorstellungen zum kategorischen Imperativ dargelegt hat, versucht er dessen Existenz zu Beweisen. Dieses gelingt ihm, wenn ü- berhaupt, nur mit Hilfe eines schwer akzeptierbaren Gedankensprungs: Der Mensch als Zweck an sich.
Warum ist dieser Gedankensprung schwer akzeptierbar?
Ein möglicher Grund könnte in dem revolutionären Charakter der Idee Kants liegen. Möglicherweise ist die Idee ein autonomes, vernünftiges Wesen zu sein für den Menschen unbefriedigend, weil er auf Grund seiner Neigungen eher zu einem heteronomen, sich einer Autorität unterwerfenden Selbstverständnis neigt.
Ein weiteres und viel stärkeres Problem des Werkes ist seine Übertragbarkeit in die Gegenwart. Kant geht von Beginn an von einem Ideal aus, nämlich dem des guten Willens. Daraus muß gefolgert werden, dass es ihm weniger darauf ankommt, die Frage zu beantworten, auf welchen Grundsätzen menschliches Zusammenleben begründet ist. Vielmehr entsteht durch die Voraussetzung eines guten Willens eine Zenralisierung auf die Frage, wie allein ein gutes Handeln des vernünftigen Wesens begründet ist.
Die Wahrscheinlichkeit dieses Ideal in adäquatem Maße in der Gegenwart anzutreffen ist sehr beschränkt. Die Gesellschaft, oder im Kant’schen Sinne das „Reich der Zwecke“, betrachtet sich längst nicht als solches. Stattdessen ist das gesellschaftliche Leben geprägt von zwischenmenschlichen Machtverhälnissen, die aus der Aufstellung von Neigungskonstellationen resultieren. Das Verhältnis der Anteile von Vernunft und Neigung stimmt im Rahmen menschlichen Handelns nicht mit den Vorstellungen Kants überein.
Nach Kants Freiheitstheorie hat ein solches Missverhältnis folgende Konsequenz. Machtverhäl- nisse bewirken die Einschränkung der persönlichen Freiheit, so wie Kant sie interpretiert. Was für das vernünftige Wesen subjektiv nicht Spürbar ist, weil ihm der objektive Blick fehlt wird ihm zum Verhängnis. Es unterliegt letztendlich doch seinen Neigungen und zahlt den Preis mit seiner Freiheit.
Literaturverzeichnis
[...]
1 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA VIII, IX
2 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 1, 2
3 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 9, 10
4 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 14
5 Friedrich Kaulbach: Immanuel Kants >Grundlegung zur Metaphysik der Sitten<; S. 25
6 Friedrich Kaulbach: Immanuel Kants >Grundlegung zur Metaphysik der Sitten<; S. 24
7 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 17
8 Friedrich Kaulbach: Immanuel Kants >Grundlegung zur Metaphysik der Sitten<; S.33
9 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 43
10 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 64/65, 66
11 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 67
12 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“; BA 73
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" von Immanuel Kant?
Die "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" ist ein Werk von Immanuel Kant aus dem Jahr 1785, das als Vorläufer seiner späteren Werke zur Moralphilosophie gilt. Es befasst sich mit der Frage, wie man moralisch richtig handeln soll.
Wie kommt Kant zu seinem Moralbegriff?
Kant unterteilt die Philosophie in Logik, Physik und Ethik. Die Logik ist formal, während Physik und Ethik material sind. Die Ethik hat einen empirischen Teil (praktische Anthropologie) und einen rationalen Teil (Moral), der a priori aus der Vernunft entsteht.
Warum ist ein Moralbegriff a priori notwendig?
Kant argumentiert, dass Pflichtbegriffe und sittliche Gesetze allgemein verbindlich sein müssen. Diese Verbindlichkeit kann nicht aus der Erfahrung stammen, sondern muss a priori aus der reinen Vernunft abgeleitet werden.
Welche Rolle spielt der Wille in Kants Moralphilosophie?
Laut Kant kann allein der gute Wille als gut betrachtet werden. Er muss bestimmten Grundsätzen unterworfen sein. Der gute Wille ist die Voraussetzung für die Würdigkeit, glücklich zu sein.
Was versteht Kant unter dem Pflichtbegriff?
Pflicht ist der Begriff, der den guten Willen integriert. Kant grenzt pflichtwidrige Handlungen und aus Eigennutz motivierte Handlungen vom Pflichtbegriff ab. Eine Handlung ist dann moralisch, wenn sie aus Pflicht und nicht aus Neigung geschieht.
Was ist die Maxime als Grundlage der Pflichthandlung?
Der moralische Wert einer Handlung liegt nicht in der Absicht (a posteriori), sondern im subjektiven Prinzip des Wollens, der Maxime (a priori). Die Maxime ist das Prinzip, nach dem der Handelnde handelt.
Welche Bedeutung hat die Achtung fürs Gesetz?
Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Achtung ist ein Gefühl für die Autorität des Gesetzes und des Gesetzgebers. Das Handeln nach einem moralischen Gesetz, auch unter Abbruch aller Neigungen, ist moralisches Handeln.
Was ist das moralische Gesetz?
Das moralische Gesetz muss den menschlichen Willen bestimmen, um Gültigkeit zu erlangen. Kant entwickelt den kategorischen Imperativ, der lautet: "Ich soll niemals anders verfahren, als so, dass ich auch wollen könne meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden."
Welche Zweifel gibt es an einer Moral a priori?
Kritiker bemängeln, dass es trotz einer Moral a priori viele Beispiele für menschlichen Eigennutz gibt. Kant entgegnet, dass das Sittlichkeitsgefühl nicht aus der Erfahrung stammen kann, da moralisches Handeln sonst an seine Grenzen stoßen würde.
Was unterscheidet den kategorischen und den hypothetischen Imperativ?
Der kategorische Imperativ ist unbedingt gültig und fordert das Subjekt auf, seine Maximen so zu durchdenken, als ob sie ein allgemeingültiges Gesetz sein könnten. Der hypothetische Imperativ begründet die praktische Notwendigkeit einer Handlung als Mittel zu etwas.
Was bedeutet "das vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst"?
Kant argumentiert, dass das vernünftige Wesen an sich selbst einen absoluten Wert hat. Der Mensch existiert als Zweck an sich selbst und nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauch für diesen oder jenen Willen. Dies führt zum praktischen Imperativ: "Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest."
Was ist Kants Freiheitsbegriff?
Die Freiheit des Subjekts besteht darin, sich für ein vernünftiges Handeln oder für eine Handlung aus Neigung zu entscheiden. Hat sich das vernünftige Wesen für ein moralisches Handeln entschieden, besitzt es die Freiheit, seine eigene Maxime zum Gesetz zu machen.
- Citar trabajo
- Florian Franken (Autor), 2001, Grundzüge der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Immanuel Kants, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102151