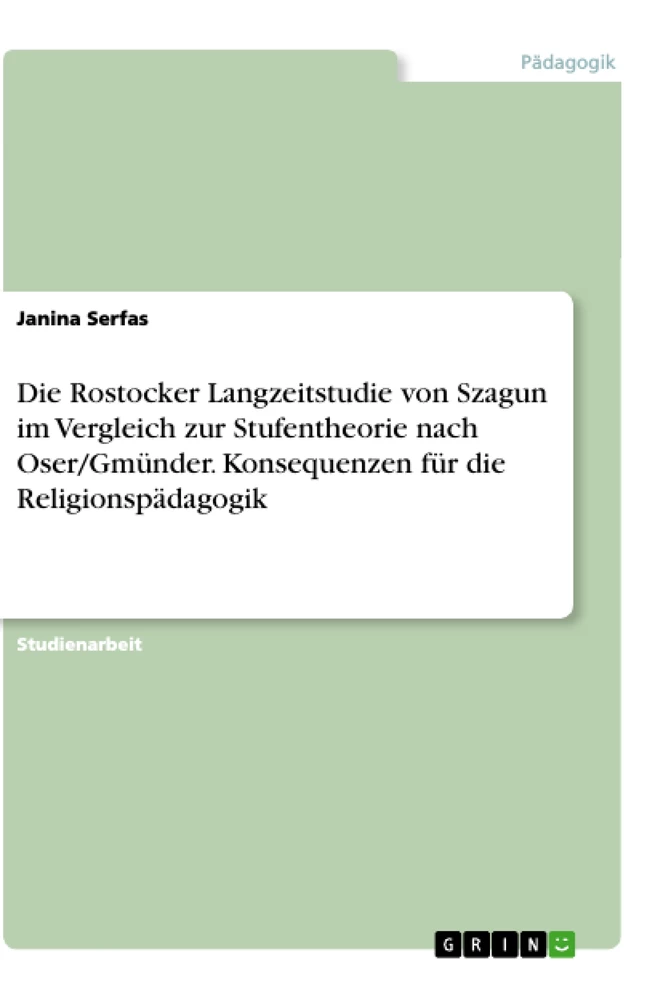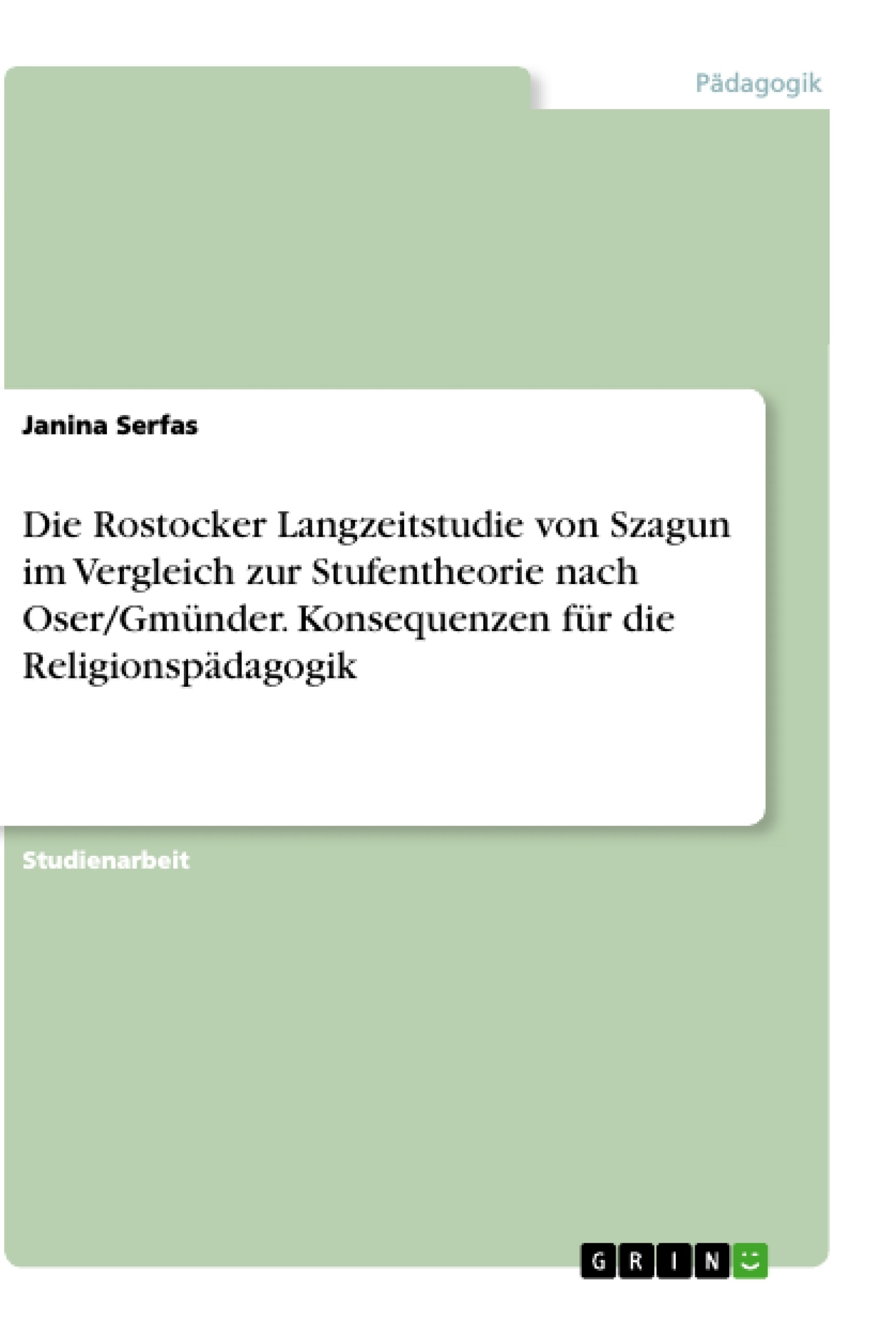In dieser Arbeit soll die Frage nach der grundsätzlichen Vergleichbarkeit der Rostocker Langzeitstudie zur Stufentheorie nach Oser/Gmünder thematisiert werden und daran anknüpfend auf die Bedeutung der Rostocker Langzeitstudie für die religionspädagogische Praxis eingegangen werden.
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht haben sich in den letzten Jahrzehnten gravierend geändert: Es herrscht ein gesellschaftliches Klima, wo Religion und Glaube weder Relevanz noch Plausibilität zu haben scheinen, wo sich die Glaubensvorstellungen selbst kirchenverbundener Christen immer mehr von der offiziellen Glaubenslehre entfernen und wo die Erwachsenen diese nun fragwürdig gewordenen Vorstellungen, die sie selbst noch als Kinder prägten, nicht mehr an ihre eigenen Kinder weitergeben möchten. Enttraditionalisierung, Individualisierung, Pluralisierung, moderne Informationstechniken und Globalisierung prägen unsere moderne westliche Gesellschaft. Vor allem für Religion und Glaube gilt: „Traditionen werden nicht mehr geerbt, sondern gewählt.“ Kinder bringen heute eine Vielfalt von Wirklichkeitskonstruktionen mit in den Religionsunterricht, was vor allem die in der Religionspädagogik populären strukturgenetischen Konzepte religiöser Bildung mit ihrem universellen Geltungsanspruch in Frage stellt. Stufentheorien zur religiösen Entwicklung, wie die Studie „Der Mensch – Stufen seiner religiösen Entwicklung“ (1984) von Fritz Oser und Paul Gmünder gehörten jahrelang zum religionspädagogischen Standardprogramm für Lehramtsstudenten in Theologie. Anna-Katharina Szagun bezweifelt, dass es sich bei den Stufentheorien tatsächlich um „gesichertes Wissen“ handelt, da diese auf Untersuchungen in christlichen Kontexten basieren. Sie entwickelt einen eigenen Ansatz zur Untersuchung des Gotteskonzeptes von Kindern, die in einem mehrheitlich konfessionslosen Kontext groß werden. Dieser Ansatz wird in Kapitel 2 dieser Arbeit im Kontrast zum strukturgenetischen Stufenkonzept nach Oser/Gmünder vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 3 die Methodik von Szaguns Rostocker Langzeitstudie erläutert und ihre Originalität anhand eines Vergleiches zum methodischen Vorgehen von Oser/Gmünder sowie dem von Anton Bucher und Helmut Hanisch bei ihren empirischen Untersuchungen der zeichnerischen Entwicklung des Gottesbildes von Heranwachsenden hervorgehoben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ansatz: Jenseits der Stufentheorie von Oser/Gmünder
- 3 Methode: Die Rostocker Langzeitstudie
- 4 Fazit: Ein legitimer (?) Vergleich und seine Konsequenzen für die Religionspädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ansatz und die Methode von Anna-Katharina Szagun in ihrer Rostocker Langzeitstudie im Vergleich zur Stufentheorie nach Fritz Oser/Paul Gmünder. Die Zielsetzung besteht darin, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze herauszuarbeiten und die Relevanz der Rostocker Langzeitstudie für die religionspädagogische Praxis zu beleuchten.
- Vergleich der Rostocker Langzeitstudie mit der Stufentheorie von Oser/Gmünder
- Analyse des methodischen Vorgehens beider Ansätze
- Bewertung der Anwendbarkeit der Stufentheorie in einem multikulturellen Kontext
- Relevanz der Ergebnisse für die religionspädagogische Praxis
- Entwicklung von Gotteskonzepten bei Kindern in konfessionslosen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht. Die zunehmende Enttraditionalisierung, Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft stellen die traditionellen strukturgenetischen Konzepte religiöser Bildung in Frage, insbesondere Stufentheorien wie die von Oser/Gmünder. Die Arbeit stellt den Ansatz von Anna-Katharina Szagun und ihre Rostocker Langzeitstudie vor, die eine Alternative zu diesen Theorien bietet, indem sie sich mit dem Gottesverständnis von Kindern in einem mehrheitlich konfessionslosen Kontext auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Ansätze und deren Implikationen für die Religionspädagogik.
2 Ansatz: Jenseits der Stufentheorie von Oser/Gmünder: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Stufentheorie von Oser/Gmünder, die auf dem strukturgenetischen Ansatz von Piaget und Kohlberg basiert. Es wird die empirische Basis der Theorie hinterfragt und ihre Anwendbarkeit in pluralen Kontexten in Frage gestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der sechs Stufen des religiösen Urteils nach Oser/Gmünder, beginnend mit der frühkindlichen Perspektive der Innen-Außen-Dichotomie bis zur höchsten Stufe, die auf Experteninterviews und theoretischen Überlegungen basiert. Der Übergang zwischen den Stufen wird als krisenhaft und mit einer Umgestaltung der Beziehung zum Ultimaten beschrieben. Die Schwächen des Modells im Hinblick auf die Berücksichtigung kultureller und konfessioneller Diversität werden herausgestellt. Der Ansatz von Szagun wird als Gegenmodell positioniert, welches sich explizit mit der religiösen Entwicklung von Kindern in einem konfessionslosen Umfeld auseinandersetzt.
3 Methode: Die Rostocker Langzeitstudie: Dieses Kapitel erläutert die Methodik der Rostocker Langzeitstudie von Anna-Katharina Szagun. Es hebt die Originalität der Studie im Vergleich zu den methodischen Vorgehensweisen von Oser/Gmünder und anderen Forschern hervor. Im Detail werden die Forschungsmethoden der Langzeitstudie analysiert, ihre Stärken und Schwächen im Kontext des Vergleichs mit den traditionellen Ansätzen diskutiert, und der Fokus auf die Erfassung des Gottesverständnisses von Kindern in konfessionslosen Kontexten betont. Der Kapitel beleuchtet die einzigartige Perspektive der Studie und deren Beitrag zur religionspädagogischen Forschung.
Schlüsselwörter
Rostocker Langzeitstudie, Stufentheorie Oser/Gmünder, religiöse Entwicklung, Gotteskonzept, Kinder, Konfessionslosigkeit, Religionspädagogik, multikultureller Kontext, empirische Forschung, Gottesverständnis.
Häufig gestellte Fragen zur Rostocker Langzeitstudie im Vergleich zur Stufentheorie von Oser/Gmünder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht den Ansatz und die Methodik der Rostocker Langzeitstudie von Anna-Katharina Szagun mit der Stufentheorie von Oser/Gmünder. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Ansätze und deren Relevanz für die religionspädagogische Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Gotteskonzepten bei Kindern in konfessionslosen Kontexten.
Welche Theorien werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Rostocker Langzeitstudie als Gegenmodell zur strukturgenetischen Stufentheorie von Oser/Gmünder, welche auf Piaget und Kohlberg basiert. Die Arbeit analysiert die sechs Stufen des religiösen Urteils nach Oser/Gmünder und deren Schwächen, insbesondere im Hinblick auf multikulturelle Kontexte.
Welche Methodik wird in der Rostocker Langzeitstudie angewendet?
Das Kapitel zur Methodik beschreibt detailliert das Vorgehen der Rostocker Langzeitstudie. Es hebt die Originalität der Methode im Vergleich zu Oser/Gmünder hervor und analysiert Stärken und Schwächen im Kontext des Vergleichs mit traditionellen Ansätzen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erfassung des Gottesverständnisses von Kindern in konfessionslosen Kontexten.
Welche Kritikpunkte werden an der Stufentheorie von Oser/Gmünder geübt?
Die Arbeit hinterfragt die empirische Basis der Stufentheorie von Oser/Gmünder und deren Anwendbarkeit in pluralen Gesellschaften. Kritisiert wird insbesondere die unzureichende Berücksichtigung kultureller und konfessioneller Diversität. Der Übergang zwischen den Stufen wird als krisenhaft und mit einer Umgestaltung der Beziehung zum Ultimaten beschrieben, jedoch mangelt es an einer umfassenden Erklärung der kulturellen Einflüsse auf diesen Prozess.
Welche Bedeutung hat die Konfessionslosigkeit für die Studie?
Die Konfessionslosigkeit spielt eine zentrale Rolle, da die Rostocker Langzeitstudie explizit die religiöse Entwicklung von Kindern in einem mehrheitlich konfessionslosen Umfeld untersucht. Dies stellt einen wichtigen Kontrast zur Stufentheorie von Oser/Gmünder dar, welche diesen Kontext weniger berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit beleuchtet die Implikationen des Vergleichs für die Religionspädagogik. Es bewertet die Anwendbarkeit der Stufentheorie in multikulturellen Kontexten und diskutiert die Relevanz der Ergebnisse der Rostocker Langzeitstudie für die Praxis. Es wird ein legitimer Vergleich der beiden Ansätze angestrebt und dessen Konsequenzen für die religionspädagogische Praxis diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Rostocker Langzeitstudie, Stufentheorie Oser/Gmünder, religiöse Entwicklung, Gotteskonzept, Kinder, Konfessionslosigkeit, Religionspädagogik, multikultureller Kontext, empirische Forschung, Gottesverständnis.
- Citation du texte
- Janina Serfas (Auteur), 2014, Die Rostocker Langzeitstudie von Szagun im Vergleich zur Stufentheorie nach Oser/Gmünder. Konsequenzen für die Religionspädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021839