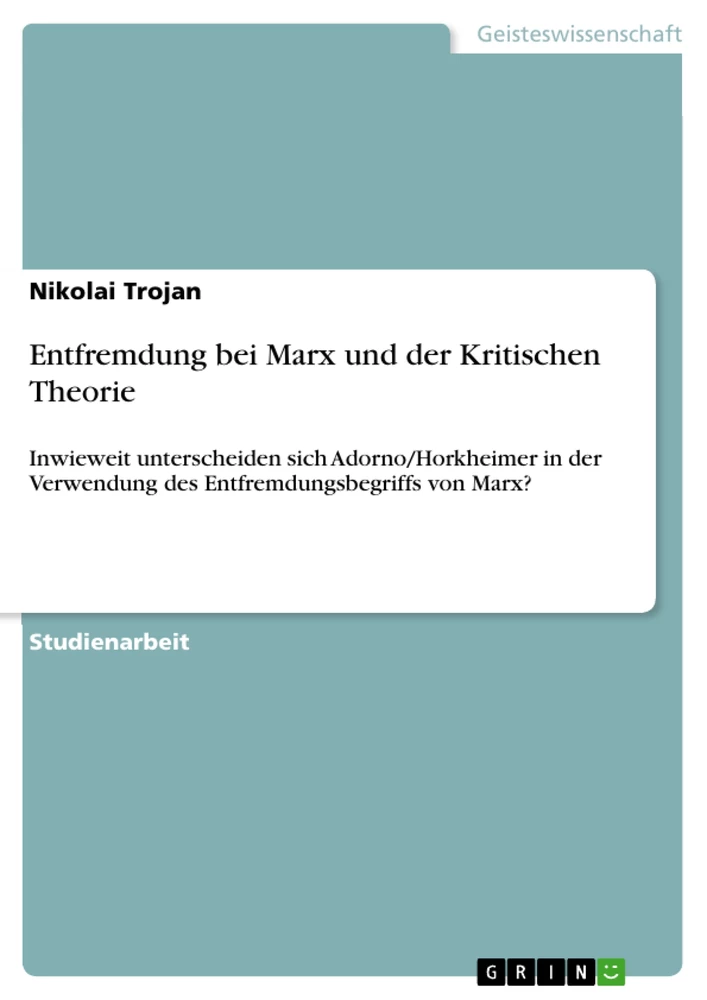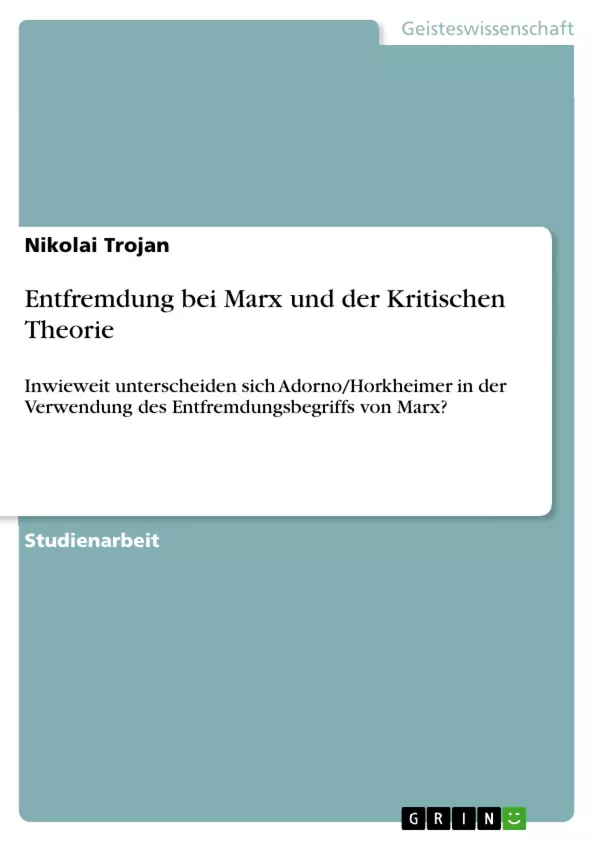Diese Seminararbeit befasst sich thematisch mit der Verbindung von Marxens Gesellschaftstheorie und der Kritischen Theorie, in Persona Adorno und Horkheimer. Das zu untersuchende Element ist der Begriff der Entfremdung.
So lässt sich insbesondere beim frühen Marx eine Theorie der Entfremdung ausmachen, welche die Entfernung des Subjekts von seiner Arbeit beschreiben soll. Im gesellschaftstheoretischen Hauptwerk Marxens ist ein ähnliches Moment erkennbar: die unter anderem im Kapital beschriebene kapitalistische Produktionsweise stellt nach ihm eine Entsprechung von gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen Menschen und den Verhältnissen zwischen Waren her. Es findet eine Verdinglichung, eine Entsubjektivierung der Menschen statt.
Fassen lassen sich beide Phänomene unter dem Begriff „Entfremdung“ – inwiefern sich die Bedeutung unterscheidet wird in der vorliegenden Arbeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick: Der Entfremdungsbegriff
- Karl Marx und die Kritische Theorie
- Marx und die entfremdete Arbeit
- Selbstverwirklichung durch Arbeit oder Entfremdung durch Arbeit
- Die vier Arten der Entfremdung
- Entfremdende Effekte der kapitalistischen Produktion
- Der Entfremdungsbegriff bei Adorno und Horkheimer
- Entfremdung von der äußeren Natur
- Entfremdung von der inneren Natur
- Konklusion: Wie verhält sich der Entfremdungsbegriff bei Marx und Adorno/Horkheimer?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis des Entfremdungsbegriffs bei Karl Marx und der Kritischen Theorie, vertreten durch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Der Fokus liegt dabei auf den frühen Arbeiten von Marx und der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer.
- Entwicklung und Bedeutung des Entfremdungsbegriffs bei Marx
- Analyse der Entfremdung im Kontext der kapitalistischen Produktionsweise
- Entfremdung als Konzept in der Kritischen Theorie
- Vergleich des Entfremdungsbegriffs bei Marx und Adorno/Horkheimer
- Die Rolle der äußeren und inneren Natur im Entfremdungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Entfremdung ein und gibt einen Überblick über die Gesellschaftstheorien von Marx und der Kritischen Theorie. Es wird außerdem die spezifische Verwendung des Begriffs bei Marx und Adorno/Horkheimer dargestellt.
Das Kapitel "Überblick: Der Entfremdungsbegriff" erörtert die verschiedenen Perspektiven auf den Entfremdungsbegriff und definiert ihn im Kontext der vorliegenden Arbeit.
Das Kapitel "Karl Marx und die Kritische Theorie" bietet eine kurze Darstellung der wichtigsten Aspekte der Gesellschaftstheorien von Marx und der Kritischen Theorie. Es beleuchtet die Rolle der ökonomischen Verhältnisse und der Produktionsweise in Marx' Theorie und die kritische Analyse der Aufklärung bei Adorno und Horkheimer.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit den jeweiligen Theorien der Entfremdung bei Marx und Adorno/Horkheimer. Sie erforschen die verschiedenen Facetten der Entfremdung und ihre Ursachen in den beiden Gesellschaftstheorien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Entfremdungsbegriffs in den Werken von Marx und Adorno/Horkheimer. Schwerpunkte sind die kapitalistische Produktionsweise, die Kritische Theorie, die Dialektik der Aufklärung, die Entfremdung von Arbeit, der Mensch und seine Natur, sowie die Verdinglichung und Objektivierung in der modernen Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Nikolai Trojan (Autor), 2021, Entfremdung bei Marx und der Kritischen Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021966