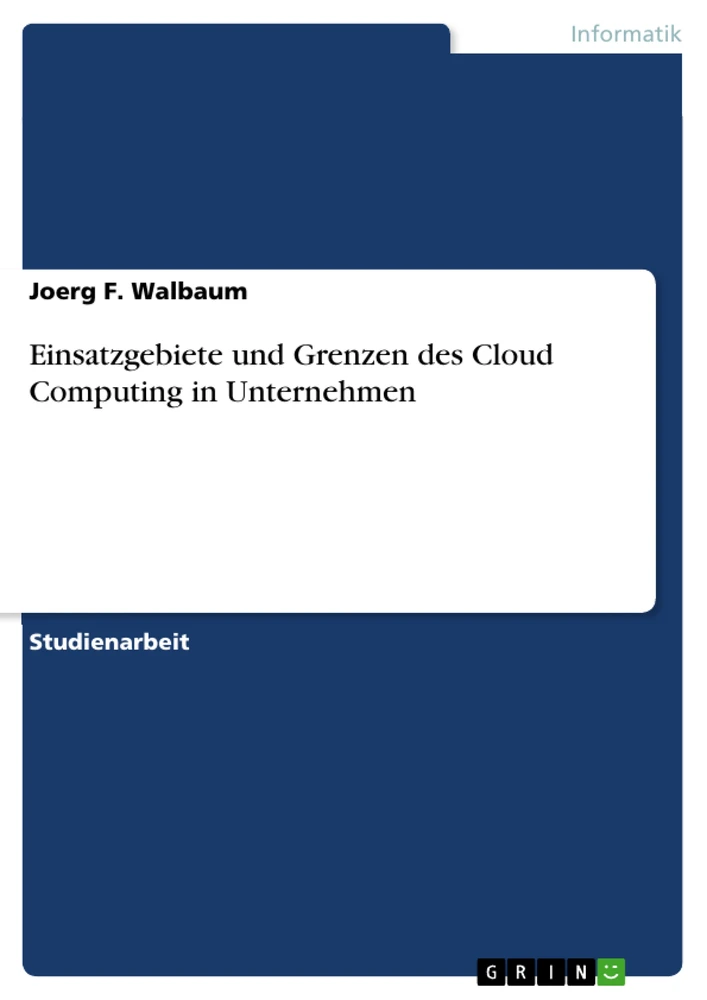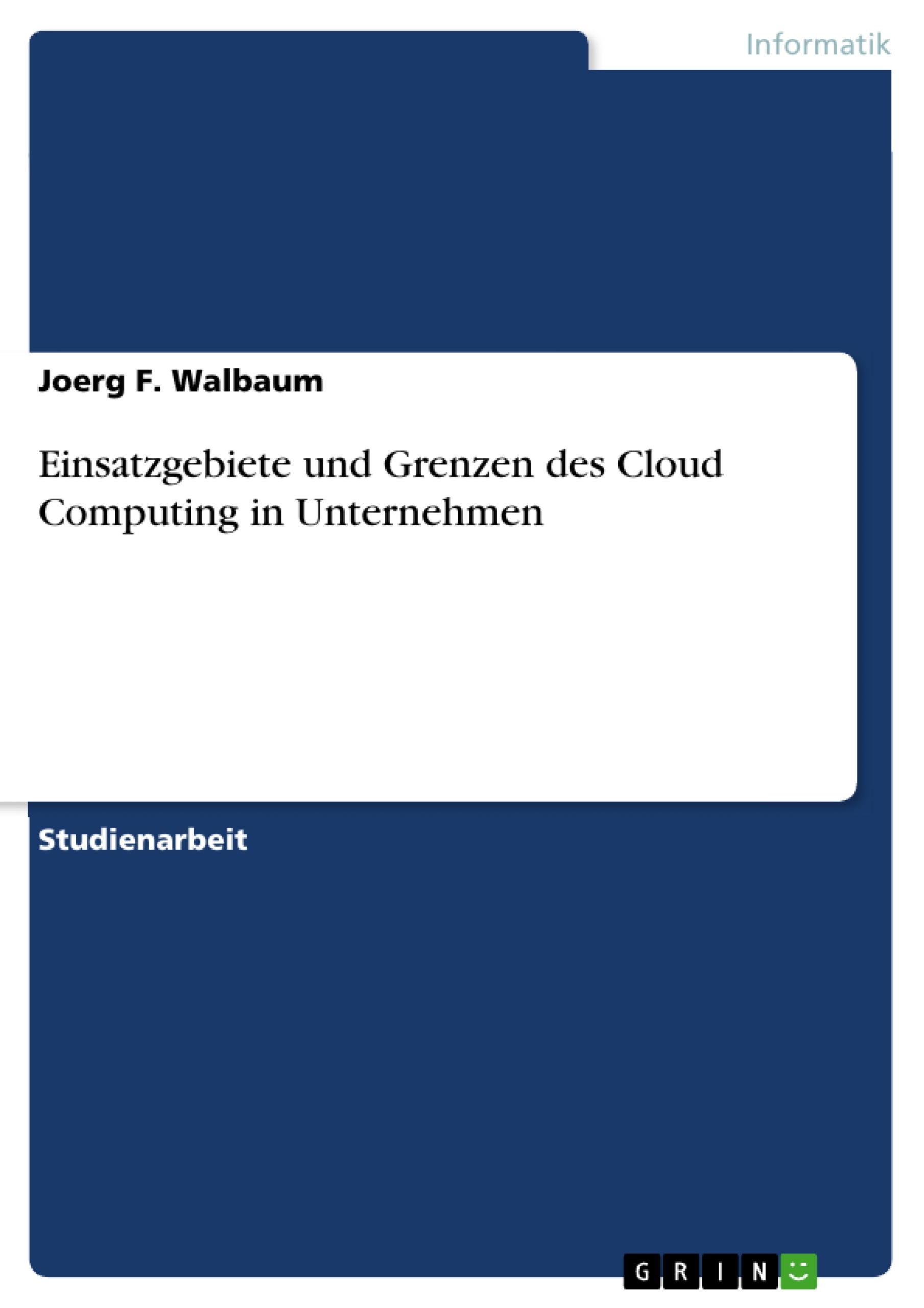Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Einsatzgebiete und die Grenzen des Cloud Computings aufzuzeigen. Dabei soll untersucht werden welche Cloud Service- und Liefermodelle es gibt und welche Vor- und Nachteile insbesondere letztere haben. In diesem Zusammenhang soll auch skizziert werden, wann es sich für ein Unternehmen eher nicht empfiehlt Cloud Computing einzusetzen.
Cloud Computing hat das Stadium eines Trends überwunden. Die neue Art der Dienstleistungserbringung disruptierte den Markt. Anstatt „Cloud first“ heißt es heute unternehmensübergreifend „cloud only“. Schritt für Schritt verändert das Cloud Computing die Welt und stellt bestehende IT-Infrastrukturen auf den Prüfstand. Unternehmen erkennen zunehmend die Möglichkeiten Daten fernab eigener Datenbankkapazitäten zu verarbeiten. Welche Risiken die Unternehmen dabei eingehen, und wo Grenzen des Cloud-Computings liegen, ist vielen oft nicht bewusst.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Relevanz dieser Arbeit
1.2 Ziel dieser Arbeit
1.3 Aufbau dieser Arbeit
2 Theoretische Grundlage
2.1 Cloud Computing
3 Einsatzgebiete von kommerziellem Cloud Computing
3.1 Cloud Computing in der Wirtschaftsprüfung
4 Grenzen des Cloud Computing
4.1 Technische Perspektive
4.2 Wirtschaftliche Perspektive
4.3 Rechtliche Perspektive
5 Schlussbetrachtung
5.1 Zusammenfassung
5.2 Kritische Reflexion der eigenen Vorgehensweise
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- MBA, CRA (univ.) Joerg F. Walbaum (Autor:in), 2021, Einsatzgebiete und Grenzen des Cloud Computing in Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021969