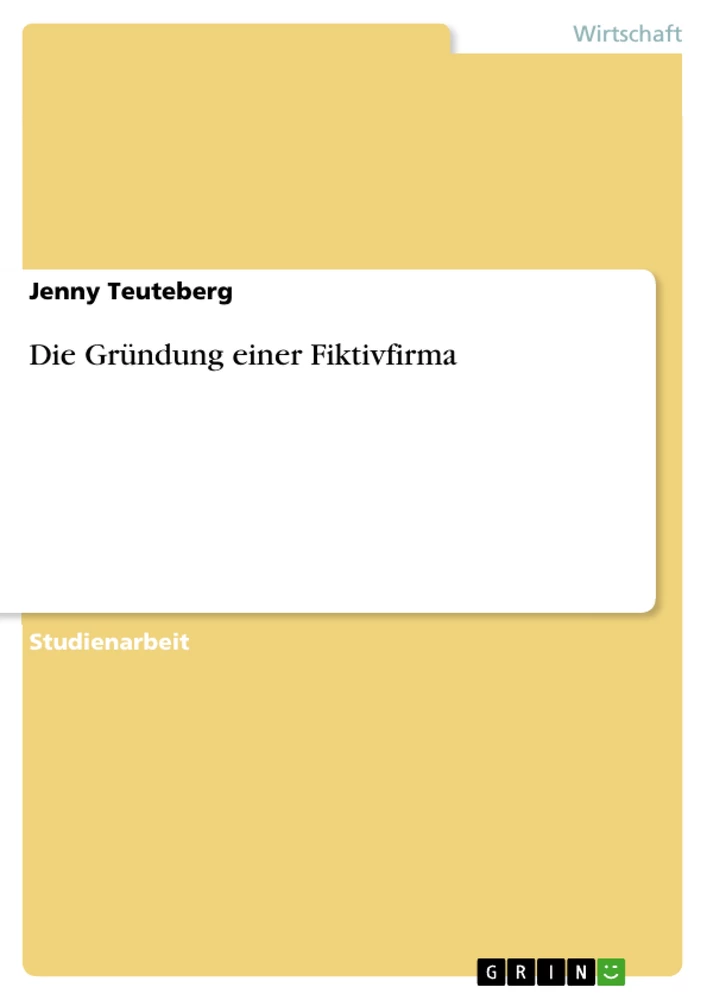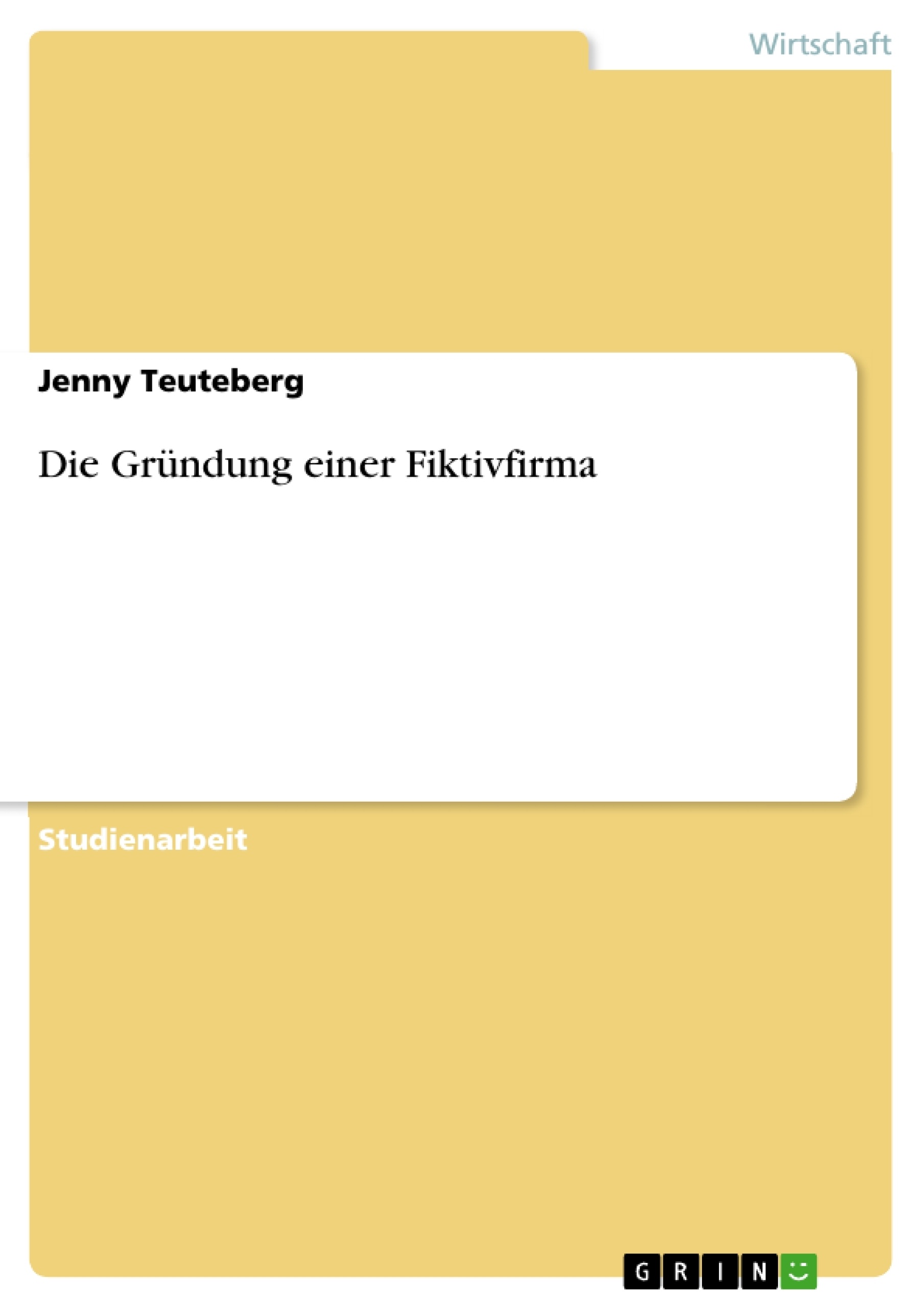Gliederung
1 Ideenverwirklichung
1.1 Sind wir den Anforderungen gewachsen
1.2 Vorstellung des Produktes
1.3 Was spricht für dieses Produkt
2 Wahl der Rechtsform
2.1 Die GbR Gesellschaft §§ 705 – 740 BGB
2.2 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2.3 Entscheidung für die GmbH und warum
3 Gründungsphase der GmbH
4 Standortwahl
5 Finanzierung und Investition
5.1 Eigenkapital/ Eigenkapitalhilfen
5.2 Fremdkapital
6 Organisation der Gesellschaft
7 Rentabilitätsvorschau
8 Buchführungspflicht
8.1 Kaufmännische Buchführung
8.2 Steuerliche Buchführung
8.3 Buchführungsarten
9 Gewinn und Verlustrechnung
10 Ziele
1 Ideenverwirklichung
3 befreundete, ehemalige Kommilitonen hatten schon während des Studiums den Wunsch nach Selbständigkeit. Nachdem sie nun mehrere Jahre bei Groß – und Mittelständischen Unternehmungen beschäftigt waren, haben sie nach reichlichen Recherchen den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und möchten nun ihr Unternehmen aufbauen. Unter Einbeziehung der Diplomarbeit von einem der 3 ehemaligen Studenten mit dem Titel
„ Die Notwendigkeit von Programmieren in Deutschland, bezogen auf das Bundesland M-V. – Warum brauchen wir so dringend Hilfe aus dem Ausland?“.
In dieser Diplomarbeit wurden Zahlen und Fakten widergespiegelt, wie der Bedarf an IT – Kräften in Deutschland, insbesondere in Mecklenburg – Vorpommern gedeckt werden könnte. Anhand dieser Arbeit und weiteren Recherchen wie zum Beispiel Internet, Arbeitsamt und direkte Nachfrage bei wichtigen Klein – Mittel– und Großunternehmungen des Landes M-V haben sich ergeben, dass ein großer Bedarf an IT – Kräften auch in Mecklenburg - Vorpommern besteht. Diese Zahlen bekräftigten die ehemaligen Studenten sich endlich selbständig zu machen.
1.1 Sind wir den Anforderungen gewachsen
Die ehemaligen Studenten haben sich überlegt, ob sie den Anforderungen, die an sie und an die GmbH gestellt werden, gerecht werden können. Sie haben zusammengefasst was für Wissen sie brauchen, was für Wissen sie haben und was für Fachpersonal sie unter Umständen einstellen müssten um den Aufgaben gewachsen zu sein. Um eine Unternehmung zu führen, zu leiten und zu halten, braucht man folgende Kenntnisse: - betriebswirtschaftlich Kenntnisse, volkswirtschaftliche Kenntnisse, arbeitsrechtliche Kenntnisse, in diesem Fall Programmierungskenntnisse, außerdem muß man sich in Rechnungswesen, Personalwesen, Kosten – Leistungsrechnung, mit Controlling und unter anderem auch mit steuerrechtlichen Fragen auskennen.
All diese Punkte sind im groben durch die zukünftigen Unternehmer abgedeckt denn: Frau Mandy Tietze ist Diplom Rechtsinformatikerin, ihr Studium war zu 65% in Recht und zu 35% in Informatik aufgeteilt. Das heißt Frau Tietze kann den Bereich Rechtsabteilung (im weitestem Sinne ) und auch kleinere Bereiche der Informatik übernehmen, sie kann die Pflege von Internetseiten, sowie Analyse von Problemsoftware betreiben. Herr Stefan Norden ist Diplom Informatiker mit den Programmiersprachen C++, Visual Basic, HTML Script und Java Script außerdem ist er prädestiniert für Grafikgestaltung über PhotoShop, Flash. Ich (Frau Teuteberg) bin Diplom Wirtschaftsinformatikerin, mein Studium war zu 40% mit betriebswirtschaftlichen Feldern und zu 60% mit Informatik gefüllt. Meine Programmiersprachen sind C++, Delphi und als Wahlfach im Hauptstudium Unternehmensführung. Das heißt wir könnten in den ersten Monaten versuchen ohne weiters Fachpersonal auszukommen. Ansonsten könnte man eine studentische Hilfskraft ( Studienrichtung Business Informatik) für Engpässe und evtl. Botengänge (Bedarfsweise) einstellen.
1.2 Vorstellung des Produktes
In dem Sinne gibt es kein Produkt, welches in ständiger Produktion ist. Die Produkte werden auf Anfrage individuell für den Verbraucher erstellt. Des weiteren wird eine Dienstleistung erbracht, nämlich die Gestaltung und Pflege der Internetseiten, sowie Analyse und Fehlerbehebung von Problemsoftware. (genaue Beschreibungen sind der Anlage des GmbH-Vertrages zu entnehmen)
1.3 Was spricht für dieses Produkt/ Marktchancen
Die Nachfrage nach Programmierern in Deutschland und auch in M-V ist derzeit sehr groß, dieses geht aus der Diplomarbeit hervor und können ständig an den Stellenangeboten in Fachzeitschriften ersehen werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Markt selbst in den nächsten 5 –7 Jahren nicht zu decken sein wird. Aus diesem Grund wollen sich die drei ehemaligen Kommilitonen zusammenschließen und ihr Wissen anbieten um den Nachfragen gerecht zu werden.
Bsp.: Ein Chef möchte gerne in Outlook mehrere Kalender von unterschiedlichen Personen gleichzeitig öffnen können. Doch diese Problematik kann Outlook nicht lösen und so muss diesem Kunden eine Lösung gegeben werden, mit der er zufrieden ist.
Man muß in diesem Fall eine Sonderfunktion für Outlook aus dem Internet herunterladen und in Outlook einfügen. Danach müssen ganz bestimmte Sachen unter der Rubrik Terminabsprache mit der Sprache Visual Basic programmiert werden und die „Sache“ läuft so wir der Kunde sich das gewünscht hat. Diese Aufgabe könnte durch einen der ehemaligen Studenten gelöst werden. ( Die Studenten haben auch daran gesehen, dass ein Bedarf an Informatikern da ist der gedeckt werden muss.)
Viele Unternehmungen sind inzwischen so spezialisiert, dass sie ihre eigene Software brauchen und nicht mehr nur mit der Standartsoftware auskommen. Somit stehen die Marktchancen recht gut und es liegt letztlich an uns selbst, was wir aus der Situation machen, wie wir unsere Produkte präsentieren und zu welchen Konditionen wir sie auf dem Markt anbieten.
2 Wahl der Rechtsform des Unternehmens
Es stellt sich nun die Frage, welche Rechtsform sich für das Unternehmen anbieten würde. Dazu werden im folgenden die Rechtsformen in Personengesellschaften und in Kapitalgesellschaften unterteilt, um so einen besseren Überblick zu erhalten.
Personengesellschaften Kapitalgesellschaften
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für das Unternehmen würde sich die GbR als Personengesellschaft oder die GmbH als Kapitalgesellschaft anbieten. Diese beiden Rechtsformen werden im folgenden genau unterteilt und es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihnen herausgestellt, um so einen besseren Überblick zu erhalten.
2.1 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) §§ 705 – 740 BGB
Die Grundform aller Personengesellschaft ist die GbR. Das Spektrum der Verwendungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen der GbR ( früher BGB-G)ist breit. Es reicht von Wohn-, Fahr-, Spiel- und Wettgemeinschaften, über Sozietäten von Freiberuflern bis hin zu Konsortien, Konzernen und Kartellen. Entstehung (Gründung) durch Gesellschaftsvertrag: nach § 705 BGB sind konstitutive Merkmale einer GbR –ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Personen, - gerichtet auf die Erreichung des gemeinsamen Zwecks, den zu fördern sich aller Vertragspartner verpflichten.
Nach § 705 BGB entsteht die GbR durch Vertrag, genauer durch und mit Abschluß des Gesellschaftsvertrages, in dem als Mindestinhalt die Gesellschafter, der gemeinsame Zweck und die Pflicht der Gesellschafter zur Zweckförderung festzulegen sind. a) Gesellschafter können werden natürliche Personen und juristische Personen sowie solche nicht rechtsfähigen Personenzusammenschlüsse, die im Rechtsverkehr unter ihrer Firma als geschlossene Einheit auftreten können. b) Der Gesellschaftsvertrag kann grundsätzlich formlos, als auch stillschweigend geschlossen werden. Enthält er aber formbedürftige Leistungsversprechen, wie zum Beispiel die Verpflichtung zur Grundstücksübereignung in das Gesellschaftsvermögen, dann bedarf der ganze Vertrag der Form gem. § 313 BGB. c) Das BGB behandelt den Gesellschaftsvertrag als Schuldvertrag, das zeigt die Regelung im besonderen Teil des Schuldrechts. Auf den Gesellschaftsvertrag sind deshalb im Grundsatz die allgemeinen Vorschriften über Verträge und Willenserklärungen ebenso anzuwenden wie die allgemeinen schuldrechtlichen Vorschriften des BGB. Der Gesellschaftsvertrag ist ein gegenseitiger, verpflichtender Schuldvertrag, weil sich die Parteien, wie § 705 BGB ausdrücklich hervorhebt, gegenseitig verpflichten, die Erreichung des gemeinsamen Zwecks zu fördern. Grundsätzlich sind danach die §§ 320 ff BGB anwendbar, wenn es in Erfüllung gesellschaftsvertraglicher Hauptpflichten zu Leistungsstörung kommt. Soweit die §§ 320 ff BGB keine Anwendung finden können, gelten für Leistungsstörung die §§ 275 ff BGB, z. B. bei Verzug mit einer Leistungspflicht § 286 I BGB, bei Unmöglichkeit der Leistung §§ 275/280 BGB.
Der Gesellschaftsvertrag schafft aber nicht nur schuldrechtliche Beziehungen. Das ist nur seine eine Seite; insoweit bildet er die Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses als Dauerschuldverhältnis. Hinzu kommt, daß er den Zusammenschluß von Personen begründet und damit das soziale Gebilde entstehen läßt. Zweifelhaft ist
indes, wieweit diese Verselbständigung geht. Dabei kann es heute als gesichert gelten, daß keine Personengesellschaft juristische Person ist. Die Vereinheitlichung des Personenzusammenschlusses geht deshalb nach bisher vorherrschendem Verständnis nur soweit, wie das Gesamthandsvermögen gilt.
Haftung:
Gemeinschaftliche Verbindlichkeiten der Gesellschafter können sich im Innenverhältnis aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben; gegenüber Dritten können sie folgendermaßen entstehen: 1) rechtsgeschäftlich oder 2) unmittelbar durch Gesetz. Namentlich für Vertragsverletzungen wie Leistungsstörung , culpa in contrahendo (c.i.c. – vor-vertragliche Vertragsverletzung) und unerlaubte Handlung, die die Gesellschafter nicht alle gemeinsam begangen haben, bedeutet dies, daß außer dem ( den) handelnden Gesellschafter(n)die andern nur dann verpflichtet sind, wenn eine Zurechnungsnorm dies anordnet. Verbindlichkeiten, die von allen Gesellschaftern geschuldet werden, werden im allgemeinen Gesamtschulden sein gem. §421 BGB. Es sind aber auch Teilschulden denkbar gem. § 420 i.V.m. § 427 BGB auch § 733 I BGB. Außerdem kommen Fälle vor, in denen die Primärverbindlichkeiten nicht von einem einzelnen Gesellschafter erfüllt werden können, die Leistung vielmehr nur von allen gemeinsam erbracht werden kann ( Gesamthandsschulden).
Doppeltes Haftungsobjekt: Als doppeltes Haftungsobjekt kommen das jeweilige Privatvermögen der einzelnen Gesellschafter und das davon gesonderte Gesellschaftervermögen in Betracht.
2.2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung gem. HGB und GmbHG
Eine GmbH ist Kapitalgesellschaft und eine rechtsfähige juristische Person gem. § 13 I GmbHG. Sie ist Handelsgesellschaft und damit Formkaufmann gem. § 6 HGB. Die GmbH entsteht als solche mit Eintragung in das Handelsregister § 11 GmbHG. Dazu bedarf es eines notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag. Für den Existenzgründer oder die Gründerin verbindet sich mit dieser Rechtsform ein besonderes psychologisches Phänomen: Es besteht ein sogenannte „Dreifaltigkeit“. Es gibt die GmbH als juristische Person, es gibt einen oder mehrere Gesellschafter sowie einen oder mehrere Geschäftsführer. Die GmbH braucht ( wie eben erläutert ) mind. einen Geschäftsführer, der Gesellschafter sein kann ( Fremdorganschaft). Der Geschäftsführer ist zur Vertretung und Geschäftsführung berufen. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbHG, die ihre Beschlüsse in der Regel mit einfacher Kapitalmehrheit faßt. Ihre Befugnisse ergeben sich aus den §§ 45 – 53 GmbHG. Eine GmbH kann zusätzlich einen Aufsichtsrat haben, wenn der Gesellschaftervertrag dies vorsieht. Es können auch Beiräte mit unterschiedlichen Aufgaben und Kompetenzen gebildet werden. Die Gesellschafterstellung ist im Geschäftsanteil verkörpert. Dieser ist gem. § 14 GmbHG frei übertragbar. Die wichtigsten Gesellschafterreechte sind das Gewinnbeteiligungsrecht § 29 GmbHG, die Mitbestimmungsrechte gem. § 45 GmbHG, die Informationsrechte gem. § 51a GmbHG sowie die Minderheitsrechte gem. § 50 GmbHG. Als Gesellschafterpflichten sind zu nennen die allgemeine Treuepflicht, die Pflicht zur Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung sowie die Nachschußpflicht gem. § 26 GmbHG.
Haftung:
Für die Haftung gegenüber Dritten gilt:
Aufgrund ihrer Rechtsfähigkeit ist die GmbH selbst ( alleiniger) Anspruchsgegner für alle Gesellschafterverbindlichkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund. Die Gesellschafter haften daneben grundsätzlich nicht, sie sind allerdings gegebenenfalls der Gesellschaft gegenüber zur Leistung verpflichtet. Geschäftsführer haften Dritten gegenüber nicht unmittelbar. Besonderheiten gelten in den verschiedenen Gründungsstadien der GmbH. Zu der Haftungsproblematik der Vor-GmbH werde ich in Punkt 3 Gründungsstadien der GmbH genauer eingehen. Nur soviel: für ihre Verbindlichkeiten haftet die Vor-GmbH mit ihrem gesamthänderisch gebundenen Vermögen. Dieses führt in der Praxis nicht zur Befriedigung der Gläubiger. Vielmehr spielt die Unterbilanz- oder die Vorbelastungshaftung der GmbH Gesellschafter ein Rolle. Voraussetzungen dafür sind: Differenz zwischen dem Stammkapital und dem Wert des Gesellschaftervermögens zum Zeitpunkt der Eintragung. Rechtsfolgen sind: Anspruch der GmbH auf Ausgleich der Kapitallücken bis zur Höhe des Stammkapitals – Innenhaftung gegebenenfalls Ausfallhaftung der übrigen Gesellschafter. (mehr dazu in Punkt 3)
Die GmbH wird in zweistufigen verfahren durch Auflösung und Liquidation sowie nachfolgende Löschung aus dem Handelsregister beendet §§ 60 ff GmbHG.
2.3 Entscheidung für die GmbH
Die zukünftigen Unternehmer haben sich entschlossen die Rechtsform der GmbH zu verwenden. Auch wenn diese am Anfang sehr kostspielig ist, sind sie doch bei evtl. Insolvenz auf der sicheren Seite da, dann nicht wie bei der GbR auch aus dem Privatvermögen der Gesellschafter gepfändet werden kann. Auch haben die Gesellschafter bei der GmbH mehr Rechte als bei der GbR ( wie oben aufgeführt).
3 Gründungsphase der GmbH
Der Gesellschaftszweck der Vorgründungsgesellschaft ist die Gründung der späteren GmbH. Die Vorgründungsgesellschaft betreibt deshalb in der Regel kein Handelsgewerbe. Sie ist daher im Normalfall Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Enthält der Vorgründungsvertrag die Verpflichtung der Gesellschafter, die GmbH zu gründen, so bedarf er entsprechend § 2 GmbHG der notariellen Beurkundung. Die Vorgründungsgesellschaft endet mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages. Die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Vorgründungsgesellschaft bleibt aber bestehen. Hat sie bereits Vermögensgegenstände erworben, die der späteren GmbH zustehen sollen, müssen diese im Wege der Einzelrechtsnachfolge auf die GmbH übertragen werden. Die Vorgesellschaft (Vor- GmbH) entsteht mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages. Sie ist nicht identisch mit der späteren GmbH § 11 GmbHG, sondern Organisationsform eigener Art ( sui generis), deren Rechtsverhältnisse sich nach einem Sonderrecht richten.
Die Vorgesellschaft kann als solche am Rechtsverkehr teilnehmen, an sie müssen Bar- und Sacheinlagen geleistet werden, so dass sie sowohl konto- als auch grundbuchfähig sein kann. Mit der Eintragung der GmbH in das Handelsregister gehen alle Aktiva und Passiva der Vor-GmbH auf die GmbH über. Es erfolgt ein Statuswechsel. Gelangt die GmbH durch Eintragung zur Entstehung so gilt: das Konzept der sogenannt Vorbelastungs- oder Unterbilanz. Danach haften die Gründungsgesellschafter, wenn sie übereinstimmend den Geschäftsführer ermächtigt haben, bereits vor der Eintragung der Gesellschaft den Geschäftsbetrieb aufzunehmen, gegenüber de GmbH anteilig in Höhe der im Zeitpunkt der Eintragung vorhandenen Differenz zwischen dem Stammkapital und dem Wert des Gesellschaftervermögens. Diese Binnenhaftung ist nicht auf die Einlage des Gesellschafters und auch nicht auf die Höhe des Stammkapitals begrenzt. Die Haftung ist verschuldensunabhängig. Daneben haftet selbstverständlich die GmbH selbst mit dem Gesellschaftsvermögen. Auf sie sind die Verbindlichkeiten der Vor – GmbH übergegangen. Die Haftung der Vor – GmbH erlischt.
4 Standortwahl
Da die GmbH nicht auf Laufkundschaft angewiesen sein wird, spielt die Standortwahl eine untergeordnetere Rolle. Obwohl wir drei uns dabei alle einig sind, das die GmbH in der Hansestadt Rostock gegründet und errichtet werden soll. Es ist schließlich die größte Stadt in Mecklenburg Vorpommern und außerdem hat die Stadt eine gute Verkehrsanbindung im Gegensatz zu manch anderen Städten des Landes. Des weiteren ist es nicht notwendig, dass das Geschäft in einer Toplage liegt wie beispielsweise Warnemünde oder die Kröpeliner Strasse. Es muß jedoch darauf geachtet werden, das die Kunden gut mit ihrem Auto, mit der S- Bahn oder mit dem Bus zur GmbH kommen. Aus diesem Grunde haben sich die zukünftigen Unternehmer die Industriestrasse als Standort ausgewählt. Es gibt in dieser Strasse (Umgebung) keine ähnliche Unternehmung die den gleichen Service anbieten wie die drei ehemaligen Studenten es anbieten möchten.
5 Finanzierung/ Investitionsplanung
Häufig unterschätzen Existenzgründer die Kosten, die beim Aufbau des eigenen Unternehmens entstehen, dies führt dazu, dass mit der Hausbank über eine zu geringe Investitionssumme verhandelt wird.
Um nun genügen Kapital zu haben ist man bei der Gründung von Unternehmen auf Hilfe von außen angewiesen. Der Bund und die Länder unterstützen Existenzgründer, indem sie zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften bereitstellen, um das Startkapital bei Existenzgründern zu decken bzw. zu erhöhen. Die öffentlichen Fördermittel von Bund und Ländern können in der Regel kombiniert werden. Der Bund stellt Existenzgründern Finanzierungsmittel über die Deutsche Ausgleichsbank zur Verfügung. Diese vergibt Gelder, die sich im wesentlichen auf die langfristigen im Unternehmen verbleibenden Investitionsgüter der Unternehmensgründung beziehen. ( als solche gelten –der Ankauf von Grundstücken, - der Ankauf oder die Errichtung von Betriebsgebäuden, - der Umbau und die Renovierung von Gewerberäumen, - Einrichtungen und maschinen, - Lizenzen und Patente, - Fahrzeuge, - Lagerinvestitionen, - der Kaufpreis eines Unternehmens bei Firmengründung, - Einsteigergebühr für Franchise- Unternehmen) Der Existenzgründer selbst als natürliche Person, nicht etwa die geplante Firma beantragt die Mittel zur Existenzgründung, möchten sich mehrere Existenzgründer gemeinsam selbständig machen, so stellt jeder Gründer einen Antrag in bezug auf seinen Anteil an den Kosten der Gründung. Der Zeitpunkt des Antrags auf finanzielle Hilfe zur Existenzgründung muß vor der offiziellen Gründung liegen. Dieses bedeutet, das Unternehmen darf rechtlich noch nicht gegründet sein, es dürfen auch noch keine Investitionen vorgenommen und auch noch keine Geschäfte getätigt worden sein. In jedem Einzelfall prüft die Deutsche Ausgleichsbank, ob der Existenzgründer die erforderliche fachliche und kaufmännische Qualifikation für sein Gründungsvorhaben vorweisen kann. Soll der Bund finanzielle Mittel zur Existenzgründung zur Verfügung stellen, muß es sich bei dem angestrebten Betrieb um eine Vollexistenz handeln. Dies bedeutet, dass das Unternehmen nicht oder nicht mehr nebenberuflich geführt wird. In den alten Bundesländern finanziert die Deutsche Ausgleichsbank Gründungsvorhaben nur wenn 15 % der von ihr finanzierbaren Kosten der Existenzgründung durch Eigenkapital abgedeckt werden können. In den neuen Bundesländern werden Förderanträge genehmigt, wenn die 15 % Eigenkapital nicht vorhanden sind. Das
Eigenkapital eines Gründers kann aus Barmitteln oder aus Sachmitteln bestehen. Es ist aber in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung darauf hinzuweisen, dass der Bund Kapital zur Existenzgründung nur solchen Personen zur Verfügung stellt, die das Gründungsvorhaben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren können. Es werden auch nur solche Gründer vom Staat gefördert, die persönlich nicht verschuldet sind.
Demnach sollten also alle 3 einen Existenzgründerantrag stellen.
Ein Unternehmen sollte man auch nur gründen, wenn man neben den Bankkrediten noch andere Kredite erhält.
5.1 Eigenkapital/Eigenkapitalhilfen
Eigenkapital:
Das bilanzielle rechnerische Eigenkapital umfaßt den aus der Bilanz zu ermittelnden Saldo zwischen Vermögen und Schulden.
Eigenkapitalhilfen:
Der Bund fördert durch die Gewährung von Eigenkapitalhilfe sowohl gewerbliche als auch freiberufliche Existenzgründungen. Mit der Eigenkapitalhilfe stockt der Bund das Eigenkapital um bis zu 40 % der förderfähigen Finanzierungskosten der Investitionen auf.
Außerdem gibt es noch unterschiedliche Existenzgründerprogramme wie bspw das
ERP – Programm ( European Recovery Programm = europäisches Wirtschaftsprogramm)
Wird eine gewerbliche Existenz gegründet, so stellt der Bund auch weitere Mittel aus dem ERP – Vermögen zur Verfügung. Diese Mittel sind in der Regel etwa 2% billiger als normale Bankkredite.
Des weiteren gibt es auch eine Eigenkapitalbildung im Unternehmen mit Hilfe öffentlicher Mittel.
Für diese Mittel müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Eine weitere Vertiefung würde an dieser Stelle den Rahmen der Hausarbeit „sprengen“ . Ich denke entsprechende Informationsschriften sind beim Wirtschaftsministerium des Landes M-V zu erhalten.
5.2 Fremdfinanzierung/ Kreditfinanzierung
Die Fremdfinanzierung dient dazu, dem Unternehmen Fremdkapital zuzuführen. Es handelt sich also um eine Außenfinanzierung. Das Fremdkapital geht nicht in das Eigentum des Unternehmens über, sondern begründet eine schuldrechtliche Verbindung zwischen dem Unternehmen als Schuldner und dem Kapitalgeber als Gläubiger. Entsprechend fällt das Fremdkapital bei einer Auseinandersetzung nicht unter das Auseinandersetzungsvermögen, bei einem Konkurs hingegen ist es der Konkursmasse zuzurechnen.
Fremdfinanzierung wird unterschieden in kurzfristige Fremdfinanzierung ( Handelskredite, Bankkredite als Geldkredite, Bankkredite als Kreditleihen, Bankkredite im Außenhandel und Sonderformen wie Factoring und Forfaitierung – um nur die Oberbegriffe zu nennen) und in langfristige Fremdfinanzierung (auc hier gehe ich nur auf die Oberbegriffe ein: Darlehen, Schuldscheindarlehen, Anleihen, Außenhandelskredite und Sonder formen wie Leasing und Franchising).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Ideenumsetzung?
Die Ideenumsetzung beschreibt den Weg von drei ehemaligen Kommilitonen, die nach mehrjähriger Berufserfahrung den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Sie basieren ihre Gründung auf einer Diplomarbeit über den Bedarf an IT-Kräften in Mecklenburg-Vorpommern und erkennen einen großen Bedarf.
Wie wird die Frage beantwortet, ob die Gründer den Anforderungen gewachsen sind?
Die Gründer analysieren ihr vorhandenes Wissen in Bereichen wie Betriebswirtschaft, Recht, Informatik und Personalwesen, um festzustellen, ob sie den Anforderungen an die Unternehmensführung gerecht werden können. Sie stellen fest, dass ihre individuellen Kompetenzen die erforderlichen Bereiche größtenteils abdecken.
Was ist das Produkt, das das Unternehmen anbietet?
Das Unternehmen bietet keine standardisierten Produkte, sondern individuell angepasste Lösungen und Dienstleistungen für Kunden, insbesondere in den Bereichen Webdesign, Softwareanalyse und Fehlerbehebung.
Welche Marktchancen werden gesehen?
Die hohe Nachfrage nach Programmierern in Deutschland, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, wird als große Marktchance gesehen. Das Unternehmen möchte diese Nachfrage bedienen, indem es spezialisierte Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen anbietet.
Welche Rechtsformen werden in Betracht gezogen?
Es werden die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) als Personengesellschaft und die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) als Kapitalgesellschaft in Betracht gezogen.
Was sind die wesentlichen Merkmale einer GbR?
Die GbR entsteht durch einen Vertrag zwischen zwei oder mehr Personen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen und dessen Förderung sich alle Vertragspartner verpflichten. Die Gesellschafter haften gemeinschaftlich.
Was sind die wesentlichen Merkmale einer GmbH?
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und juristische Person, die mit der Eintragung ins Handelsregister entsteht. Sie benötigt einen notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag und mindestens einen Geschäftsführer. Die Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt.
Warum wurde die GmbH als Rechtsform gewählt?
Die GmbH wurde gewählt, weil sie im Falle einer Insolvenz einen besseren Schutz des Privatvermögens der Gesellschafter bietet als die GbR. Außerdem haben die Gesellschafter in einer GmbH mehr Rechte.
Wie sieht die Gründungsphase der GmbH aus?
Die Gründungsphase umfasst die Vorgründungsgesellschaft, die sich mit der Gründung der GmbH befasst, und die Vorgesellschaft (Vor-GmbH), die mit dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags entsteht. Mit der Eintragung der GmbH ins Handelsregister gehen alle Aktiva und Passiva der Vor-GmbH auf die GmbH über.
Welche Rolle spielt die Standortwahl?
Die Standortwahl spielt eine untergeordnete Rolle, da das Unternehmen nicht auf Laufkundschaft angewiesen ist. Dennoch wurde Rostock als Standort gewählt, da es die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist und eine gute Verkehrsanbindung bietet. Die Industriestraße wurde als konkreter Standort ausgewählt, weil es dort kein vergleichbares Unternehmen gibt.
Wie sieht die Finanzierungs- und Investitionsplanung aus?
Es wird betont, dass Existenzgründer die Kosten oft unterschätzen. Daher ist es wichtig, ausreichend Kapital zu beschaffen, gegebenenfalls durch öffentliche Förderprogramme und Kredite. Es wird empfohlen, für die Existenzgründung einen Antrag zu stellen, um Fördermittel zu erhalten.
Welche Möglichkeiten der Eigenkapitalhilfe gibt es?
Der Bund fördert Existenzgründungen durch Eigenkapitalhilfe, bei der das Eigenkapital um bis zu 40 % der förderfähigen Finanzierungskosten aufgestockt wird. Es gibt auch verschiedene Existenzgründerprogramme, wie das ERP-Programm.
Welche Formen der Fremdfinanzierung gibt es?
Es wird zwischen kurzfristiger und langfristiger Fremdfinanzierung unterschieden, wobei verschiedene Kreditformen wie Handelskredite, Bankkredite, Darlehen, Schuldscheindarlehen und Leasing in Betracht kommen.
- Quote paper
- Jenny Teuteberg (Author), 2001, Die Gründung einer Fiktivfirma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102255