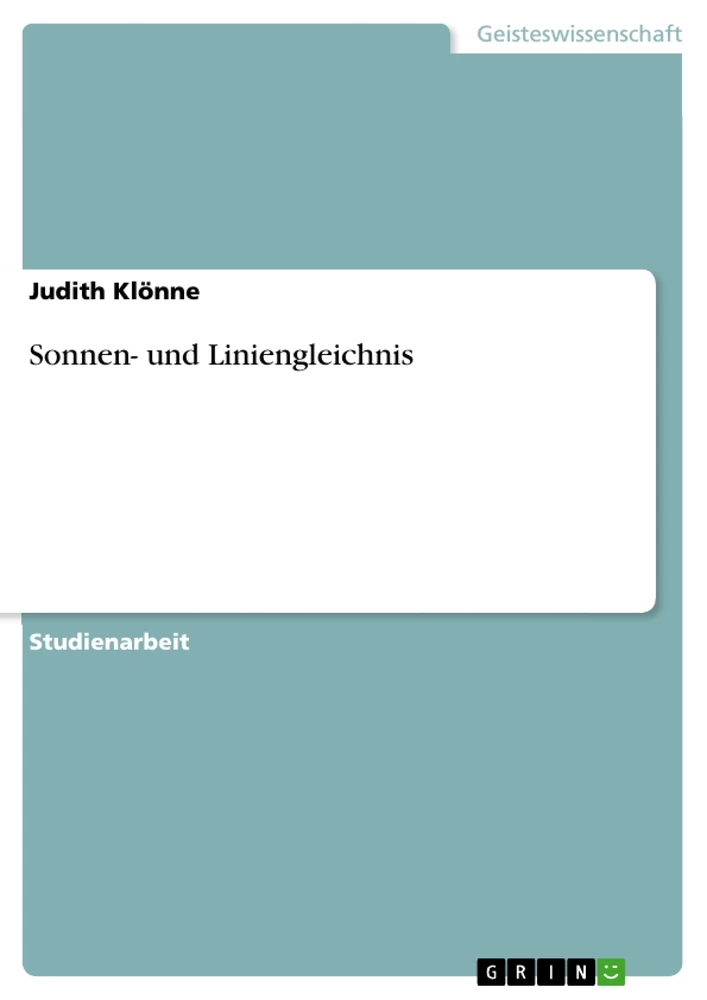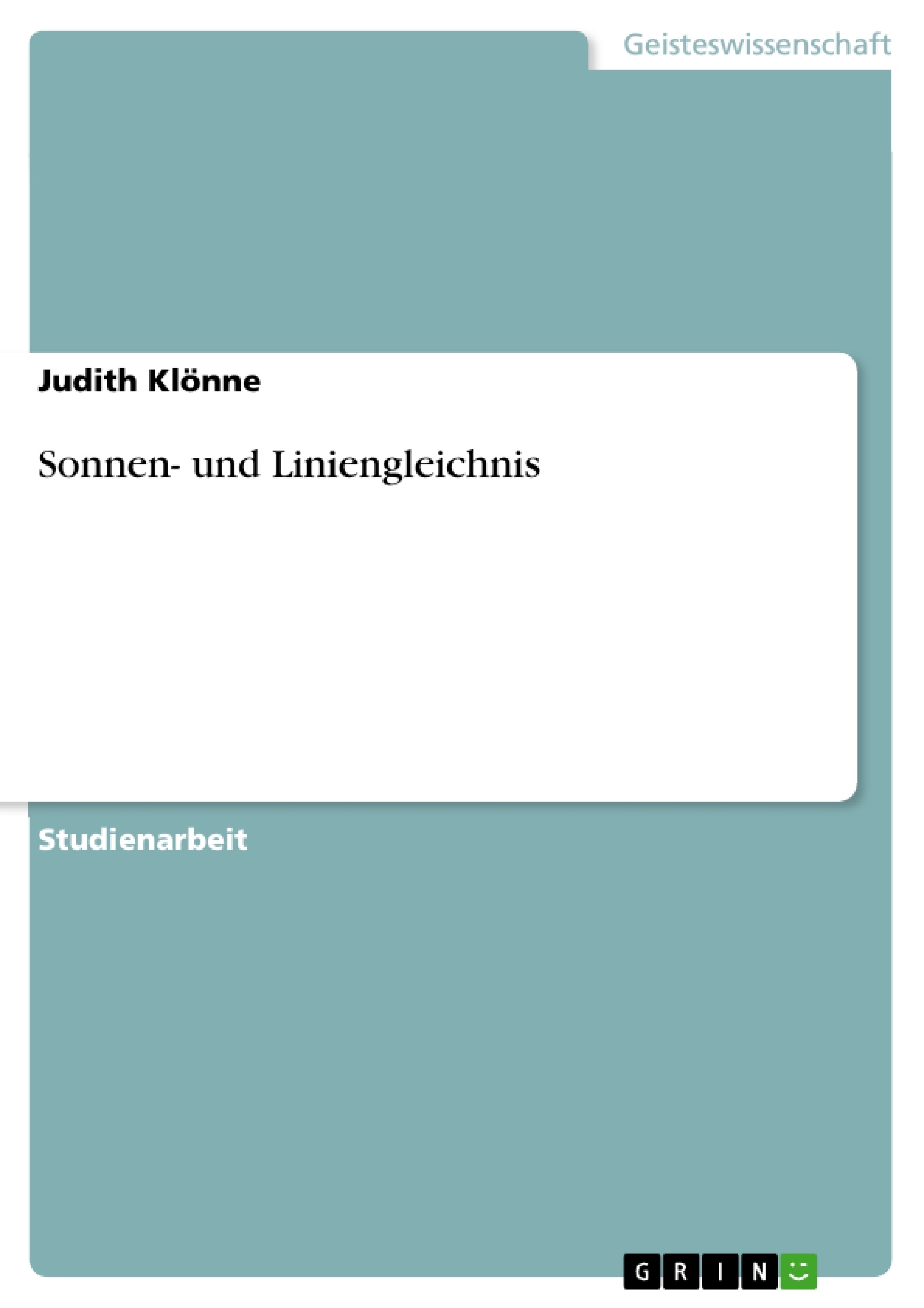Sonnen- und Liniengleichnis
1 Einleitung
In meiner schriftlichen Ausarbeitung des Seminarreferates vom 16.10.2000 werde ich Platons Sonnen- und das Liniengleichnis aus dem 6. Buch des Staates (politeia) darstellen.
Platon veranschaulicht hier seine Ideenlehre anhand dieser Gleichnisse.
Ich werde desweiteren nach Faktoren suchen, die Platon zu seiner Theorie veranlaßt haben könnten. Hierbei werde ich einerseits die politische und gesellschaftliche Situation zur Lebenszeit Platons darlegen und andererseits einige Ansätze verschiedener Philosophen berücksichtigen, die vor Platon gelebt haben.
2 Gesellschaftliche und philosophische Voraussetzungen
Um deutlich und erklärbar zu machen, wodurch Platon zur Entwicklung seiner Ideenlehre kommt, werde ich einen kurzen Überblick geben über die gesellschaftspolitische Situation seiner Zeit. Weiterhin werde ich die Ansätze einiger philosophischer Strömungen vorstellen, die vermutlich Einfluß auf Platons Entwicklung genommen haben.
2.1 Gesellschaft und Politik
Platon lebte etwa von 427 bis 347 vor Christus.
Um 400 v. Chr. galten die griechischen Kolonien an den Mittelmeerküsten als Wiege der Philosophie. Die Voraussetzungen hierfür waren optimal, denn durch den regen Handel der Kolonialstaaten gelangten diese zu Wohlstand und kamen in Kontakt mit fremden Kulturen und deren Wissenschaften. Hierdurch entwickelten sich Toleranz und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Weltanschauungen, Staatsformen und verschiedenen philosophischen und religiösen Richtungen.
Die griechischen Stadtstaaten selbst lebten in einem losen Verbund, deren Bürger die sogenannte Polis bildeten.
Zur Zeit Platons allerdings zeigten sich Ansätze des Niedergangs eben dieser Polis als sozialer Gesamtordnung. Es kam zu Spannungen und Kriegen zwischen einzelnen Stadtstaaten, es wurden Machtkämpfe ausgetragen zwischen verschiedenen Parteien und Anhängern neuer politischer Formen.
Zudem wechselten verschieden Staatsformen. So herrschte zeitweise die Oligarchie, dann wieder die Demokratie.
Bei der Oligarchie herrscht eine Gruppe, die sich durch Reichtum bzw. durch Adel auszeichnet. Es regieren also nicht die Besten und Fähigsten, sondern solche, deren Interesse vorrangig ihrem eigenen Profitstreben gilt. Damit wird die Rivalität zwischen arm und reich noch verschärft.
Demokratie geht aus der Oligarchie hervor, wenn die Armen innerhalb des Klassenkampfes den Sieg über die Reichen davontragen und die Gegenpartei verbannen.
Auch hier regieren also nicht die Besten und Fähigsten. Grundregeln dieser Staatsform sind Freiheit und unbeschränkte Meinungsäußerung. Platon bezeichnet dies als „vergnügliche“ Verfassung, die eine angebliche ,aber tatsächlich nicht gegebene Gleichheit postuliert.
Platon hat beide Staatsformen kennengelernt, sowie zusätzlich die der Tyrannei (Gewaltherrschaft).
Diese Diskontinuität in der Politik übertrug sich auch auf die Gesellschaft. Gesetze wurden nicht unbedingt als verbindlich angesehen, da sie nicht von Dauer waren, sondern mit den und innerhalb der verschiedenen Staatsformen wechseln konnten. Insofern war die Gerechtigkeit des Staates in Frage gestellt.
Auch innerhalb der Religion vollzieht sich in jener Zeit sich ein Wandel. Die Götter verlieren an Bedeutung , so daß auch hier keine sittliche Grundlage mehr zu finden ist.
Dieser Wandel vom Mythos zum Logos wird schon bei Protagoras (~485 -415 v. Chr.) deutlich, der sagt: „Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder daß sie sind, noch daß sie nicht sind.“ (Diels, 1963, S.124)
Insgesamt vollzieht sich eine geistige Neuentwicklung der Gesellschaft.
Das Maß der Dinge ist nun nicht mehr der Staat mit seinen Gesetzen und auch nicht die Religion, sondern der Mensch , das Individuum selbst.(Vgl. Protagoras) Es setzt sich ein maßloser Individualismus durch, dessen höchste Weisheit das Ausleben der eigenen Instinkte darstellt.
Diese Haltung wird vor allem von den Sophisten vertreten und unterstützt. Sie gewinnen großen Einfluß auf die Gesellschaft.
Als Vertreter dieser Philosophie sind beispielsweise Protagoras, Hippias, Prodikos und Gorgias zu nennen.
Sie sind beliebt beim Volk, das sie gegen Bezahlung vor allem in der Redekunst lehren. Dabei geht es nicht vorrangig um die Suche nach Wahrheit, sondern darum, sich durch geschickte Argumentation Vorteile zu verschaffen.
Auch hier wird wieder der „Paradigmenwechsel“ deutlich, d.h. daß nun der Mensch und nicht Gott als Maß gilt. Wieder werden also alte Normen relativiert.
2.2 Frühere Philosophen
Nicht nur die eigene gesellschaftliche und politische Situation beeinflußte Platon dahingehend, seine Annahme der Ideen zu entwickeln.
Er lernte auch frühere Philosophen und deren Theorien kennen.
Sein erster Lehrer, Kratylos, war ein Anhänger des Heraklit (~550-480 v. Chr.).Dieser schaute auf das Werden als Prinzip und leugnete zugleich das Sein überhaupt, da es seiner Ansicht nach nirgends ein bestehendes Sein gäbe; denn „alles fließt“. (Vgl.Varga von Kibed, 1977, S.73ff.) Hier kommt Platon also mit der Erkenntnis in Kontakt, daß es - zumindest in der bestehenden mit den Sinnen wahrnehmbaren Welt- nichts dauerhaft Gleichbleibendes gibt.
Im Gegensatz dazu steht die Annahme des Permenides (~540-480 v.Chr.). Dieser geht nämlich davon aus, daß selbst das, was nur gedacht werden kann, auch existiert; wenn nicht in der wahrnehmbaren Welt, dann eben -durch das Denken erfaßbar- in der transzendentalen Welt.
In dem Zusammenhang führt er auch an, daß der Wahn/ Sinnestrug ein „mangelndes Sein“ darstellt.
Hier lernt Platon also die Idee einer transzendentalen Welt kennen, die nur durch das Denken zu erfassen ist.
Eine weitere Gruppe von Philosophen stellte der Bund der Pythagoreer dar. Ihre Anhänger gingen von der Zahl als dem Wesen aller Dinge aus, da diese abstrakt ist. Sie strebten die Wahrheit bzw. ein allgemeinnes Prinzip an , indem sie weitestgehend abstrahierten und das Allgemeine in den Dingen suchten.
Hier ist schon ein Bezug zu Platons Liniengleichnis herstellbar, mit dem er einen bestimmten Grad von Abstraktheit zu verdeutlichen sucht.
Desweiteren war Platon auch die Weltanschauung des Empedokles (~490-430v.Chr.) bekannt, welcher von der Existenz zweier Welten ausging, nämlich der sinnlich/weltlichen und der übersinnlich/überirdischen Welt.
Diesen Dualismus finden wir auch in Platons Theorie, also sowohl im Sonnen- als auch im Liniengleichnis.
Anzuführen sind zusätzlich noch die Eleaten mit ihrer Lehre vom wahren, d.h. unveränderlichen Sein.
Den unbestreitbar größten Einfluß auf seine Entwicklung aber hatte Platons Lehrer Sokrates (469-399v.Chr.) Er fragte danach, wie wir denn eigentlich leben sollten und suchte die Antwort im selbständigen Denken, indem er die richtigen Begriffe von gut, gerecht und tugendhaft etc. suchte. Er versuchte also, der sophistischen Strömung seiner Zeit ewig gleichbleibende Werte entgegenzusetzen und so eine immer geltende sittliche Grundlage zu schaffen.
Für ihn ist die Tugend (zugleich Wissen) ein Gut, vielmehr das eine unveränderliche Gute, das alles überragt und wichtiger als das Leben ist.
Die Methode zur Begriffsklärung, nämlich die Dialektik, die für Platon den ersten Schritt zum Vordringen zu den Ideen (vgl. Liniengleichnis) darstellen, findet er hier bei Sokrates.
2.3 Platons Motive
Auch Platon ging es vorrangig darum, eine Ordnung für seinen politisch und ethischmoralisch zerfallenden Staat zu schaffen.
Er selbst hatte als junger Mann genügend enttäuschende Erfahrungen mit den politischen Gruppen und deren Verfahrensweisen machen müssen. Dies beschreibt er deutlich in seinen Briefen. Dort heißt es z. Bsp.: “Als ich das alles sah und noch manches andere derart und nicht eben Kleinigkeiten, da erfaßte mich ein Widerwille, und ich zog mich von diesem verbrecherischen Regiment zurück. [...] Auch nahm die Verderbnis in der Gesetzgebung und der Sittenverfall in erstaunlicher Weise zu.“ (Briefe VII, 324B-326B) Sogar sein Freund und Lehrer Sokrates wurde von den Machthabern zum Tod verurteilt.
Ihm schien der gesamte gesetzliche Zustand nahezu unheilbar zu sein, so daß eine Neuorganisation vonnöten war. Diese Neuorganisation mußte für Platon auf einer philosophischen Grundlage stehen. Er verknüpfte somit Politik und Philosophie direkt miteinander und forderte also, daß die Machthaber Philosophen werden sollten oder die Philosophen die Macht erhalten sollten (vgl. politeia V, 473D).
Platon ist auf der Suche nach einer sittlichen Grundlage für jeden Einzelnen und somit für seinen Staat. Die auf dieser Grundlage geschaffenen Normen müssen sich dadurch auszeichnen, daß sie immer gelten, unabhängig beispielsweise davon, welche Partei gerade an der Macht ist und unabhängig von jeglichen geistigen Strömungen in der Gesellschaft.
Er sucht Werte, auf die man sich jederzeit berufen kann, einen objektiven Maßstab, der über menschliche Triebe, Wünsche und Begierden erhaben ist. Folglich eine Welt, die über der sinnlichen steht.
Diese findet er in der unveränderlichen Welt der Ideen als Gegensatz zur sinnlich erfahrbaren Welt.
Mit dem Sonnengleichnis versucht er zum einen, diese beiden Welten vorzustellen, aber auch -und dies wird im Liniengleichnis weiter ausgeführt- den Weg zur Schau und zur Erkenntnis dieser Ideen aufzuzeigen.
3 Beschreibung und Deutung der Gleichnisse
Wie unter 2.3 schon angedeutet, ist das Hauptanliegen Platons die möglichst umfassende Bildung der künftigen Herrscher des von ihm angestrebten Idealstaates: „Es sollen die zur Regierung Berufenen in vielen Wissenschaften geübt werden, damit sich erprobe, ob sie auch für die größten (höchsten) Wissenschaften befähigt sind“(503E) Im Sonnengleichnis wird zunächst die höchste Instanz allen Wissens -und so aller Bildung vorgeführt, durch die Erkenntnis überhaupt erst ermöglicht wird.
Das nachfolgende Liniengleichnis macht die innere Struktur dieses Erkenntniskomplexes, der von der höchsten Norm geprägt wird, anschaulich. (Vgl. Schmalzriedt, 1969, S.299) Im folgenden werde ich zunächst das Sonnengleichnis und anschließend das Liniengleichnis aus dem 6.Buch des Staates beschreiben und erläutern.
3.1 Das Sonnengleichnis (507B- 509B)
In dem Gespräch mit Glaukon gibt Sokrates als Gesprächsführer zu verstehen, daß es ihm nicht möglich sei, das Gute direkt zu thematisieren. Vielmehr spricht er über einen „Abkömmling“ des Guten, der ihm am meisten ähnelt, nämlich die Sonne (506DE).
Das, was durch das folgende Gleichnis beschrieben werden soll, liegt in der analogen Funktion der Sonne im Bereich des Sichtbaren und der Idee des Guten im Bereich des Denkbaren.
Die Sonne also im sinnlichen Bereich ist vergleichbar mit der Idee des Guten im denkbaren Bereich. Das deutliche Sehen von Gegenständen ist nur mit Hilfe der Sonne als Lichtspenderin möglich. Sie stellt somit die Verbindung dar zwischen dem sehenden Auge und dem zu sehenden Objekt. Wenn das Licht der Sonne fehlt, ist kein Sehen möglich. Bei Mondlicht betrachtet, sieht man die Dinge nur sehr undeutlich: „...so werden sie (die Augen) stumpf und scheinen beinahe blind, als ob keine reine Sehkraft mehr in ihnen wäre.“ (508C4-7) Dieses Sehen in der sinnlichen Welt verhält sich analog zum Erkennen bzw. Nichterkennen in der denkbaren Welt:
„Wenn sie (die Seele) sich an das hält, worauf Wahrheit und Sein herabscheinen, dann erfaßt sie und erkennt und scheint Denkvermögen zu besitzen. Wenn sie sich aber an das mit der Dunkelheit Vermischte hält, an das Werdende und Vergehende, dann meint sie und blickt stumpf im Hin- und Her ihrer wechselnden Meinungen.,...Von dem nun, was dem Erkanntwerden die Wahrheit und dem Erkennenden das Vermögen (des Erkennens) gibt, sollst du sagen, daß es die Idee des Guten ist.“ (508D4-E3) Platon stellt also eine Analogie zwischen der Sonne einerseits und der Idee des Guten andererseits her. Die Sonne macht aber nicht nur das Sehen möglich , sondern sie sorgt auch dafür, daß etwas wird und entsteht. Eine Pflanze beispielsweise könnte ohne die Sonne nicht werden und entstehen, also nicht existieren. Die Sonne ist sozusagen in der Pflanze enthalten, ohne jedoch selbst die Pflanze zu sein..
Die Idee des Guten ist parallel dazu in den Ideen enthalten und ermöglicht es ihnen damit erst „zu sein“. Aber um die Ideen zu erkennen, muß auch in demjenigen, welcher erkennen will, die Idee des Guten enthalten sein -so wie die Sonne im Auge des Sehenden enthalten sein muß.(Hier liegt eine Theorie zugrunde, nach der das Auge Feuer/Sonne enthält, welches den Sehstrahl aussendet.)
Das Gute aber ist, so läßt Platon den Sokrates sagen, „nicht Wesen, sondern es steht noch jenseits des Wesens und übertrifft es an Würde und Macht.“(509B)
So bezeichnet die Idee des Guten das Prinzip, mit Hilfe dessen alle anderen Dinge, auch alles Wissen, erst nützlich werden.
Im Vorgespräch zu den Gleichnissen wird nämlich gesagt, daß z. B. das Gerechte erst durch die Mitwirkung der Idee des Guten nützlich wird. Das bedeutet für Platons idealen Staat, daß ohne diese übergeordnete Idee eigentlich alle Normen ambivalent bleiben.
Den bei Dunkelheit oder Dämmerung betrachteten Gegenständen in der sehbaren Welt stellt Platon die unklar zu erkennenden Ideen gegenüber.
Diese sind darum nicht erkennbar, weil sie „mit dem Dunkel“ vermischt sind. Dieses Dunkel drückt sich aus im Werden und Vergehen der Erkenntnisobjekte.
Platon versucht also in dem Sonnengleichnis verständlich zu machen, was er unter den Ideen und insbesondere unter der Idee des Guten versteht. Er benutzt das Gleichnis, da sich ansonsten gar nicht darstellen ließe, was er meint.
Wie man aber zur Erkenntnis dieser Ideen gelangen kann, bzw. welche Erkenntnisstufen es gibt, versucht er mit einem neuen Gleichnis zu veranschaulichen, dem Liniengleichnis.
3.2 Das Liniengleichnis (509D6-511E5)
Der Grad der Abstraktheit ist beim Liniengleichnis deutlich höher als im vorher behandelten Sonnengleichnis. Dort wurden neben den Begriffen auch Bilder verwendet, die im Liniengleichnis (abgesehen von der geometrischen Figur) verschwunden sind. Zunächst folgt eine Beschreibung des Gleichnisses:
Eine vertikale Linie wird in zwei Abschnitte unterteilt. Hierbei stell der untere den Bereich der sinnlich wahrnehmbaren Welt, der obere den denkbaren Bereich dar. Den oberen bezeichne ich mit A, den unteren mit B. A und B werden wiederum geteilt: B in dessen unteren Abschnitt B2 (Abbilder, Schatten und Spiegelbilder) und B1 (die sichtbaren Dinge selbst); A teilt sich auf in seinen unteren Abschnitt A2 (mathematische Gegenstände: Größen, Figuren, Begriffe) und in seinen oberen Abschnitt A1 (Ideen). Den vier Abschnitten werden verschiedenen Erkenntnisformen zugeordnet. Diese Formen sind für B2 Vermutung (griech. eikasia), für B1 Glauben (pistis), für A2 Nachdenken (dianoia) und für A1 die Einsicht oder Vernunft (noesis). Zusammengefaßt kann es im Bereich der sinnlichen Welt höchstens zu einer Meinung kommen. Das Wissen kann man nur in der intelligiblen Welt erlangen.
Es entsteht eine Hierarchie insofern, als daß der untere Abschnitt jeweils das Abbild des Darüberliegenden ist. Der Weg zur Erkenntnis beginnt im sichtbaren Bereich (angefangen bei B2) und vervollkommnet sich nach A1 hin. Während sich die Verstandes- und Vernunfttätigkeit dem Sein widmen und eben allein darum Erkenntnis erlangen, beschäftigen sich Vermuten und Glauben mit dem Werden (und Vergehen) und gelangen darum eben nicht über das Meinen hinaus (vgl. 511DE; 534A).
Soweit die Beschreibung des Gleichnisses.
Es nimmt Bezug auf das Sonnengleichnis, in welchem die „Lehre vom Sein“ und die Teilung in sinnliche und intelligible Welt schon vorgestellt wurden. Wie man zu den Erkenntnisformen des Meinens gelangt, ist leicht verständlich. Wir nehmen etwas mit unseren Sinnen wahr und gehen deshalb davon aus, daß es ist. Da aber zum einen unsere Sinne uns täuschen können und zum anderen die Dinge selbst im ständigen Wandel begriffen sind, können wir kein sicheres Wissen erlangen. (Vgl. Phaidon: “Wann also erfaßt die Seele Wahrheit? Denn wenn sie mit dem Leibe versucht, etwas zu betrachten, dann offenbar wird sie von diesem betrogen.“) Mit dem stufenähnlichen Aufsteigen von B2 zu A1 zeigt sich ein Zunehmen der Qualität des Seins. Mit jeder Stufe nimmt die Klarheit durch Abnahme der „Verunreinigungen“ zu.
Schwieriger ist zu erklären, wie man zur höchsten Erkenntnisform, zur Einsicht in die Ideen gelangt.
Zunächst sei hier geklärt, was Platon unter Ideen versteht:
Ideen haben ein ewiges, unveränderbares Sein, welche voraussetzungslos und unabhängig von Raum und Zeit sind.
Im Phaidon, 78D heißt es hierzu: “Das Gleiche an sich, das Schöne an sich, und so jegliches, was an sich ist, nimmt das wohl jemals auch nur irgendeine Veränderung an? Oder verhält sich nicht jedes dergleichen, was einzig in seiner Art an und für sich ist, immer auf gleiche Weise und nimmt niemals irgendeine Veränderung an? -Auf gleiche Weise.“ Kurz darauf spricht Sokrates (79A): „..., aber jene sich immer gleich verhaltenden Dinge kannst du doch auf keine andere Weise erfassen, als durch das Denken der Seele.“
Von allem existiert die Idee als eine Art Prototyp seiner vielen Einzeldinge. In unserer Welt gibt es beispielsweise die verschiedenartigsten Stühle in einer großen Vielfalt, dagegen gibt es nur eine Idee des Stuhls, gewissermaßen als Urbild, die aber in jedem einzelnen sichtbaren Stuhl enthalten ist. Umgekehrt hat jeder einzelne Stuhl teil an dessen Idee, (diese Teilhabe heißt im Griechischen methexis).
Wie aber gelangt man zur Einsicht in diese abstrakten Ideen? Hierzu werden - als Vorstufe zu den Ideen- mathematische Gegenstände und ihre Erkenntnisform beschrieben. Auch in der Mathematik geht es um abstrakte Formen und Begriffe. „Sie stellen das Abstrakteste dar, was sich denken läßt“ (Nestle, 1931, S.22) Es wird in der Geometrie immer „vom Kreis an sich“ oder „von der Linie an sich“ ausgegangen; daher können diese nicht sinnlich faßbar sein. Jeder gezeichnete Kreis dient nur der Veranschaulichung und unterscheidet sich beispielsweise in Durchmesser, Breite des Kreidestriches und anderem von anderen gezeichneten Kreisen und von der abstrakten Vorstellung des Kreises.
Durch Nachdenken in Begrifflichkeiten mit Hilfe des Verstandes gelangt man zu den mathematischen Formen.
Somit ist die Mathematik „die propädeutische Wissenschaft auf dem Weg zur reinen und echten Wissenschaft der Dialektik“ (Kluwe, 1985, S.301). Diese beinhaltet nämlich nach Platon die Antwort auf die Frage nach der Erkenntnis der Ideen. Der Unterschied zur Mathematik besteht nun darin, daß diese von Voraussetzungen bzw. von Hypothesen ausgeht, die es bei den Ideen nicht mehr gibt.
Eine klare Aussage über den Zugang zu den Ideen gibt Platon nicht. Als Voraussetzung dafür gibt er allerdings an, daß die Liebe zur Wahrheit, also zur Philosophie nötig ist. Die Methode ist die Dialektik, also das rein begriffliche Erfassen mittels der Vernunft. Im 7.Brief (342A7-344D2 beschreibt Platon selbst die Schwierigkeiten des Aufstiegs zur Ideenkenntnis.. Er sagt dort, daß die letzte Erkenntnis nicht als Lehrgegenstand mitteilbar sei, sondern daß diese nach langer gemeinsamer Bemühung im Gespräch plötzlich aufleuchte. Jenes eigentlich Gemeinte lasse „sich doch in keiner Weise, wie andere Kenntnisse, in Worte fassen“. Nur „vermöge der langen Beschäftigung mit den Gegenständen und dem Sichhineinleben“ erzeuge sich die Erkenntnis in der Seele „wie ein durch einen abspringenden Feuerfunken plötzlich entzündetes Licht“. Platon geht davon aus, daß man die Ideen aufgrund einer Wiedererinnerung schaut. Vor der Geburt nämlich schaute die Seele des Menschen die Ideen in ihrer Vollkommenheit. Dieses „Wissen“ behält der Mensch als apriorischen Besitz, ist sich dessen aber nicht bewußt, eben bis er wieder daran erinnert wird. Damit ist nicht die Sinnlichkeit der Ursprung, sondern die Vernunft. (Vgl. Varga von Kibed, 1977, S.73ff.) Hier -bei der Erkenntnis der Ideen- gibt es keine Voraussetzungen mehr und es bedarf somit auch keiner Begründung aus einem höheren Prinzip. „Dies ist derselbe Punkt, der im vorigen Gleichnis als Idee des Guten bezeichnet worden war.“ ( Görgemann, 1994, S.92)
4. Fazit
Platons Ziel war es, etwas Unveränderliches zu finden, das dauerhaft Gültigkeit besitzt.. Ausgangspunkt waren für ihn vor allem die Politik und die Gesellschaft seines Staates Griechenland. Hierfür wollte er eine neue sittliche Grundlage schaffen, die aber nicht auf der empirischen Welt beruhen durfte, da diese ständigen Veränderungen unterworfen ist. Theoretisch hat er diese Grundlage in den Ideen und der Idee des Guten gefunden und diese im Sonnen- und im Liniengleichnis dargestellt.
Diesen von ihm vorgegebenen Weg zur Erkenntnis zu beschreiten, bzw. zu dessen höchsten Punkt zu gelangen, hält er selbst aber für sehr schwierig. Im Parmenides, 135A heißt es: „[...]wenn diese Ideen der Dinge sein sollen und jemand jedes an sich als Begriff setzen will. So daß, wer es anhört, bedenklich werden muß und bestreiten, daß es dergleichen überhaupt gäbe, oder wenn ja, daß sie ganz notwendig der menschlichen Natur unerkennbar sein müßten[...] Und sehr wohlbegabt muß der sein, der dies soll begreifen können, daß es eine Gattung gibt jedes einzelnen und ein Wesen an sich; noch vortrefflicher aber der, welcher es herausfindet und dies alles gehörig auseinandersetzend auch andere lehren kann.“
Wenn überhaupt, ist dies nur den Philosophen möglich, so daß notwendigerweise der Regent/ die Regenten des Staates Philosophen sein müssen. Nur sie sind ja fähig, die von Platon in den Ideen beschriebenen sittlichen Grundlagen an den Staat weiterzugeben, bzw. durch danach geschaffene Gesetze zu vermitteln.
4 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Sonnen- und Liniengleichnis"?
Der Text behandelt Platons Sonnen- und Liniengleichnis aus dem 6. Buch des Staates (politeia). Er erläutert Platons Ideenlehre anhand dieser Gleichnisse und untersucht, welche Faktoren Platon zu seiner Theorie veranlasst haben könnten. Dabei werden die politische und gesellschaftliche Situation zur Lebenszeit Platons sowie Ansätze verschiedener Philosophen berücksichtigt, die vor Platon gelebt haben.
Welche gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen führten zur Ideenlehre Platons?
Platon lebte in einer Zeit des Umbruchs, in der die griechische Polis als soziale Gesamtordnung im Niedergang begriffen war. Es gab Spannungen und Kriege zwischen den Stadtstaaten, Machtkämpfe zwischen Parteien und wechselnde Staatsformen (Oligarchie, Demokratie, Tyrannei). Gesetze wurden nicht als verbindlich angesehen, und die Religion verlor an Bedeutung. Es setzte sich ein maßloser Individualismus durch, der von den Sophisten vertreten wurde.
Welchen Einfluss hatten frühere Philosophen auf Platons Ideenlehre?
Platon lernte die Theorien verschiedener Philosophen kennen, darunter Heraklit (alles fließt), Permenides (Existenz einer transzendentalen Welt), die Pythagoreer (Zahlen als Wesen der Dinge), Empedokles (Existenz zweier Welten) und Sokrates (Suche nach ewig gleichbleibenden Werten). Sokrates hatte den größten Einfluss und vermittelte Platon die Dialektik als Methode zur Begriffsklärung.
Was waren Platons Motive für die Entwicklung seiner Ideenlehre?
Platon wollte eine Ordnung für seinen politisch und ethisch-moralisch zerfallenden Staat schaffen. Er hatte enttäuschende Erfahrungen mit den politischen Gruppen seiner Zeit gemacht und war der Meinung, dass der gesamte gesetzliche Zustand unheilbar war. Er forderte, dass die Machthaber Philosophen werden sollten oder die Philosophen die Macht erhalten sollten. Er suchte eine sittliche Grundlage für jeden Einzelnen und somit für seinen Staat, die unabhängig von politischen und gesellschaftlichen Strömungen immer gelten sollte.
Was wird im Sonnengleichnis dargestellt?
Im Sonnengleichnis veranschaulicht Platon die Analogie zwischen der Sonne im Bereich des Sichtbaren und der Idee des Guten im Bereich des Denkbaren. Die Sonne ermöglicht das Sehen von Gegenständen, während die Idee des Guten das Erkennen von Wahrheit und Sein ermöglicht. Das Gute steht jenseits des Wesens und übertrifft es an Würde und Macht.
Was wird im Liniengleichnis dargestellt?
Das Liniengleichnis veranschaulicht die verschiedenen Erkenntnisstufen. Eine vertikale Linie wird in zwei Abschnitte unterteilt: den Bereich der sinnlich wahrnehmbaren Welt und den denkbaren Bereich. Diese Abschnitte werden wiederum unterteilt, und den vier Abschnitten werden verschiedene Erkenntnisformen zugeordnet: Vermutung, Glauben, Nachdenken und Einsicht/Vernunft. Das Wissen kann man nur in der intelligiblen Welt erlangen.
Was sind Ideen nach Platon?
Ideen haben ein ewiges, unveränderbares Sein und sind unabhängig von Raum und Zeit. Von allem existiert die Idee als eine Art Prototyp seiner vielen Einzeldinge. Die Idee des Stuhls ist beispielsweise das Urbild, das in jedem einzelnen sichtbaren Stuhl enthalten ist.
Wie gelangt man zur Erkenntnis der Ideen?
Platon gibt keine klare Aussage über den Zugang zu den Ideen. Als Voraussetzung nennt er die Liebe zur Wahrheit/Philosophie. Die Methode ist die Dialektik. Platon geht davon aus, dass man die Ideen aufgrund einer Wiedererinnerung schaut. Vor der Geburt schaute die Seele des Menschen die Ideen in ihrer Vollkommenheit. Das eigentliche Gemeinte lasse „sich doch in keiner Weise, wie andere Kenntnisse, in Worte fassen“. Nur „vermöge der langen Beschäftigung mit den Gegenständen und dem Sichhineinleben“ erzeuge sich die Erkenntnis in der Seele.
Was ist das Fazit des Textes?
Platons Ziel war es, etwas Unveränderliches zu finden, das dauerhaft Gültigkeit besitzt. Er wollte eine neue sittliche Grundlage für seinen Staat schaffen, die auf den Ideen und der Idee des Guten beruht. Er hält es aber für sehr schwierig, diesen Weg zur Erkenntnis zu beschreiten. Nur Philosophen sind fähig, die von Platon in den Ideen beschriebenen sittlichen Grundlagen an den Staat weiterzugeben.
- Citar trabajo
- Judith Klönne (Autor), 2001, Sonnen- und Liniengleichnis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102309