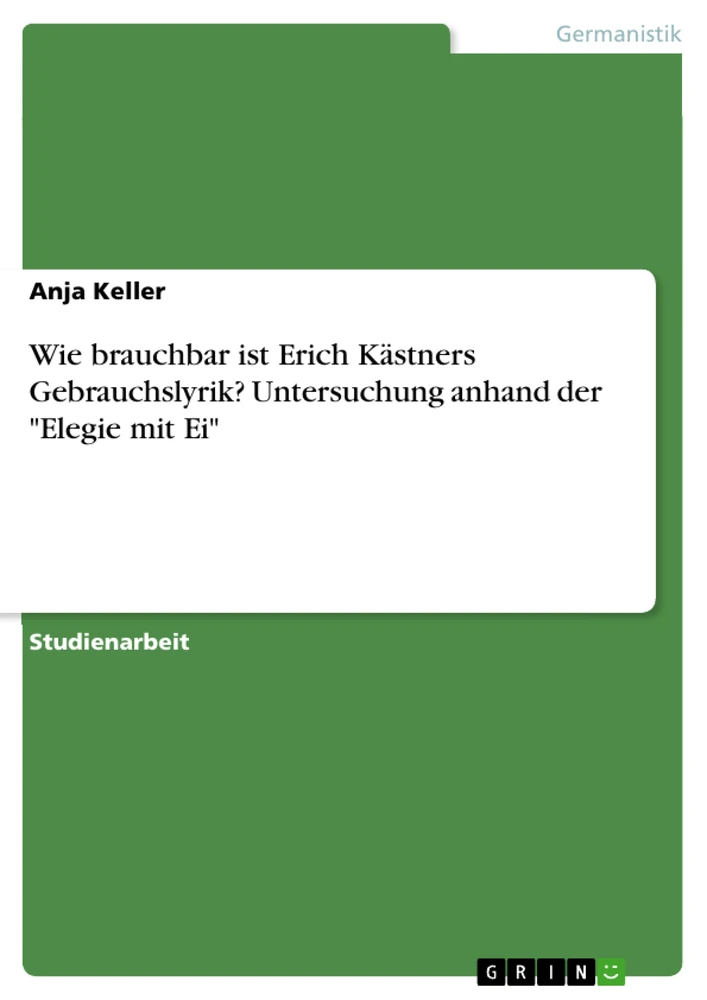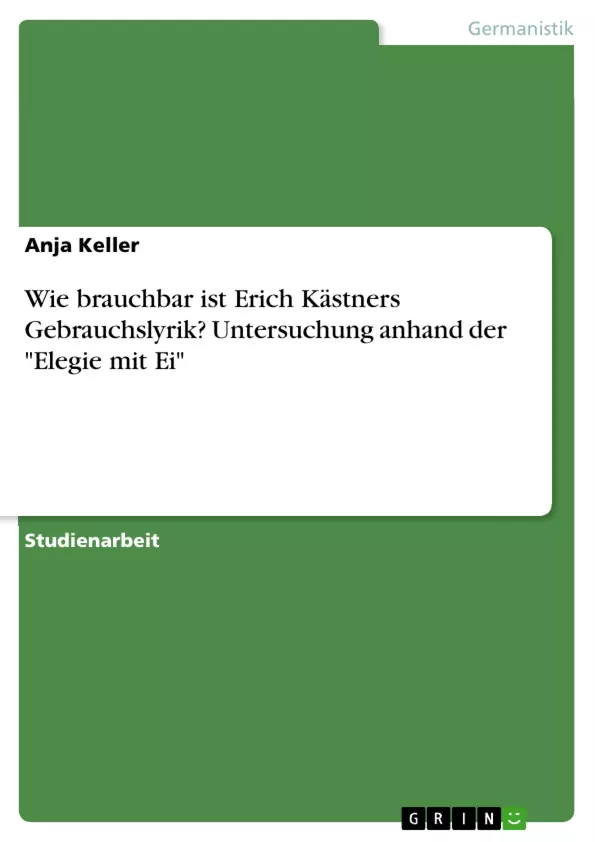Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner (1899-1974) verfasste zwar Gedichte, doch nicht um der Kunst willen, sondern um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Der Lehrer und der Journalist in ihm begründen sein Verständnis von Gebrauchslyrik. In der vorliegenden Arbeit soll anhand von Erich Kästners Gedichts „Elegie mit Ei“ die Umsetzung seiner programmatischen Ziele, die er mit seiner Gebrauchslyrik verfolgte, überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Nachweis „seelischer“ Funktionalität: Elegie mit Ei
- 3. Kästner und Komik – Kästner und Humor
- 3.1. Komische Kontraste
- 3.2. Blumenträume versus blonder Neger
- 4. Das lyrische Wir und die alltägliche Sprache
- 5. Fragen, Rätsel - keine Antwort, nur Pflicht und Lachen
- 5.1. „Wir wollen“ – „Beginnt ein Anfang? Stehen wir am Ende?“
- 5.2. „Mut zur Arbeit [...] Und Mut zum Lachen“
- 6. Ein letztes Wort zur lustigen bzw. lyrischen Form
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Gebrauchslyrik“ Erich Kästners anhand seines Gedichts „Elegie mit Ei“. Ziel ist es, die Umsetzung von Kästners programmatischen Zielen in diesem Gedicht zu überprüfen und zu analysieren, inwiefern seine lyrischen Arbeiten seinen Absichten entsprechen. Die Arbeit beleuchtet Kästners biographischen Hintergrund und dessen Einfluss auf sein Verständnis von Lyrik als funktionalem Instrument.
- Kästners Verständnis von „Gebrauchslyrik“ und seine programmatischen Ziele
- Die Rolle von Komik und Humor in Kästners Lyrik
- Die Verwendung alltäglicher Sprache und das lyrische „Wir“ in der „Elegie mit Ei“
- Analyse der formalen Gestaltung der „Elegie mit Ei“
- Der Bezug der „Elegie mit Ei“ zu gesellschaftlichen und politischen Kontexten der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Brauchbarkeit von Kästners Gebrauchslyrik vor und führt in die Thematik ein. Sie beleuchtet Kästners biographischen Hintergrund – seine angestrebte Lehrerlaufbahn, die durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde, und seine journalistische Tätigkeit – um sein Verständnis von Lyrik als funktionalem Instrument zu erhellen. Kästners eigenes Verständnis von Gebrauchslyrik als „seelisch verwendbare Strophen“ wird eingeführt, und die „Elegie mit Ei“ wird als Untersuchungsgegenstand präsentiert. Der Bezug auf Kästners Zitat, wonach Verse, die nicht zu gebrauchen sind, lediglich Reimspielereien seien, verdeutlicht den Anspruch an die Funktionalität seiner Lyrik.
2. Zum Nachweis „seelischer“ Funktionalität: Elegie mit Ei: Dieses Kapitel analysiert das Gedicht „Elegie mit Ei“ im Detail. Es wird die Struktur des Gedichts, bestehend aus acht vierzeiligen Strophen, beschrieben und der Kontext seiner Erstveröffentlichung sowie dessen Aufnahme in verschiedene Gedichtbände erläutert. Das Kapitel bietet eine tiefere Interpretation des Gedichtinhalts und untersucht, wie Kästner seine programmatischen Ziele der „seelischen Verwendbarkeit“ in diesem Werk umsetzt. Die Analyse wird sich auf die spezifischen sprachlichen Mittel, die Bildsprache und die thematischen Schwerpunkte des Gedichts konzentrieren.
3. Kästner und Komik - Kästner und Humor: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Komik und Humor in Kästners Werk, insbesondere in der „Elegie mit Ei“. Es wird zwischen Komik als Darstellungsweise und Humor als Weltanschauung unterschieden. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie Kästner komische Elemente einsetzt, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und komplexe Themen auf eine zugängliche Weise zu vermitteln. Es werden verschiedene komische Techniken analysiert und deren Beitrag zur Wirkung des Gedichts diskutiert. Die Kapitel untersuchen, wie die Komik sowohl konkrete Probleme als auch allgemeine Themen des Lebens auf humorvolle Weise zugänglich macht.
4. Das lyrische Wir und die alltägliche Sprache: Dieses Kapitel fokussiert auf die sprachliche Gestaltung der „Elegie mit Ei“. Es untersucht die Verwendung der alltäglichen Sprache und das „lyrische Wir“ als ein zentrales Stilmittel. Die Analyse wird sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Kästner durch diese sprachlichen Mittel eine Verbindung zum Leser herstellt und eine unmittelbare, persönliche Ansprache erzeugt. Der Fokus liegt auf der Wirkung der gewählten Sprache auf die Rezeption und das Verständnis des Gedichts.
5. Fragen, Rätsel - keine Antwort, nur Pflicht und Lachen: Dieses Kapitel analysiert die offene Struktur und den fragmentarischen Charakter des Gedichts. Es untersucht, wie Kästner durch Fragen und Rätsel den Leser zur Reflexion anregt, ohne explizite Antworten zu liefern. Die Analyse konzentriert sich auf die implizierten Botschaften und die Bedeutung der abschließenden Betonung von „Pflicht“ und „Lachen“. Es wird die Verbindung zwischen der gesellschaftskritischen Botschaft des Gedichts und seiner humorvollen Gestaltung erörtert.
6. Ein letztes Wort zur lustigen bzw. lyrischen Form: Dieses Kapitel untersucht die lyrische Form und den Aufbau der „Elegie mit Ei“ und analysiert, wie diese Form zur Gesamtdeutung beiträgt. Es wird die Frage nach der bewussten Wahl dieser Form und der damit verbundenen Wirkung erörtert und in Zusammenhang mit den vorherigen Kapiteln gesetzt. Die Bedeutung der formalen Gestaltung im Kontext von Kästners programmatischen Zielen wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Gebrauchslyrik, Elegie mit Ei, Komik, Humor, Alltags-Sprache, Lyrisches Wir, Gesellschaftskritik, Funktionale Lyrik, Zeitschriftenliteratur, Intertextualität.
Erich Kästner: "Elegie mit Ei" - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Erich Kästners Gedicht "Elegie mit Ei" im Kontext seiner programmatischen Ziele und seines Verständnisses von "Gebrauchslyrik". Sie untersucht, wie Kästners biographischer Hintergrund sein Verständnis von Lyrik als funktionales Instrument beeinflusst hat und inwiefern das Gedicht diese Absichten widerspiegelt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte von Kästners "Elegie mit Ei", darunter:
- Kästners Verständnis von "Gebrauchslyrik" und seine programmatischen Ziele.
- Die Rolle von Komik und Humor in Kästners Lyrik.
- Die Verwendung alltäglicher Sprache und das lyrische "Wir" im Gedicht.
- Die formale Gestaltung der "Elegie mit Ei".
- Der Bezug des Gedichts zu gesellschaftlichen und politischen Kontexten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, detaillierte Analyse der "Elegie mit Ei", Untersuchung von Komik und Humor, Analyse der Sprache und des "lyrischen Wir", Analyse der offenen Struktur und des fragmentarischen Charakters, Untersuchung der lyrischen Form und ein Fazit.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Kapitel befassen sich detailliert mit folgenden Aspekten:
- Einleitung: Vorstellung der Forschungsfrage, Einordnung von Kästners Werk und Einführung der "Elegie mit Ei".
- Zum Nachweis „seelischer“ Funktionalität: Elegie mit Ei: Detaillierte Analyse des Gedichts, Struktur, Kontext und Interpretation des Inhalts.
- Kästner und Komik - Kästner und Humor: Untersuchung der Rolle von Komik und Humor im Gedicht, Unterscheidung zwischen Komik und Humor und deren Wirkung.
- Das lyrische Wir und die alltägliche Sprache: Analyse der sprachlichen Gestaltung, Verwendung alltäglicher Sprache und des lyrischen "Wir".
- Fragen, Rätsel - keine Antwort, nur Pflicht und Lachen: Analyse der offenen Struktur, Fragen, Rätsel und implizierte Botschaften.
- Ein letztes Wort zur lustigen bzw. lyrischen Form: Untersuchung der lyrischen Form und deren Beitrag zur Gesamtdeutung.
- Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Erich Kästner, Gebrauchslyrik, Elegie mit Ei, Komik, Humor, Alltagssprache, Lyrisches Wir, Gesellschaftskritik, Funktionale Lyrik, Zeitschriftenliteratur, Intertextualität.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Brauchbarkeit von Kästners Gebrauchslyrik anhand der "Elegie mit Ei" und analysiert, inwieweit das Gedicht seinen programmatischen Zielen entspricht.
Wie wird Kästners Verständnis von „Gebrauchslyrik“ definiert?
Kästners „Gebrauchslyrik“ wird als „seelisch verwendbare Strophen“ beschrieben. Verse, die nicht zu gebrauchen sind, gelten als reine Reimspielereien.
- Arbeit zitieren
- Anja Keller (Autor:in), 2012, Wie brauchbar ist Erich Kästners Gebrauchslyrik? Untersuchung anhand der "Elegie mit Ei", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023173