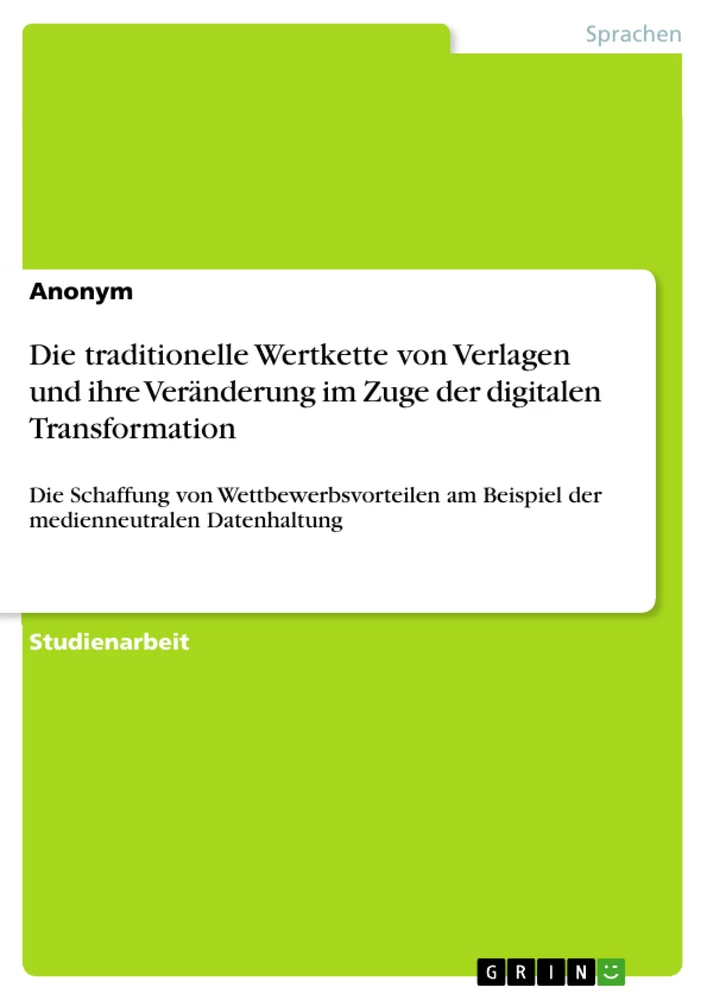Die digitale Transformation ist ein Prozess, dessen Auswirkungen sich in allen Bereichen der Wirtschaft bemerkbar machen. Auch Verlage bleiben vom digitalen Wandel nicht verschont und müssen auf ihn reagieren. Um wettbewerbsrelevant zu bleiben, müssen sie deshalb Veränderungen an ihrem Publikationsprozess vornehmen. Eine dieser Veränderungen ist die medienneutrale Datenhaltung mittels der erweiterbaren Auszeichnungssprache (XML). Aus diesen beiden Umständen heraus ergibt sich die Frage, welche Wettbewerbsstrategie sich in Bezug auf die medienneutrale Datenhaltung zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen eignet. Die vorliegende Arbeit soll diese Frage beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der Wertkette nach Porter und dessen Übertragung auf das traditionelle Verlagsgeschäft
- Wettbewerbsvorteile und Wertkette nach Porter
- Die traditionelle Wertkette von Verlagen
- Die digitale Transformation in der Verlagsbranche
- Markttendenzen
- Medienneutrale Datenhaltung
- Veränderungen in der Wertkette von Verlagen
- Medienneutrale Datenhaltung in der Wertkette von Verlagen
- Wettbewerbsvorteile durch medienneutrale Datenhaltung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die traditionelle Wertkette von Verlagen. Die Arbeit fokussiert sich insbesondere auf die medienneutrale Datenhaltung als Reaktion auf die veränderten Marktanforderungen und analysiert, wie diese Technologie zu Wettbewerbsvorteilen führen kann.
- Analyse der traditionellen Wertkette im Verlagswesen nach Porter
- Beschreibung der digitalen Transformation in der Verlagsbranche und ihrer Markttendenzen
- Erläuterung der medienneutralen Datenhaltung als Reaktion auf die digitalen Veränderungen
- Untersuchung der Veränderungen in der Wertkette von Verlagen durch die medienneutrale Datenhaltung
- Beurteilung der Wettbewerbsvorteile, die durch medienneutrale Datenhaltung erzielt werden können
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der digitalen Transformation in der Verlagsbranche und die damit verbundenen Herausforderungen für Verlage vor. Die medienneutrale Datenhaltung wird als ein wichtiger Faktor für die Bewältigung dieser Herausforderungen präsentiert. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar.
- Das Modell der Wertkette nach Porter und dessen Übertragung auf das traditionelle Verlagsgeschäft: Dieses Kapitel erklärt das Modell der Wertkette nach Porter und erläutert, wie es auf die traditionellen Arbeitsabläufe im Verlagswesen übertragen werden kann. Es werden die einzelnen Wertaktivitäten im Verlagswesen dargestellt und die Bedeutung von Wettbewerbsvorteilen für den Erfolg von Verlagen hervorgehoben.
- Die digitale Transformation in der Verlagsbranche: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen, denen sich die Verlagsbranche aufgrund der digitalen Transformation gegenübersieht. Es werden Markttendenzen und die Entwicklungen in der Digitalisierung der Verlagswelt dargestellt. Die medienneutrale Datenhaltung wird als eine zentrale Reaktion auf diese Veränderungen vorgestellt.
- Veränderungen in der Wertkette von Verlagen: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der medienneutralen Datenhaltung auf die Wertkette von Verlagen. Es werden die Veränderungen in den einzelnen Wertaktivitäten beschrieben und die potenziellen Vorteile der medienneutralen Datenhaltung für Verlage diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die digitale Transformation, die traditionelle Wertkette von Verlagen, die medienneutrale Datenhaltung, Wettbewerbsvorteile, XML, Verlagswesen, Publikationsprozesse und das Porter-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist medienneutrale Datenhaltung?
Es handelt sich um die Speicherung von Inhalten (oft mittels XML), die unabhängig vom späteren Ausgabemedium (Print, E-Book, Web) erfolgt, um eine flexible Mehrfachverwertung zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt das Porter-Modell in dieser Arbeit?
Das Modell der Wertkette nach Michael Porter wird genutzt, um die traditionellen Abläufe im Verlagswesen zu analysieren und zu zeigen, wo digitale Transformation Wettbewerbsvorteile schafft.
Warum müssen Verlage ihre Wertkette anpassen?
Durch die digitale Transformation ändern sich Markttendenzen und Konsumgewohnheiten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Publikationsprozesse effizienter und medienübergreifend gestaltet werden.
Was sind die Vorteile von XML im Verlagswesen?
XML ermöglicht eine strukturierte, erweiterbare Auszeichnung von Daten, was die automatisierte Verarbeitung und die Ausgabe in verschiedene Formate erheblich erleichtert.
Welche Wettbewerbsstrategien werden thematisiert?
Die Arbeit untersucht, welche Strategien in Bezug auf die medienneutrale Datenhaltung geeignet sind, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu erzielen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die traditionelle Wertkette von Verlagen und ihre Veränderung im Zuge der digitalen Transformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023658