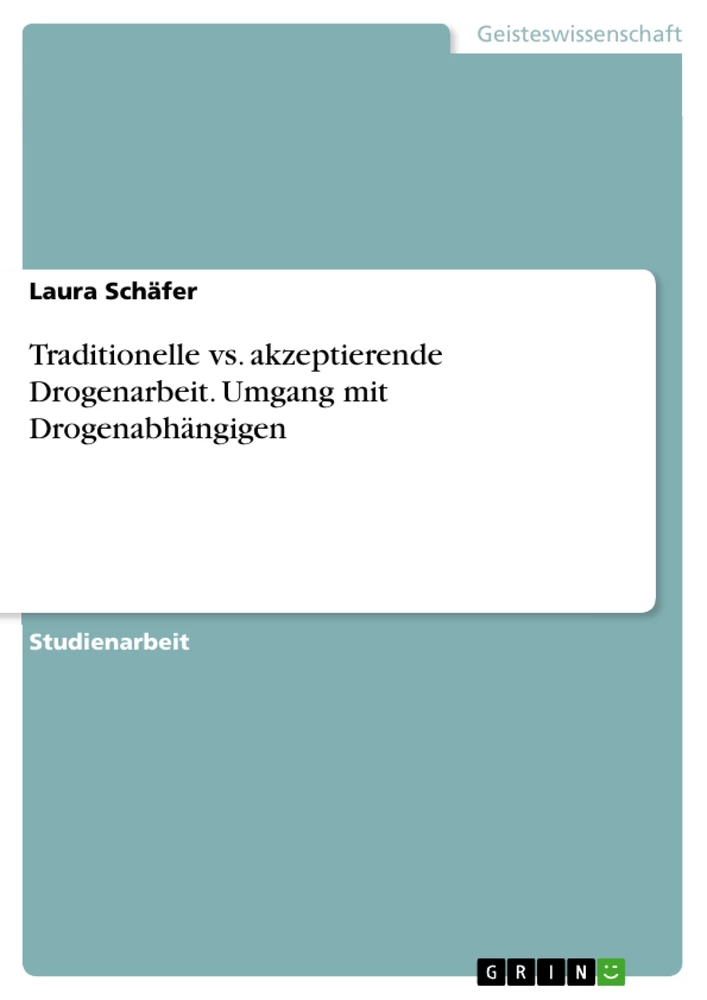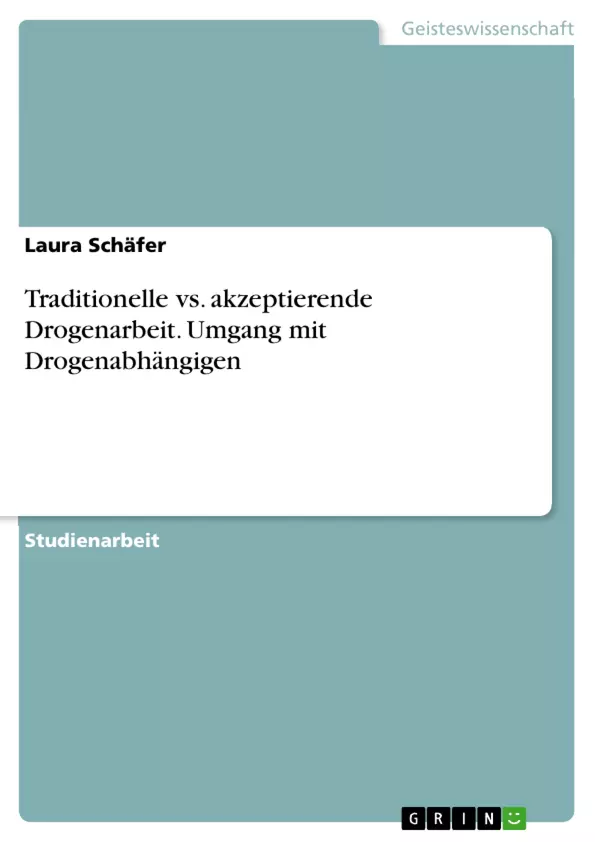In dieser Arbeit werden die Modelle der abstinenzorientierten und akzeptierenden Drogenarbeit in Relation gesetzt und auf ihre politische Basis eingegangen. Ebenso ist es von relevanter Bedeutung, welche Meinungen die Gesellschaft in Bezug auf beide Ansätze vertritt. Drogen gehören in den Bereich der Suchtmittel, welche zielgerichtet die Wahrnehmung und das menschliche Bewusstsein verändern.
Bereits im Kindesalter wird dem Individuum mithilfe diverser Programme versucht zu vermitteln, dass die Einnahme von Substanzen nicht dem gesellschaftlichen Ideal entspricht und sowohl psychische als auch physische Schäden hinterlässt. Durch die Prävention wird von den Erziehungsberechtigten und den Lehrbeauftragten versucht, die Sprösslinge vor einer sozialen Verelendung zu beschützen. Auch die Medien vermitteln ein extrem abschreckendes Bild von drogensüchtigen Menschen, seien es der totgefixte Junkie auf der Toilette oder Fotos von abscheulichen Krankheiten. Zudem kursieren Meldungen über die Prostitution als Beschaffungsmaßnahme für die Substanzen, was ebenso bereits von Jugendlichen ausgeübt wird.
Auch die damit verbundene Kriminalität wie Diebstahl und der Drogenhandel an sich spielen eine immense Rolle. Letztendlich wird dem Individuum sein Leben lang übermittelt, dass nicht nur Drogen an sich, sondern auch diejenigen, welche der Sucht verfallen sind, gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Trotz der aufwändigen Präventionsmaßnahmen, welche in allen Lebensbereichen wirksam werden, verfallen dennoch viele Menschen der Sucht. Daher ist nicht nur die Prävention relevant, sondern auch die Intervention.
Die Drogensucht ist quasi nicht die Endstation, denn es existieren auch Wege aus der Abhängigkeit. Es gibt ein weites Spektrum an Therapiemöglichkeiten, welches sich hauptsächlich auf zwei Grundmodelle bezieht. Zum einen der Ansatz der abstinenzorientierten Drogenarbeit und zum anderen die akzeptierende Arbeit mit drogensüchtigen Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung in der Arbeit mit Drogenabhängigen
- Beginn mit der Traditionellen Drogenhilfe
- Wandel in die akzeptanzorientierte Suchtkrankenhilfe
- Das traditionelle und akzeptanzorientierte Konzept im Diskurs
- Traditionelle Drogenarbeit
- Grundlagen
- Politische Ansätze
- Akzeptanzorientierte Suchtkrankenhilfe
- Grundlagen
- Politische Ansätze
- Gesellschaftliche Ansichten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung der Drogenhilfe in Deutschland zu beleuchten und die beiden dominanten Ansätze – die traditionelle Drogenarbeit und die akzeptanzorientierte Suchtkrankenhilfe – in ihren Grundzügen und politischen Implikationen zu vergleichen.
- Entwicklung der Drogenhilfe in Deutschland
- Traditionelle Drogenarbeit: Grundlagen und politische Ansätze
- Akzeptanzorientierte Suchtkrankenhilfe: Grundlagen und politische Ansätze
- Gesellschaftliche Ansichten zum Thema Drogenhilfe
- Bedeutung von Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen Drogenabhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problematik des Drogenkonsums und stellt die beiden zentralen Ansätze der Drogenhilfe – die traditionelle und die akzeptanzorientierte – vor. Kapitel 2 verfolgt die Entwicklung der Drogenhilfe in Deutschland, beginnend mit der traditionellen Drogenarbeit der 1920er Jahre und ihrer Fokussierung auf Abstinenz und psychiatrische Behandlung. Es beleuchtet anschließend den Wandel hin zur akzeptanzorientierten Suchtkrankenhilfe, der durch die AIDS-Epidemie der 1980er Jahre beschleunigt wurde. Kapitel 3 vergleicht die beiden Ansätze im Detail, indem es ihre jeweiligen Grundlagen und politischen Dimensionen aufzeigt. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Rolle von gesellschaftlichen Ansichten im Umgang mit Drogenabhängigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der Drogenhilfe, wie Traditionelle Drogenarbeit, Akzeptanzorientierte Suchtkrankenhilfe, Abstinenzorientierung, Präventionsmaßnahmen, politische Ansätze und gesellschaftliche Ansichten. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Drogenhilfe in Deutschland und die verschiedenen Perspektiven auf den Umgang mit Drogenabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen abstinenzorientierter und akzeptierender Drogenarbeit?
Abstinenzorientierte Arbeit fordert den sofortigen Verzicht auf Drogen, während akzeptierende Drogenarbeit den Konsum als Realität anerkennt und auf Schadensminimierung (Harm Reduction) setzt.
Wie entwickelte sich die Drogenhilfe in Deutschland?
Sie begann in den 1920ern mit psychiatrischer Behandlung und wandelte sich in den 1980ern durch die AIDS-Epidemie hin zu akzeptanzorientierten Ansätzen.
Welche Rolle spielt die Prävention bei Drogensucht?
Prävention soll bereits im Kindesalter durch Aufklärung vor den physischen und sozialen Folgen des Substanzkonsums schützen.
Warum ist Intervention in der Drogenhilfe notwendig?
Da Prävention nicht immer erfolgreich ist, braucht es Interventionsmodelle, um Abhängigen Wege aus der Sucht oder ein Überleben mit der Sucht zu ermöglichen.
Wie sieht das gesellschaftliche Bild von Drogenabhängigen aus?
Das Bild ist oft geprägt von Abschreckung, Kriminalisierung und sozialer Ächtung, was die Hilfeangebote politisch beeinflusst.
- Quote paper
- Laura Schäfer (Author), 2015, Traditionelle vs. akzeptierende Drogenarbeit. Umgang mit Drogenabhängigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023866