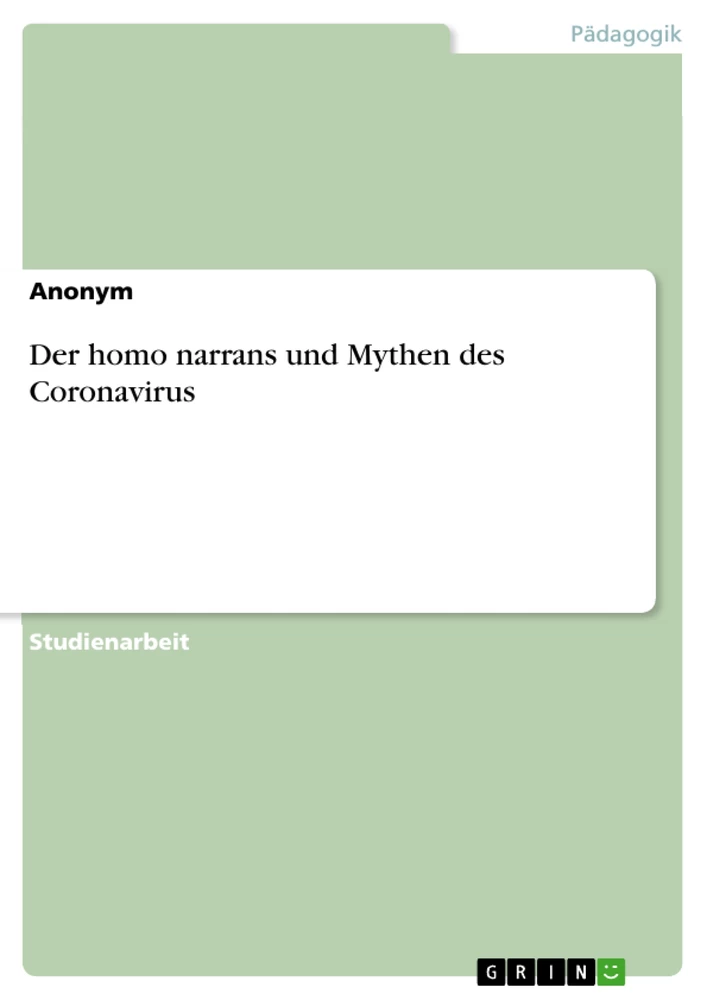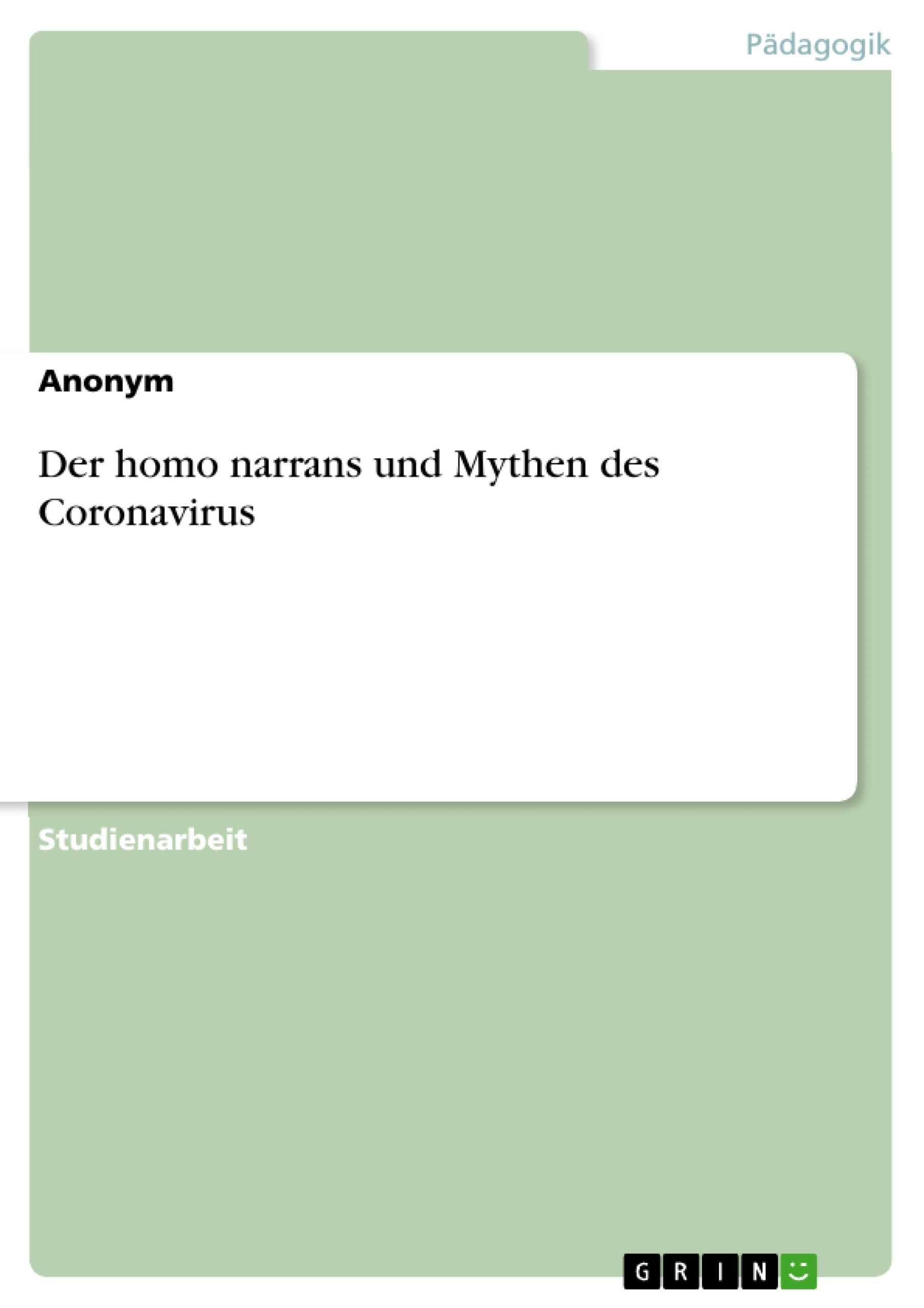Im Folgenden möchten wir genauer darauf eingehen, was sich hinter dem spielenden bzw. erzählenden Menschen verbirgt, wobei wir uns vor allem auf die von Albrecht Koschorke in seinem Buch "Wahrheit und Erfindung" aufgestellten Thesen stützen. Anhand eines aktuellen Beispiels zeigen wir, warum der homo narrans Verschwörungstheorien entwickelt und wie diese in Zusammenhang zur Kontingenzbewältigung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- "Erzählung [...] ist einfach da, so wie das Leben".
- Der Begriff des ‘homo ludens’
- Der ‘homo narrans’
- Kontingenzbewältigung und Verschwörungstheorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den "homo narrans" und seine Verbindung zum "homo ludens", basierend auf den Thesen von Albrecht Koschorke. Sie analysiert, wie der Mensch durch Erzählungen, insbesondere im Kontext aktueller Ereignisse wie der Coronapandemie, mit Kontingenz umgeht und Verschwörungstheorien entwickelt.
- Der "homo narrans" als grundlegendes menschliches Merkmal
- Die Beziehung zwischen "homo narrans" und "homo ludens"
- Erzählen als Strategie zur Kontingenzbewältigung
- Die Rolle von Erzählungen in der Entstehung von Verschwörungstheorien
- Die Funktion von Erzählungen im Umgang mit Unsicherheit und Angst
Zusammenfassung der Kapitel
"Erzählung [...] ist einfach da, so wie das Leben".: Dieses einleitende Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die Konzepte des "homo narrans" und des "homo ludens" einführt und deren Verbindung zueinander erläutert. Es stützt sich dabei auf die Thesen von Roland Barthes und Johan Huizinga und führt in die Argumentation von Albrecht Koschorke ein, der die Erzählung als anthropologisches Universal versteht. Die Verknüpfung von Spiel und Erzählen wird hervorgehoben, unter Hinweis auf die gemeinschaftsstiftende und lustvolle Natur narrativer Praktiken.
Der Begriff des ‘homo ludens’: Dieses Kapitel vertieft den Begriff des "homo ludens" nach Johan Huizinga, beleuchtet dessen Kerngedanken und Eigenschaften (Freiheit, Uneigentlichkeit, Regelbindung etc.) und analysiert dessen Relevanz für das Verständnis des "homo narrans". Kritisch wird die kategorische Trennung zwischen Spiel und sozialer Nützlichkeit diskutiert, wobei die Vielschichtigkeit und Ambivalenz des Spielbegriffs herausgestellt werden. Huizingas Konzept wird als Grundlage für die spätere Analyse des Erzählens verwendet.
Der ‘homo narrans’: Dieses Kapitel widmet sich dem "homo narrans", wobei Koschorkes allgemeine Erzähltheorie im Mittelpunkt steht. Die unzureichenden Konzepte früherer Erzähltheorien werden kritisiert. Koschorke erweitert den Begriff des "homo narrans" und sieht Erzählen nicht nur als komplexitätsreduzierend und sinnstiftend, sondern auch als Quelle von Desorientierung und Unsicherheit. Das Kapitel hebt die Fähigkeit des "homo narrans" hervor, die Differenz zwischen Wahrheit und Erfindung zu erkennen und mit dieser zu spielen. Die Erzählung als subjektivierende Kulturtechnik und ihr Einfluss auf Subjekttheorien werden thematisiert.
Kontingenzbewältigung und Verschwörungstheorien: Dieser Abschnitt untersucht die Funktion des Erzählens im Kontext der Kontingenzbewältigung. Ausgehend von Luhmanns Konzept der Kontingenz wird argumentiert, dass Geschichten eine Strategie darstellen, um mit Ungewissheit und Angst umzugehen und die Lebenswirklichkeit in einen verständlichen Gesamtzusammenhang einzubetten. Am Beispiel der Coronapandemie und der damit verbundenen Verschwörungstheorien wird gezeigt, wie der "homo narrans" versucht, die Komplexität der Ereignisse zu reduzieren und ein kohärentes Weltbild zu konstruieren. Die Entstehung und Verbreitung von Verschwörungstheorien als Reaktion auf Unsicherheit und Hilflosigkeit wird analysiert.
Schlüsselwörter
Homo narrans, Homo ludens, Erzähltheorie, Albrecht Koschorke, Kontingenzbewältigung, Verschwörungstheorien, Narrativer Weltzugang, Pandemie, Coronavirus, Wahrheit und Erfindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Erzählung [...] ist einfach da, so wie das Leben"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den "homo narrans" und seine Verbindung zum "homo ludens" anhand der Thesen von Albrecht Koschorke. Im Fokus steht die Analyse, wie Menschen, insbesondere im Kontext von Ereignissen wie der Coronapandemie, durch Erzählungen mit Unsicherheit und Kontingenz umgehen und wie Verschwörungstheorien entstehen.
Welche zentralen Konzepte werden behandelt?
Die zentralen Konzepte sind "homo narrans" (der erzählende Mensch) und "homo ludens" (der spielende Mensch). Die Arbeit beleuchtet deren Beziehung zueinander und untersucht die Funktion des Erzählens als Strategie zur Kontingenzbewältigung und im Zusammenhang mit der Entstehung von Verschwörungstheorien. Die Theorien von Albrecht Koschorke, Johan Huizinga und Niklas Luhmann spielen dabei eine wichtige Rolle.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Theorien von Albrecht Koschorke, Johan Huizinga (zum "homo ludens") und Niklas Luhmann (zum Konzept der Kontingenz). Roland Barthes wird ebenfalls erwähnt.
Wie wird der "homo narrans" definiert?
Der "homo narrans" wird, basierend auf Koschorkes Theorie, als ein grundlegendes menschliches Merkmal verstanden. Erzählen wird nicht nur als komplexitätsreduzierend und sinnstiftend gesehen, sondern auch als Quelle von Desorientierung und Unsicherheit. Die Arbeit betont die Fähigkeit des "homo narrans", die Differenz zwischen Wahrheit und Erfindung zu erkennen und mit ihr zu spielen.
Welche Rolle spielt der "homo ludens"?
Der "homo ludens" nach Huizinga wird im Kontext des Erzählens betrachtet. Seine Eigenschaften wie Freiheit, Uneigentlichkeit und Regelbindung werden analysiert, um die Beziehung zum "homo narrans" zu verstehen. Die Arbeit diskutiert kritisch die strikte Trennung von Spiel und sozialer Nützlichkeit.
Wie wird die Entstehung von Verschwörungstheorien erklärt?
Die Arbeit argumentiert, dass Verschwörungstheorien als Reaktion auf Unsicherheit und Hilflosigkeit entstehen. Sie stellen einen Versuch des "homo narrans" dar, die Komplexität von Ereignissen (am Beispiel der Coronapandemie) zu reduzieren und ein kohärentes Weltbild zu konstruieren.
Wie wird Kontingenz in der Arbeit behandelt?
Kontingenz, im Sinne von Luhmanns Theorie, wird als Ausgangspunkt für die Analyse der Funktion des Erzählens betrachtet. Erzählungen werden als Strategien zur Bewältigung von Ungewissheit und Angst interpretiert, die die Lebenswirklichkeit in einen verständlichen Zusammenhang einbetten sollen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: "Erzählung [...] ist einfach da, so wie das Leben" (Einführung), "Der Begriff des ‘homo ludens’", "Der ‘homo narrans’", und "Kontingenzbewältigung und Verschwörungstheorien".
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Homo narrans, Homo ludens, Erzähltheorie, Albrecht Koschorke, Kontingenzbewältigung, Verschwörungstheorien, Narrativer Weltzugang, Pandemie, Coronavirus, Wahrheit und Erfindung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Der homo narrans und Mythen des Coronavirus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1024547